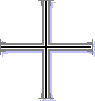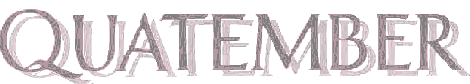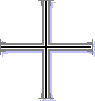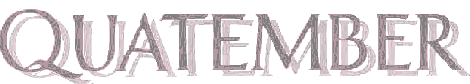An dieser Stelle folgt mitten unter sogenannten Aufsätzen ein Brief, geschrieben an die Schwestern des Berneuchener Dienstes. Was Aufsätze gemeinhin an Problemen zu entfalten pflegen, steckt hier unmittelbar im persönlichen Erlebnisbericht, keinesfalls unverbindlicher allerdings. Die große Frage nach der tragenden Kraft im Amt eines Entwicklungshelfers, das mit außergewöhnlichen Versuchungen und Resignationen verbunden ist, wird hier aus einer ganz persönlichen, auch höchst ökumenischen Begegnung heraus dargelegt. Deshalb hat dieser Brief, der in seinem persönlichen Tonfall zu erhalten war, sicherlich das Gewicht eines Artikels über Probleme der Entwicklungshilfe und steht deshalb hier. Daß die Briefschreiberin, die als staatlich ausgebildete und staatlich besoldete Entwicklungshelferin zweieinhalb Jahre in einem großen afrikanischen Dorf arbeitete, ihren Namen nicht genannt haben wollte, wird zu respektieren und nach der Lektüre des Briefes gewiß auch zu verstehen sein. H. B. An dieser Stelle folgt mitten unter sogenannten Aufsätzen ein Brief, geschrieben an die Schwestern des Berneuchener Dienstes. Was Aufsätze gemeinhin an Problemen zu entfalten pflegen, steckt hier unmittelbar im persönlichen Erlebnisbericht, keinesfalls unverbindlicher allerdings. Die große Frage nach der tragenden Kraft im Amt eines Entwicklungshelfers, das mit außergewöhnlichen Versuchungen und Resignationen verbunden ist, wird hier aus einer ganz persönlichen, auch höchst ökumenischen Begegnung heraus dargelegt. Deshalb hat dieser Brief, der in seinem persönlichen Tonfall zu erhalten war, sicherlich das Gewicht eines Artikels über Probleme der Entwicklungshilfe und steht deshalb hier. Daß die Briefschreiberin, die als staatlich ausgebildete und staatlich besoldete Entwicklungshelferin zweieinhalb Jahre in einem großen afrikanischen Dorf arbeitete, ihren Namen nicht genannt haben wollte, wird zu respektieren und nach der Lektüre des Briefes gewiß auch zu verstehen sein. H. B.
 Meine Entwicklungshelferinnenzeit ist zu Ende. Zwischen meinem Abflug aus Togo und der erneuten Aufnahme meiner Tätigkeit im Schuldienst lag knapp ein Monat freie Zeit zur Umstellung und zur Wiedereingewöhnung in den deutschen Lebensstil. Dankbar nahm ich die Möglichkeit wahr, einen kleinen Teil dieser Zeit in Kirchberg und zwar während der Verpflichtetenwoche des Berneuchener Dienstes zu verbringen. Dort ergab es sich, daß ich, anschließend an eine Tischmesse, noch einmal ein wenig von meinem Dasein in Afrika erzählte. All denen, die nicht dabei sein konnten, sich aber doch auch ein klein wenig für den Bericht interessieren, möchte ich hier eine kurze Zusammenfassung geben. Aber ich möchte auch jetzt, da ich vor der Schreibmaschine sitze, den gleichen Hinweis wie an jenem Abend in Kirchberg geben: Ich möchte und kann hier keinen ausgefeilten Abschlußbericht meiner Tätigkeit vorlegen, dazu habe ich einfach im Augenblick keine Zeit und auch nicht die innere Ruhe. Meine Entwicklungshelferinnenzeit ist zu Ende. Zwischen meinem Abflug aus Togo und der erneuten Aufnahme meiner Tätigkeit im Schuldienst lag knapp ein Monat freie Zeit zur Umstellung und zur Wiedereingewöhnung in den deutschen Lebensstil. Dankbar nahm ich die Möglichkeit wahr, einen kleinen Teil dieser Zeit in Kirchberg und zwar während der Verpflichtetenwoche des Berneuchener Dienstes zu verbringen. Dort ergab es sich, daß ich, anschließend an eine Tischmesse, noch einmal ein wenig von meinem Dasein in Afrika erzählte. All denen, die nicht dabei sein konnten, sich aber doch auch ein klein wenig für den Bericht interessieren, möchte ich hier eine kurze Zusammenfassung geben. Aber ich möchte auch jetzt, da ich vor der Schreibmaschine sitze, den gleichen Hinweis wie an jenem Abend in Kirchberg geben: Ich möchte und kann hier keinen ausgefeilten Abschlußbericht meiner Tätigkeit vorlegen, dazu habe ich einfach im Augenblick keine Zeit und auch nicht die innere Ruhe.
 Über meine eigene Tätigkeit brauche ich ja nicht mehr viel zu erzählen, Sie konnten dazu schon in meinem anderen Berichten einiges erfahren, und im übrigen sind auch Zeitschriften und Fernsehen ja recht mitteilsam. Was ich vielmehr möchte, das ist ein Problem aufzeigen, das ich selbst für mich zu lösen hatte und auch bei vielen meiner Kameraden erfuhr. Es soll nicht als Kritik aufgefaßt werden - schließlich weiß ich selbst, daß manchen Erfahrungen einfach fast nicht auszuweichen ist, aber ich möchte Sie aufrufen, hier mitzudenken und mitzubeten. Über meine eigene Tätigkeit brauche ich ja nicht mehr viel zu erzählen, Sie konnten dazu schon in meinem anderen Berichten einiges erfahren, und im übrigen sind auch Zeitschriften und Fernsehen ja recht mitteilsam. Was ich vielmehr möchte, das ist ein Problem aufzeigen, das ich selbst für mich zu lösen hatte und auch bei vielen meiner Kameraden erfuhr. Es soll nicht als Kritik aufgefaßt werden - schließlich weiß ich selbst, daß manchen Erfahrungen einfach fast nicht auszuweichen ist, aber ich möchte Sie aufrufen, hier mitzudenken und mitzubeten.
 So gehe ich nun also zurück nach Cambole und zwar ganz in die Anfangszeiten. Es war im Januar 1970, als wir dort ankamen. Alles war neu, die Menschen, die Umgebung, die Arbeit, und so vergingen die ersten Wochen recht rasch mit den vielseitigsten Versuchen, sich so schnell wie möglich an alles zu gewöhnen. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Nachdem wir so langsam begriffen hatten, um was es ging, was wir zu tun, was zu lassen hatten, da wollten wir natürlich endlich in die Arbeit einsteigen. Aber das ging gar nicht so einfach. Nun, bei mir zeigte sich das zunächst weniger gravierend als bei Jörg. Er, ein gelernter Maurer, wollte ja nun endlich mit Bauen beginnen. Für Häuser, Waschplätze, Kochstellen, Brunnen war schon ein Plan ausgearbeitet. Nur eines hatten wir in unserem Programm vergessen, nämlich wie wir denn dies alles finanzieren wollten. Zwar sind wir auf sehr vieles in unserer Vorbereitung auf den Entwicklungsdienst aufmerksam gemacht worden. So war es jedem klar, daß er mit dem, was er hier gelernt hatte, oft nichts anfangen kann, einfach weil Material und Voraussetzungen anders sind. So gehe ich nun also zurück nach Cambole und zwar ganz in die Anfangszeiten. Es war im Januar 1970, als wir dort ankamen. Alles war neu, die Menschen, die Umgebung, die Arbeit, und so vergingen die ersten Wochen recht rasch mit den vielseitigsten Versuchen, sich so schnell wie möglich an alles zu gewöhnen. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Nachdem wir so langsam begriffen hatten, um was es ging, was wir zu tun, was zu lassen hatten, da wollten wir natürlich endlich in die Arbeit einsteigen. Aber das ging gar nicht so einfach. Nun, bei mir zeigte sich das zunächst weniger gravierend als bei Jörg. Er, ein gelernter Maurer, wollte ja nun endlich mit Bauen beginnen. Für Häuser, Waschplätze, Kochstellen, Brunnen war schon ein Plan ausgearbeitet. Nur eines hatten wir in unserem Programm vergessen, nämlich wie wir denn dies alles finanzieren wollten. Zwar sind wir auf sehr vieles in unserer Vorbereitung auf den Entwicklungsdienst aufmerksam gemacht worden. So war es jedem klar, daß er mit dem, was er hier gelernt hatte, oft nichts anfangen kann, einfach weil Material und Voraussetzungen anders sind.

 Jörg wußte also gut, daß er keine Bausteine kaufen konnte und daß auch die Bauweise eine ganz andere war, aber darauf, daß die Finanzierung unserer Vorhaben Schwierigkeiten machen könnte, darauf hatte uns eigentlich niemand hingewiesen. Es heißt da immer so schön, in der Dorfarbeit könne man alles mit der Dorfbevölkerung lösen, wichtig sei es, die Bedürfnisse selbst einmal abzuspüren und dann eben bei den anderen wecken. Das ist sehr gut und sicher auch richtig und wahrscheinlich auch durchführbar, wenn man in einem ganz kleinen Dorf arbeitet, wo möglichst noch nie Europäer gearbeitet haben, wo jeder einzelne Bewohner noch ein echtes Verhältnis zur Gemeinschaft hat. Dort kann man verlangen, daß die Leute freiwillig in ihrem eigenen Interesse bei der Verwirklichung der Projekte mithelfen. Daß dies aber in einem Dorf von 7000 Einwohnern nicht mehr möglich ist, das haben wir bitter erfahren. Jörg wußte also gut, daß er keine Bausteine kaufen konnte und daß auch die Bauweise eine ganz andere war, aber darauf, daß die Finanzierung unserer Vorhaben Schwierigkeiten machen könnte, darauf hatte uns eigentlich niemand hingewiesen. Es heißt da immer so schön, in der Dorfarbeit könne man alles mit der Dorfbevölkerung lösen, wichtig sei es, die Bedürfnisse selbst einmal abzuspüren und dann eben bei den anderen wecken. Das ist sehr gut und sicher auch richtig und wahrscheinlich auch durchführbar, wenn man in einem ganz kleinen Dorf arbeitet, wo möglichst noch nie Europäer gearbeitet haben, wo jeder einzelne Bewohner noch ein echtes Verhältnis zur Gemeinschaft hat. Dort kann man verlangen, daß die Leute freiwillig in ihrem eigenen Interesse bei der Verwirklichung der Projekte mithelfen. Daß dies aber in einem Dorf von 7000 Einwohnern nicht mehr möglich ist, das haben wir bitter erfahren.
 Freilich konnten wir uns die Tatsache ohne Schwierigkeiten erklären. Die Leute wissen im Dorf, daß man mit Arbeit Geld verdienen kann, und darauf sind sie aus, denn das Leben ist auch im afrikanischen Busch heute teurer und wird immer noch teurer, je mehr der Europäer seine Finger im Spiel hat. Da wird anempfohlen, Privatbrunnen zu bauen, den Fußboden zu zementieren, Matratzen und Moskitonetze zu kaufen - aber all das kostet ja reichlich Geld. Es ist einfach heutzutage nicht mehr drin, daß dann ein Mann Tage oder Wochen opfert, um für die Allgemeinheit zu arbeiten und das eben dann in einem Dorf, wo nicht jeder von den Einrichtungen profitieren kann. Freilich konnten wir uns die Tatsache ohne Schwierigkeiten erklären. Die Leute wissen im Dorf, daß man mit Arbeit Geld verdienen kann, und darauf sind sie aus, denn das Leben ist auch im afrikanischen Busch heute teurer und wird immer noch teurer, je mehr der Europäer seine Finger im Spiel hat. Da wird anempfohlen, Privatbrunnen zu bauen, den Fußboden zu zementieren, Matratzen und Moskitonetze zu kaufen - aber all das kostet ja reichlich Geld. Es ist einfach heutzutage nicht mehr drin, daß dann ein Mann Tage oder Wochen opfert, um für die Allgemeinheit zu arbeiten und das eben dann in einem Dorf, wo nicht jeder von den Einrichtungen profitieren kann.
 Was das aber für uns bedeutet hat, das können Sie sich selbst gut ausmalen. Wir waren von einer Organisation ausgesandt mit dem Hinweis, der Bevölkerung des Gastlandes mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und um bestehende Verhältnisse zu ändern. Ja, und mit dieser Aufgabenstellung begnügte man sich in Deutschland. Wie die Realisierung nun in der Tat aussah, das interessierte mehr oder weniger nur die, die im Lande unter dieser Schwierigkeit litten. Und so möchte ich an dieser Stelle all denen noch einmal herzlich danken, die uns mit so großzügigen Spenden aus der Passivität, fast möchte ich sagen, aus der Lethargie herausgeholfen haben. Jörg, der schon verzweifelt war über sein Dasein im Sessel und mit Däumchendrehen, hatte nun wieder Möglichkeiten, das zu tun, wozu er eigentlich ausgereist war. Was das aber für uns bedeutet hat, das können Sie sich selbst gut ausmalen. Wir waren von einer Organisation ausgesandt mit dem Hinweis, der Bevölkerung des Gastlandes mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und um bestehende Verhältnisse zu ändern. Ja, und mit dieser Aufgabenstellung begnügte man sich in Deutschland. Wie die Realisierung nun in der Tat aussah, das interessierte mehr oder weniger nur die, die im Lande unter dieser Schwierigkeit litten. Und so möchte ich an dieser Stelle all denen noch einmal herzlich danken, die uns mit so großzügigen Spenden aus der Passivität, fast möchte ich sagen, aus der Lethargie herausgeholfen haben. Jörg, der schon verzweifelt war über sein Dasein im Sessel und mit Däumchendrehen, hatte nun wieder Möglichkeiten, das zu tun, wozu er eigentlich ausgereist war.
 Bei mir war es in der ganzen Zeit weniger in Erscheinung getreten, denn ich konnte doch auch ohne Geld so manche meiner sozialen Aufgaben in Angriff nehmen, aber auch ich war von Herzen dankbar, als wir beide richtig schaffen konnten, dazu waren wir zum Entwicklungsdienst gegangen, und eine andere Abwechslung als Arbeit gab es ohnehin so mitten im Busch nicht. Bei uns hatte sich die Situation also glücklicherweise noch einmal geändert, uns war geholfen. Aber was diese Frustration für einen jungen Menschen bedeuten kann, der von keiner Seite her Unterstützung bekommt, das kann man sich hier oft gar nicht vorstellen. Die Versuchungen, seine Mißerfolge und daraus resultierende Komplexe zu kompensieren sind vielseitig. Alkohol, Drogen, Sex - das sind die Auswege aus der Öde des zum Nichtstun Verurteilten, und so werden Idealisten zu Alkoholikern, Menschen mit den besten Vorsätzen zu Süchtigen. Aber die Zeit muß ja irgendwie totgeschlagen werden und wenn man dafür auch noch bezahlt wird, warum nicht auf diese sogenannte angenehme Weise. Bei mir war es in der ganzen Zeit weniger in Erscheinung getreten, denn ich konnte doch auch ohne Geld so manche meiner sozialen Aufgaben in Angriff nehmen, aber auch ich war von Herzen dankbar, als wir beide richtig schaffen konnten, dazu waren wir zum Entwicklungsdienst gegangen, und eine andere Abwechslung als Arbeit gab es ohnehin so mitten im Busch nicht. Bei uns hatte sich die Situation also glücklicherweise noch einmal geändert, uns war geholfen. Aber was diese Frustration für einen jungen Menschen bedeuten kann, der von keiner Seite her Unterstützung bekommt, das kann man sich hier oft gar nicht vorstellen. Die Versuchungen, seine Mißerfolge und daraus resultierende Komplexe zu kompensieren sind vielseitig. Alkohol, Drogen, Sex - das sind die Auswege aus der Öde des zum Nichtstun Verurteilten, und so werden Idealisten zu Alkoholikern, Menschen mit den besten Vorsätzen zu Süchtigen. Aber die Zeit muß ja irgendwie totgeschlagen werden und wenn man dafür auch noch bezahlt wird, warum nicht auf diese sogenannte angenehme Weise.

 Ich glaube, dessen sind sich sehr viele der Verantwortlichen in den Ministerien und Organisationen nicht bewußt, sie ahnen nichts von der Verlassenheit und der Enttäuschung junger Menschen, sonst müßten sie ihre Ideale aus der Anfangszeit der Entwicklungshilfe auch innerhalb eines Jahrzehnts den neuen, sich rasend verändernden Gegebenheiten anpassen. Wir sollen für Fortschritt plädieren und wollen eine der wesentlichen Voraussetzungen, nämlich das Geld aus unserem Gesichtskreis ausschließen. Das hat mit realer und effektiver Arbeit aber auch gar nichts zu tun! Davon, daß es eine untragbare Verantwortungslosigkeit all den Engagierten gegenüber ist, ganz zu schweigen. Dies also ein Gesichtspunkt, der zumindest in der Öffentlichkeit nicht allzu häufig aufgezeigt wird. Ich glaube, dessen sind sich sehr viele der Verantwortlichen in den Ministerien und Organisationen nicht bewußt, sie ahnen nichts von der Verlassenheit und der Enttäuschung junger Menschen, sonst müßten sie ihre Ideale aus der Anfangszeit der Entwicklungshilfe auch innerhalb eines Jahrzehnts den neuen, sich rasend verändernden Gegebenheiten anpassen. Wir sollen für Fortschritt plädieren und wollen eine der wesentlichen Voraussetzungen, nämlich das Geld aus unserem Gesichtskreis ausschließen. Das hat mit realer und effektiver Arbeit aber auch gar nichts zu tun! Davon, daß es eine untragbare Verantwortungslosigkeit all den Engagierten gegenüber ist, ganz zu schweigen. Dies also ein Gesichtspunkt, der zumindest in der Öffentlichkeit nicht allzu häufig aufgezeigt wird.
 Aber nun will ich noch ein wenig von mir erzählen und wie es mir gelungen ist, nicht in die Ausweglosigkeit abzugleiten, sondern eine ganz erfüllte und glückliche Zeit im afrikanischen Busch zu verbringen. Wie ich ja schon sagte, war es für mich natürlich von vornherein schon einfacher, meine Arbeitszeit sinnvoll zu verbringen. Frauen, Mädchen und Kinder gab es immer und überall auch genügend Probleme, die man auch ohne Geld lösen konnte. Fernerhin waren auch meine Sprachkenntnisse besser, ich war nicht darauf angewiesen, einen Deutschen zu treffen, um mich wieder einmal richtig unterhalten zu können. Das kam mir tatsächlich erst im Gastland so richtig zum Bewußtsein, wie schwer es doch für einen Sprachanfänger ist, Kontakte zu bekommen und wie manch einer einfach dadurch zum Alleinsein verdammt ist. Aber nun will ich noch ein wenig von mir erzählen und wie es mir gelungen ist, nicht in die Ausweglosigkeit abzugleiten, sondern eine ganz erfüllte und glückliche Zeit im afrikanischen Busch zu verbringen. Wie ich ja schon sagte, war es für mich natürlich von vornherein schon einfacher, meine Arbeitszeit sinnvoll zu verbringen. Frauen, Mädchen und Kinder gab es immer und überall auch genügend Probleme, die man auch ohne Geld lösen konnte. Fernerhin waren auch meine Sprachkenntnisse besser, ich war nicht darauf angewiesen, einen Deutschen zu treffen, um mich wieder einmal richtig unterhalten zu können. Das kam mir tatsächlich erst im Gastland so richtig zum Bewußtsein, wie schwer es doch für einen Sprachanfänger ist, Kontakte zu bekommen und wie manch einer einfach dadurch zum Alleinsein verdammt ist.
 Mithin aber ergab sich für mich eine ganz wunderbare Wende in meinem Entwicklungshelferinnen-Dasein. Nachdem ich vier Monate allein als weißes Mädchen mit vier jungen Männern gelebt hatte, kamen zu Ostern zwei französische katholische Schwestern zu uns, die für das Dispensaire zuständig waren. Nicht nur die Tatsache, daß endlich noch zwei Frauen im Dorf waren, sondern vielmehr, daß Schwestern, Menschen, die in der Hingabe an Gott ihren Dienst tun, das ließ mich vom ersten Augenblick an glücklich sein. Als die Schwestern in ihrem kleinen 2CV ins Dorf gefahren kamen, sagte ich gleich zu einem meiner Kameraden, „Du, jetzt wird alles anders”. Er ahnte allerdings nicht viel von dem, was ich da sagen wollte. Und eigentlich wußte ich ja auch noch nicht viel mehr. Aber selbstverständlich war es ja für mich, als bereits „Eingelebte” diesen Neuangekommenen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und so war ich immer häufig auch im Haus der Schwestern. Mithin aber ergab sich für mich eine ganz wunderbare Wende in meinem Entwicklungshelferinnen-Dasein. Nachdem ich vier Monate allein als weißes Mädchen mit vier jungen Männern gelebt hatte, kamen zu Ostern zwei französische katholische Schwestern zu uns, die für das Dispensaire zuständig waren. Nicht nur die Tatsache, daß endlich noch zwei Frauen im Dorf waren, sondern vielmehr, daß Schwestern, Menschen, die in der Hingabe an Gott ihren Dienst tun, das ließ mich vom ersten Augenblick an glücklich sein. Als die Schwestern in ihrem kleinen 2CV ins Dorf gefahren kamen, sagte ich gleich zu einem meiner Kameraden, „Du, jetzt wird alles anders”. Er ahnte allerdings nicht viel von dem, was ich da sagen wollte. Und eigentlich wußte ich ja auch noch nicht viel mehr. Aber selbstverständlich war es ja für mich, als bereits „Eingelebte” diesen Neuangekommenen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und so war ich immer häufig auch im Haus der Schwestern.
 Selbstverständlich war es dann bald, daß ich, wann immer ich konnte, an den Stundengebeten mit dabei war. Als dann unser Pater zurückkehrte aus dem Urlaub, kam die tägliche Messe dazu. Daß allein schon von daher jeder einzelne Tag ein Gepräge erhielt, ist ja selbstverständlich. Dann kam aber noch die neue Arbeit dazu. Als die Schwestern mit der Behandlung der Kranken im Dorf begannen, zeigte es sich, daß ich auch hier mithelfen konnte. Ich tat es gerne, und das enorme Vertrauen und die Ermutigung der Schwestern taten mir eine ganz neue Welt auf. Jetzt erst hatte ich erstmalig das Gefühl von Erfüllung und Befriedigung, ich konnte den Menschen echt helfen und ihnen Erleichterung schaffen. Selbstverständlich war es dann bald, daß ich, wann immer ich konnte, an den Stundengebeten mit dabei war. Als dann unser Pater zurückkehrte aus dem Urlaub, kam die tägliche Messe dazu. Daß allein schon von daher jeder einzelne Tag ein Gepräge erhielt, ist ja selbstverständlich. Dann kam aber noch die neue Arbeit dazu. Als die Schwestern mit der Behandlung der Kranken im Dorf begannen, zeigte es sich, daß ich auch hier mithelfen konnte. Ich tat es gerne, und das enorme Vertrauen und die Ermutigung der Schwestern taten mir eine ganz neue Welt auf. Jetzt erst hatte ich erstmalig das Gefühl von Erfüllung und Befriedigung, ich konnte den Menschen echt helfen und ihnen Erleichterung schaffen.

 Freilich, mit wachsendem Abstand wird mir immer klarer, in wie einfacher, lieber Weise mir die Schwestern die Möglichkeit gegeben haben, diese für mich so fremde Arbeit zu tun und daß dies alles nur möglich war, weil sie mich mittrugen im Gebet in der Verantwortung vor Gott. So durfte ich wirklich spürbar erleben, welche Kraft man aus dem Gebet erhalten kann und wie man ohne dieses Danken und Bitten für keinen der Kranken eine echte Hilfe sein kann. Wir taten, was wir konnten, für jeden einzelnen, der uns vor die Füße gelegt wurde, aber wir taten es in dem Bewußtsein, daß ein anderer als wir das Geschick dieses Kranken in Händen hält, und wenn wir so oft Stunden um einen Kranken gezittert haben, so mußten wir einfach diesen Menschen unserem Herrn Jesus Christus vor die Füße legen und sagen, „mach Du es, Herr, wir sind am Ende”, und nur so war es auch eigentlich möglich, jeden Tag wieder zu beginnen, auch oft nach durchwachter Nacht. Freilich, mit wachsendem Abstand wird mir immer klarer, in wie einfacher, lieber Weise mir die Schwestern die Möglichkeit gegeben haben, diese für mich so fremde Arbeit zu tun und daß dies alles nur möglich war, weil sie mich mittrugen im Gebet in der Verantwortung vor Gott. So durfte ich wirklich spürbar erleben, welche Kraft man aus dem Gebet erhalten kann und wie man ohne dieses Danken und Bitten für keinen der Kranken eine echte Hilfe sein kann. Wir taten, was wir konnten, für jeden einzelnen, der uns vor die Füße gelegt wurde, aber wir taten es in dem Bewußtsein, daß ein anderer als wir das Geschick dieses Kranken in Händen hält, und wenn wir so oft Stunden um einen Kranken gezittert haben, so mußten wir einfach diesen Menschen unserem Herrn Jesus Christus vor die Füße legen und sagen, „mach Du es, Herr, wir sind am Ende”, und nur so war es auch eigentlich möglich, jeden Tag wieder zu beginnen, auch oft nach durchwachter Nacht.
 Es ist schwer, dies alles zu Papier zu bringen, man muß diese Notwendigkeit der Hingabe an Gott eigentlich am eigenen Körper erlebt haben, um zu begreifen, was uns die tägliche Messe und was die Stundengebete bedeutet haben. Ganz einfach gesagt, es waren für uns Grundvoraussetzungen, um existieren zu können in all den Forderungen der Tage. Und wir mußten spüren, was es heißt, ohne das tägliche Mahl des Herrn zu leben, als unser Pater krankheitshalber nach Frankreich zurück mußte. Monate vergingen - ich dachte oft, so muß die Zeit des Volkes Israel in der Wüste gewesen sein -, bis schließlich der Bischof zu uns kam und den Schwestern während einer kleinen Feier mit der Gemeinde die Vollmacht gab, das Abendmahl auszuteilen. Um so schöner wurde aber für uns die Zeit danach. Als Schwestern in Christo gingen wir täglich zum Altar. Wir hörten den Ruf: „Nehmt und esset, nehmt und trinket”, und so wie wir gemeinsam am Tisch des Herrn beieinanderstanden, so arbeiteten wir Seite an Seite im Dispensaire, knieten nebeneinander am Lager eines Kranken, schwiegen mit einem Sterbenden und freuten uns gemeinsam über eine geglückte Behandlung. Wir teilten alles, was wir hatten, Freude und Sorgen - eigentlich unser Leben! Es ist schwer, dies alles zu Papier zu bringen, man muß diese Notwendigkeit der Hingabe an Gott eigentlich am eigenen Körper erlebt haben, um zu begreifen, was uns die tägliche Messe und was die Stundengebete bedeutet haben. Ganz einfach gesagt, es waren für uns Grundvoraussetzungen, um existieren zu können in all den Forderungen der Tage. Und wir mußten spüren, was es heißt, ohne das tägliche Mahl des Herrn zu leben, als unser Pater krankheitshalber nach Frankreich zurück mußte. Monate vergingen - ich dachte oft, so muß die Zeit des Volkes Israel in der Wüste gewesen sein -, bis schließlich der Bischof zu uns kam und den Schwestern während einer kleinen Feier mit der Gemeinde die Vollmacht gab, das Abendmahl auszuteilen. Um so schöner wurde aber für uns die Zeit danach. Als Schwestern in Christo gingen wir täglich zum Altar. Wir hörten den Ruf: „Nehmt und esset, nehmt und trinket”, und so wie wir gemeinsam am Tisch des Herrn beieinanderstanden, so arbeiteten wir Seite an Seite im Dispensaire, knieten nebeneinander am Lager eines Kranken, schwiegen mit einem Sterbenden und freuten uns gemeinsam über eine geglückte Behandlung. Wir teilten alles, was wir hatten, Freude und Sorgen - eigentlich unser Leben!
 So war ich nun zweieinhalb Jahre im deutschen Entwicklungsdienst tätig gewesen, in Wirklichkeit aber lebte ich in der Communauté französischer, katholischer Schwestern. Und wenn ich Ihnen heute ein wenig davon gestanden habe, so habe ich es deshalb getan, weil ich voll Glück, Freude und Dankbarkeit zurückdenke. Glück, weil ich so viel reicher geworden bin an Erfahrung, Freude, weil auch traurige Stunden und Fehlschläge uns nie so tief hätten beugen können, daß nicht die Freude, in Christus zu sein, alles überleuchtet hätte und Dankbarkeit, weil ich Menschen begegnet bin, die mich ohne Vorurteile ganz selbstverständlich in ihre Gemeinschaft aufgenommen haben und in so einfacher Weise Zeugnis von ihrer Hingabe und ihrem Leben in Christus abgelegt haben. Und wenn ich das gerade und ausschließlich Ihnen so offen gesagt habe, so soll damit auch ein Dank an Kirchberg und das Brauchtum der Michaelsbruderschaft und des Berneuchener Dienstes ausgesprochen sein, ohne die es mir vielleicht auch nicht so leicht gefallen wäre, mich ohne innere Hemmungen diesen katholischen Schwestern anzuschließen. Möge mir nun diese heilsame und so erfüllte Zeit meines Lebens auch weiterhin helfen, meinen Lebensweg zu meistern und meinen Aufgaben hier im Lande gerecht zu werden. So war ich nun zweieinhalb Jahre im deutschen Entwicklungsdienst tätig gewesen, in Wirklichkeit aber lebte ich in der Communauté französischer, katholischer Schwestern. Und wenn ich Ihnen heute ein wenig davon gestanden habe, so habe ich es deshalb getan, weil ich voll Glück, Freude und Dankbarkeit zurückdenke. Glück, weil ich so viel reicher geworden bin an Erfahrung, Freude, weil auch traurige Stunden und Fehlschläge uns nie so tief hätten beugen können, daß nicht die Freude, in Christus zu sein, alles überleuchtet hätte und Dankbarkeit, weil ich Menschen begegnet bin, die mich ohne Vorurteile ganz selbstverständlich in ihre Gemeinschaft aufgenommen haben und in so einfacher Weise Zeugnis von ihrer Hingabe und ihrem Leben in Christus abgelegt haben. Und wenn ich das gerade und ausschließlich Ihnen so offen gesagt habe, so soll damit auch ein Dank an Kirchberg und das Brauchtum der Michaelsbruderschaft und des Berneuchener Dienstes ausgesprochen sein, ohne die es mir vielleicht auch nicht so leicht gefallen wäre, mich ohne innere Hemmungen diesen katholischen Schwestern anzuschließen. Möge mir nun diese heilsame und so erfüllte Zeit meines Lebens auch weiterhin helfen, meinen Lebensweg zu meistern und meinen Aufgaben hier im Lande gerecht zu werden.
Quatember 1973, S. 14-18
|