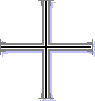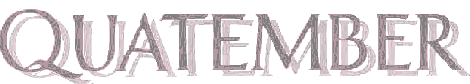Alles Einfache ist nicht leicht zu durchschauen. Matthias Claudius war eine einfache Natur, ein schlichter Mensch von edlem Charakter, ein gläubiger Christ. Er war kein großer, ringender Denker. Doch besaß er eine eigenwüchsige Originalität. So stand er schon zu Lebzeiten außerhalb der Gruppen und Parteiungen, keiner geistigen oder literarischen Richtung ganz verpflichtet. Für ihn charakteristisch ist es auch, daß er das dörfliche kleine Wandsbeck vor den Toren Hamburgs, sein Domizil, seinen Heimatboden, kaum verließ. Von dort aus erreichte er die große Welt, oder sie kam zu ihm. Bei aller persönlichen Bescheidenheit war Claudius ein Herr, ein Mensch von eigenem Wuchs. Das Beispielhafte seiner Person war die ungeteilte Einheit der eigenen Existenz. Hier klaffte nichts auseinander. Er fühlte sich ganz als Gottes Geschöpf. Sein Schreiben und Dichten stand nicht im Gegensatz zu seinem alltäglichen Leben. Was war er beruflich? Familienvater, Journalist, „homme de lettres”, wie er sich selbst bezeichnete, aber kein Literat. Die Literarisierung des Zeitalters, die schon im 18. Jahrhundert begann, erschien ihm als Unheil. Sein eigenes Schreiben, auch Dichten, nahm er nicht allzu wichtig. Alles Einfache ist nicht leicht zu durchschauen. Matthias Claudius war eine einfache Natur, ein schlichter Mensch von edlem Charakter, ein gläubiger Christ. Er war kein großer, ringender Denker. Doch besaß er eine eigenwüchsige Originalität. So stand er schon zu Lebzeiten außerhalb der Gruppen und Parteiungen, keiner geistigen oder literarischen Richtung ganz verpflichtet. Für ihn charakteristisch ist es auch, daß er das dörfliche kleine Wandsbeck vor den Toren Hamburgs, sein Domizil, seinen Heimatboden, kaum verließ. Von dort aus erreichte er die große Welt, oder sie kam zu ihm. Bei aller persönlichen Bescheidenheit war Claudius ein Herr, ein Mensch von eigenem Wuchs. Das Beispielhafte seiner Person war die ungeteilte Einheit der eigenen Existenz. Hier klaffte nichts auseinander. Er fühlte sich ganz als Gottes Geschöpf. Sein Schreiben und Dichten stand nicht im Gegensatz zu seinem alltäglichen Leben. Was war er beruflich? Familienvater, Journalist, „homme de lettres”, wie er sich selbst bezeichnete, aber kein Literat. Die Literarisierung des Zeitalters, die schon im 18. Jahrhundert begann, erschien ihm als Unheil. Sein eigenes Schreiben, auch Dichten, nahm er nicht allzu wichtig.
 Im Kern seiner Existenz wollte er, einfältiglich, nur Christ sein. Damit schränkte er in einer Zeit der Gärung und Revolution, im Herannahen der großen Epoche deutscher Klassik und Romantik seinen Wirkungskreis freilich ein. Man kann Claudius, auch von der Literaturgeschichte her, kaum einordnen. Die seichte Anakreontik der Gleim und Genossen hatte er bald überwunden. Der „göthischen Sekte”, wie er Weimar und den Kreis um Goethe nannte, stand er fremd und ablehnend gegenüber. Er blieb im Zwiespalt, worunter er litt, zumal es der Einfachheit, ja Einfalt seiner Grundnatur widersprach. Im geistigen und religiösen Ringen und Verkünden überflügelten ihn Herder und besonders Hamann, den er sehr verehrte. Die Zeitströmung, bewegt durch das Beben der Französischen Revolution, ging über ihn hinweg. Claudius besaß, um es deutlich zu sagen, kein historisches Bewußtsein, kein tieferes Verständnis für soziale Entwicklungen. Im Alter teilte er nicht den Patriotismus der Jugend, so seines eigenen Sohnes Johannes, und deren Auflehnung gegen Metternich und die politische Reaktion. Doch war ihm jeder reaktionäre Absolutismus zuwider. So blieb er ein Mann am Rand der Zeitereignisse, gebunden in seiner einmaligen Originalität. Blickt man tiefer, so ist auch seine Einfalt und Eigenart nicht leicht zu durchschauen; sie weist Risse und Brüche auf. Im Kern seiner Existenz wollte er, einfältiglich, nur Christ sein. Damit schränkte er in einer Zeit der Gärung und Revolution, im Herannahen der großen Epoche deutscher Klassik und Romantik seinen Wirkungskreis freilich ein. Man kann Claudius, auch von der Literaturgeschichte her, kaum einordnen. Die seichte Anakreontik der Gleim und Genossen hatte er bald überwunden. Der „göthischen Sekte”, wie er Weimar und den Kreis um Goethe nannte, stand er fremd und ablehnend gegenüber. Er blieb im Zwiespalt, worunter er litt, zumal es der Einfachheit, ja Einfalt seiner Grundnatur widersprach. Im geistigen und religiösen Ringen und Verkünden überflügelten ihn Herder und besonders Hamann, den er sehr verehrte. Die Zeitströmung, bewegt durch das Beben der Französischen Revolution, ging über ihn hinweg. Claudius besaß, um es deutlich zu sagen, kein historisches Bewußtsein, kein tieferes Verständnis für soziale Entwicklungen. Im Alter teilte er nicht den Patriotismus der Jugend, so seines eigenen Sohnes Johannes, und deren Auflehnung gegen Metternich und die politische Reaktion. Doch war ihm jeder reaktionäre Absolutismus zuwider. So blieb er ein Mann am Rand der Zeitereignisse, gebunden in seiner einmaligen Originalität. Blickt man tiefer, so ist auch seine Einfalt und Eigenart nicht leicht zu durchschauen; sie weist Risse und Brüche auf.
 Das Bewußtsein der Existenz war für Claudius Kern und Mitte. In dem schönen, gedankenreichen Brief von 1799 an seinen Sohn Johannes heißt es: „Was im Hirn ist, das ist im Hirn; und Existenz ist die erste aller Eigenschaften.” Das Glücksgefühl des eigenen Seins, eben der Existenz, hat er auch im Gedicht ausgesagt, im Lied „Täglich zu singen”, dessen erste Strophe lautet: Das Bewußtsein der Existenz war für Claudius Kern und Mitte. In dem schönen, gedankenreichen Brief von 1799 an seinen Sohn Johannes heißt es: „Was im Hirn ist, das ist im Hirn; und Existenz ist die erste aller Eigenschaften.” Das Glücksgefühl des eigenen Seins, eben der Existenz, hat er auch im Gedicht ausgesagt, im Lied „Täglich zu singen”, dessen erste Strophe lautet:
„Ich danke Gott und freue mich
Wie's Kind zur Weihnachtsgabe,
Daß ich bin, bin! Und daß ich dich,
Schön menschlich Antlitz! habe.”
 Von Stolberg gibt es ein ähnliches Gedicht, „Das Sein” überschrieben. Es beginnt mit den pathetischen Versen: „Ich bin! Es schalle laut in die Höh': Ich bin! / Ich bin! - Es schalle laut in die Tief! - O Sein ...” Claudius dagegen, völlig unkonventionell, mit der Verdoppelung des „Ich bin” gegen das Metrum verstoßend, damit aber von unnachahmbarer Eindringlichkeit, macht keine Worte, sondern bleibt in der Sache, spricht unmittelbar. Er wußte: „Es ist nichts groß, was nicht gut ist.” Leben und Schreiben sind für ihn eins: „Ich mag von keiner Distinktion zwischen Schriftsteller und Menschen Proben ablegen, und meine Schriftstellerei ist Realität bei mir, oder sollt' es wenigstens sein, sonst hols der Teufel.” Es kam ihm „auf eine gewisse Gestalt des inwendigen Menschen” an, „auf eine gewisse innerliche Denkart”. Und wenn er damit auf den christlichen Glauben zielt, der in der „gelehrten Welt ein unbekannt Ding”, so gilt auch hier die Existenz, das reale, konkrete Existieren des Menschen. Einfach und einheitlich verlief auch das Leben des Wandsbecker Boten. Von Stolberg gibt es ein ähnliches Gedicht, „Das Sein” überschrieben. Es beginnt mit den pathetischen Versen: „Ich bin! Es schalle laut in die Höh': Ich bin! / Ich bin! - Es schalle laut in die Tief! - O Sein ...” Claudius dagegen, völlig unkonventionell, mit der Verdoppelung des „Ich bin” gegen das Metrum verstoßend, damit aber von unnachahmbarer Eindringlichkeit, macht keine Worte, sondern bleibt in der Sache, spricht unmittelbar. Er wußte: „Es ist nichts groß, was nicht gut ist.” Leben und Schreiben sind für ihn eins: „Ich mag von keiner Distinktion zwischen Schriftsteller und Menschen Proben ablegen, und meine Schriftstellerei ist Realität bei mir, oder sollt' es wenigstens sein, sonst hols der Teufel.” Es kam ihm „auf eine gewisse Gestalt des inwendigen Menschen” an, „auf eine gewisse innerliche Denkart”. Und wenn er damit auf den christlichen Glauben zielt, der in der „gelehrten Welt ein unbekannt Ding”, so gilt auch hier die Existenz, das reale, konkrete Existieren des Menschen. Einfach und einheitlich verlief auch das Leben des Wandsbecker Boten.

 Nahe bei Lübeck liegt der Flecken Reinfeld, wo Claudius am 15. August 1740 geboren wurde. Die väterlichen Vorfahren waren Pastoren, und so sollte Matthias auch Theologie studieren. Daraus wurde nicht viel. In Göttingen belegte er mehr Kollegs in den Staats- und Cameralwissenschaften, verließ ohne Abschluß die Universität, diente ein Jahr als Sekretär beim Grafen Holstein in Kopenhagen. Es war kein erfreulicher Dienst. Noch ohne Beruf kehrte Claudius für drei Jahre zu den Eltern nach Reinfeld zurück. Dann erhielt er in Hamburg eine Journalisten-Stelle an den dortigen „Adreß-Comptoir-Nachrichten”. Schon diese ersten kleinen Beiträge trugen seinen originalen Stempel: Naiv-volkstümlich, humorvoll, auch zuweilen etwas kauzig. In Hamburg gab es um 1768 ein reges kulturelles Leben. Dort traf Claudius nicht nur Lessing, auch Herder, mit dem er Freundschaft fürs Leben schloß, und Klopstock. 1771 zog er nach Wandsbeck. Hier übernahm er die Redaktion der neuen, eigenen Zeitung „Der Wandsbecker Bote”, ein Blatt, das mit vier Quartseiten, auf schlechtem Papier gedruckt, viermal wöchentlich erschien, und bald berühmt werden sollte. Denn Claudius steuerte nicht nur seine eigenen, oft höchst originellen Beiträge bei, sondern gewann als Mitarbeiter Männer wie Lessing, Klopstock, Gerstenberg, die Hainbündler Voss, Miller, Hölty und sogar Goethe. Nahe bei Lübeck liegt der Flecken Reinfeld, wo Claudius am 15. August 1740 geboren wurde. Die väterlichen Vorfahren waren Pastoren, und so sollte Matthias auch Theologie studieren. Daraus wurde nicht viel. In Göttingen belegte er mehr Kollegs in den Staats- und Cameralwissenschaften, verließ ohne Abschluß die Universität, diente ein Jahr als Sekretär beim Grafen Holstein in Kopenhagen. Es war kein erfreulicher Dienst. Noch ohne Beruf kehrte Claudius für drei Jahre zu den Eltern nach Reinfeld zurück. Dann erhielt er in Hamburg eine Journalisten-Stelle an den dortigen „Adreß-Comptoir-Nachrichten”. Schon diese ersten kleinen Beiträge trugen seinen originalen Stempel: Naiv-volkstümlich, humorvoll, auch zuweilen etwas kauzig. In Hamburg gab es um 1768 ein reges kulturelles Leben. Dort traf Claudius nicht nur Lessing, auch Herder, mit dem er Freundschaft fürs Leben schloß, und Klopstock. 1771 zog er nach Wandsbeck. Hier übernahm er die Redaktion der neuen, eigenen Zeitung „Der Wandsbecker Bote”, ein Blatt, das mit vier Quartseiten, auf schlechtem Papier gedruckt, viermal wöchentlich erschien, und bald berühmt werden sollte. Denn Claudius steuerte nicht nur seine eigenen, oft höchst originellen Beiträge bei, sondern gewann als Mitarbeiter Männer wie Lessing, Klopstock, Gerstenberg, die Hainbündler Voss, Miller, Hölty und sogar Goethe.
 Inzwischen hatte Claudius, sozusagen auf nichts, geheiratet: Rebekka Behn, eines Tischlermeisters Tochter, sein „Bauernmädchen”, die er von Herzen liebte. An Herder schrieb er 1772 über Rebekka: „Meins ist ein ungekünstelt Bauernmädchen im wörtlichen Verstande, aber lieb hab ich sie darum nicht weniger, mir glühn oft die Fußsohlen vor Liebe.” In solchem Prosanachsatz steckt schon der ganze Claudius. Über die Ehe und über Rebekka wäre noch manches zu sagen. Am Tage der silbernen Hochzeit schreibt der Sechzig jährige das schöne Gedicht „An Frau Rebekka”: „Ich habe dich geliebt und will dich lieben, / So lang du goldner Engel bist; / In diesem wüsten Lande hier, und drüben / Im Lande wo es besser ist.” Es ist ein Gedicht, echt wie ein Kinderwort: Der Gatte, der Liebende, der Hausvater, der fromme Christ spricht aus ihm den immer noch ernst-kindlichen Ton. Inzwischen hatte Claudius, sozusagen auf nichts, geheiratet: Rebekka Behn, eines Tischlermeisters Tochter, sein „Bauernmädchen”, die er von Herzen liebte. An Herder schrieb er 1772 über Rebekka: „Meins ist ein ungekünstelt Bauernmädchen im wörtlichen Verstande, aber lieb hab ich sie darum nicht weniger, mir glühn oft die Fußsohlen vor Liebe.” In solchem Prosanachsatz steckt schon der ganze Claudius. Über die Ehe und über Rebekka wäre noch manches zu sagen. Am Tage der silbernen Hochzeit schreibt der Sechzig jährige das schöne Gedicht „An Frau Rebekka”: „Ich habe dich geliebt und will dich lieben, / So lang du goldner Engel bist; / In diesem wüsten Lande hier, und drüben / Im Lande wo es besser ist.” Es ist ein Gedicht, echt wie ein Kinderwort: Der Gatte, der Liebende, der Hausvater, der fromme Christ spricht aus ihm den immer noch ernst-kindlichen Ton.
 Nur einmal mußte Claudius sein geliebtes Wandsbeck verlassen. Es geschah aus finanzieller Not, als 1775 der „Wandsbecker Bote” einging. Die Familie war gewachsen, viele hungrige Münder waren zu stillen. Freund Herder vermittelte ihm in Darmstadt eine gut besoldete Stellung als Oberlandcommissarius und Redakteur der dort privilegierten „Landzeitung”. Schon nach einem Jahr konnte er zurückkehren, ziemlich ungnädig entlassen. Von nun an blieb er daheim, bis ihn 1813 die Franzosen vertrieben. Kiel, Emkendorf, Lübeck waren letzte Stationen. 1814 kehrte er, gesundheitlich geschwächt, nach Wandsbeck zurück. Im Hamburger Haus seiner Tochter Elisabeth und des Schwiegersohns, des Buchhändlers Perthes, stirbt Claudius am 21. Januar 1815. Nur einmal mußte Claudius sein geliebtes Wandsbeck verlassen. Es geschah aus finanzieller Not, als 1775 der „Wandsbecker Bote” einging. Die Familie war gewachsen, viele hungrige Münder waren zu stillen. Freund Herder vermittelte ihm in Darmstadt eine gut besoldete Stellung als Oberlandcommissarius und Redakteur der dort privilegierten „Landzeitung”. Schon nach einem Jahr konnte er zurückkehren, ziemlich ungnädig entlassen. Von nun an blieb er daheim, bis ihn 1813 die Franzosen vertrieben. Kiel, Emkendorf, Lübeck waren letzte Stationen. 1814 kehrte er, gesundheitlich geschwächt, nach Wandsbeck zurück. Im Hamburger Haus seiner Tochter Elisabeth und des Schwiegersohns, des Buchhändlers Perthes, stirbt Claudius am 21. Januar 1815.
 Auf diesem Sterben und Tod lag ein eigentümlicher Schatten. Von Anbeginn war „Freund Hain” sein Weggenosse. Ihm hatte er seine „Sämmtlichen Werke”, betitelt „Asmus omnia secum portans”, gewidmet. Und in seiner Sterbezeit äußerte er: „Mein ganzes Leben hindurch habe ich an diesen Stunden studiert, nun sind sie da, aber noch begreife ich so wenig als in den gesundesten Tagen, auf welchem Wege es zum Ende gehen wird.” Wie uns seine Tochter berichtet, erhoffte Claudius für sein eigenes Sterben ein Zeichen von „oben”, eine Bestätigung oder Erhellung. Aber nichts geschah. Er starb still und, vielleicht - wir wissen es nicht - etwas enttäuscht. Auf diesem Sterben und Tod lag ein eigentümlicher Schatten. Von Anbeginn war „Freund Hain” sein Weggenosse. Ihm hatte er seine „Sämmtlichen Werke”, betitelt „Asmus omnia secum portans”, gewidmet. Und in seiner Sterbezeit äußerte er: „Mein ganzes Leben hindurch habe ich an diesen Stunden studiert, nun sind sie da, aber noch begreife ich so wenig als in den gesundesten Tagen, auf welchem Wege es zum Ende gehen wird.” Wie uns seine Tochter berichtet, erhoffte Claudius für sein eigenes Sterben ein Zeichen von „oben”, eine Bestätigung oder Erhellung. Aber nichts geschah. Er starb still und, vielleicht - wir wissen es nicht - etwas enttäuscht.

 Früh trat der Tod in sein Leben. Noch in Göttingen hatte er den Lieblingsbruder Josias verloren. Vier Jahre später, 1766, erlebt er in Reinfeld bei den Eltern den Tod seiner einzigen, noch lebenden Schwester Dorothea Christine, Pfarrfrau und Mutter von vier kleinen Kindern, eben erst 22 Jahre alt. Der sechsundzwanzigjährige Bruder schrieb das Gedicht „An - als ihm die - starb”, das erste große Todesgedicht, jenseits des Zeitgeschmacks: Früh trat der Tod in sein Leben. Noch in Göttingen hatte er den Lieblingsbruder Josias verloren. Vier Jahre später, 1766, erlebt er in Reinfeld bei den Eltern den Tod seiner einzigen, noch lebenden Schwester Dorothea Christine, Pfarrfrau und Mutter von vier kleinen Kindern, eben erst 22 Jahre alt. Der sechsundzwanzigjährige Bruder schrieb das Gedicht „An - als ihm die - starb”, das erste große Todesgedicht, jenseits des Zeitgeschmacks:
„Der Säemann säet den Samen,
 Die Erd' empfängt ihn, und über ein kleines Die Erd' empfängt ihn, und über ein kleines
 Keimet die Blume herauf - Keimet die Blume herauf -
Du liebtest sie. Was auch dies Leben
 Sonst für Gewinn hat, war klein Dir geachtet, Sonst für Gewinn hat, war klein Dir geachtet,
 Und sie entschlummerte Dir! Und sie entschlummerte Dir!
Was weinest Du neben dem Grabe,
 Und hebst die Hände zur Wolke des Todes Und hebst die Hände zur Wolke des Todes
 Und der Verwesung empor? Und der Verwesung empor?
Wie Gras auf dem Felde sind Menschen
 Dahin, wie Blätter! Nur wenige Tage Dahin, wie Blätter! Nur wenige Tage
 Gehn wir verkleidet einher! Gehn wir verkleidet einher!
Der Adler besuchet die Erde,
 Doch säumt nicht, schüttelt vom Flügel den Staub, und Doch säumt nicht, schüttelt vom Flügel den Staub, und
 Kehret zur Sonne zurück!” Kehret zur Sonne zurück!”
 Für immer hatte Claudius den nur ihm eigenen Ton gefunden: Biblisch-ernst, verhalten, von unnachahmlicher Schlichtheit und Größe. Und der Tod, das Grab, das Sterben, ja die Verwesung sollten Thema bleiben für weitere Gedichte, die Freund Hain „als Schutzheiliger und Hausgott” ihm gleichsam diktierte. Es waren auch nicht wenige Todesfälle, die unseren Wandsbecker erschütterten. 1760 starb der Bruder Josias, 1766 die Schwester Dorothea Christine, 1773 der Vater. Ihm gilt wieder ein in der Schlichtheit bewegendes Gedicht mit den Schlußversen: „-ach, sie haben / Einen guten Mann begraben, / Und mir war er mehr”. 1780 stirbt die Mutter. Über ihr Sterben hat Claudius einen eigentümlichen und bemerkenswerten Brief geschrieben. Als er an ihrem Sterbebett steht, sie so hilflos und schwach daliegen sieht, durchziehen sein Herz allerlei abwegige Gedanken: - „und wollte ihr noch so gern was zu Liebe thun; aber essen und trinken mochte sie nicht mehr, mochte auch sonst nichts mehr”. Und mit Grauen erkennt er: „- sie lag out of reach! lag am Abhang und sollte herunter! und ich konnte nicht einmal sehen, wo sie hinfiel”. Er wendet sich ab, schreibt noch ein Sterbegebet, das man ihr vorlesen soll. Für immer hatte Claudius den nur ihm eigenen Ton gefunden: Biblisch-ernst, verhalten, von unnachahmlicher Schlichtheit und Größe. Und der Tod, das Grab, das Sterben, ja die Verwesung sollten Thema bleiben für weitere Gedichte, die Freund Hain „als Schutzheiliger und Hausgott” ihm gleichsam diktierte. Es waren auch nicht wenige Todesfälle, die unseren Wandsbecker erschütterten. 1760 starb der Bruder Josias, 1766 die Schwester Dorothea Christine, 1773 der Vater. Ihm gilt wieder ein in der Schlichtheit bewegendes Gedicht mit den Schlußversen: „-ach, sie haben / Einen guten Mann begraben, / Und mir war er mehr”. 1780 stirbt die Mutter. Über ihr Sterben hat Claudius einen eigentümlichen und bemerkenswerten Brief geschrieben. Als er an ihrem Sterbebett steht, sie so hilflos und schwach daliegen sieht, durchziehen sein Herz allerlei abwegige Gedanken: - „und wollte ihr noch so gern was zu Liebe thun; aber essen und trinken mochte sie nicht mehr, mochte auch sonst nichts mehr”. Und mit Grauen erkennt er: „- sie lag out of reach! lag am Abhang und sollte herunter! und ich konnte nicht einmal sehen, wo sie hinfiel”. Er wendet sich ab, schreibt noch ein Sterbegebet, das man ihr vorlesen soll.
 Die tiefste Todes-Erschütterung erfuhr Claudius, als ihm 1796 die kaum zwanzigjährige und besonders geliebte Tochter Christiane stirbt. Ihr gilt das auch „Christiane” überschriebene Gedicht „Es stand ein Sternlein am Himmel” mit der traurigen Schlußstrophe: „Das Sternlein ist verschwunden; / Ich suche hin und her, / Wo ich es sonst gefunden, / Und find es nun nicht mehr.” Diesem Gedicht aber folgt unmittelbar jener „Der Tod” benannte Vierzeiler, ein Gedicht, das an dichterischer Tiefe und schwermütiger Trauer nicht seinesgleichen hat: Die tiefste Todes-Erschütterung erfuhr Claudius, als ihm 1796 die kaum zwanzigjährige und besonders geliebte Tochter Christiane stirbt. Ihr gilt das auch „Christiane” überschriebene Gedicht „Es stand ein Sternlein am Himmel” mit der traurigen Schlußstrophe: „Das Sternlein ist verschwunden; / Ich suche hin und her, / Wo ich es sonst gefunden, / Und find es nun nicht mehr.” Diesem Gedicht aber folgt unmittelbar jener „Der Tod” benannte Vierzeiler, ein Gedicht, das an dichterischer Tiefe und schwermütiger Trauer nicht seinesgleichen hat:
„Ach, es ist so dunkel in des Todes Kammer,
 Tönt so traurig, wenn er sich bewegt, Tönt so traurig, wenn er sich bewegt,
Und nun aufhebt seinen schweren Hammer,
 Und die Stunde schlägt.” Und die Stunde schlägt.”
 Dem Schlagen des schweren Hammers, dem Abschied, dem Hinabsenken der Leiche ins Grab, dem Verwesen, dem Nicht-Wiederkommen hat Claudius immer wieder nachgesonnen. In dem schmalen Gesamtumfang seiner Lyrik zählen wir allein 23 Gedichte, die sich inhaltlich um das Motiv des Todes, des Sterbens, des Grabes, auch der Verwesung, und der Auferstehung bewegen. Schon in dem frühen Abschnitt „Was ich wohl mag” stehen die eigentümlichen Sätze: „Es ist ein rührender heiliger schöner Anblick, einer Leiche ins Gesicht zu sehen; aber sie muß ohne Flitterstaat sein. Die stille blasse Todesgestalt ist ihr Schmuck, und die Spuren der Verwesung ihr Halsgeschmeide und das erste Hahnengeschrei zur Auferstehung.” Neben dem Grab stehend hebt er die „Hände zur Wolke des Todes und der Verwesung empor”. Und dies muß ihn besonders erschüttert haben, daß der Tod den geliebten Menschen für immer fortnimmt. In dem Gedicht „Der Mensch” heißt es zum Schluß: „Denn legt er sich zu seinen Vätern nieder, / Und er kömmt nimmer wieder.” Dem Schlagen des schweren Hammers, dem Abschied, dem Hinabsenken der Leiche ins Grab, dem Verwesen, dem Nicht-Wiederkommen hat Claudius immer wieder nachgesonnen. In dem schmalen Gesamtumfang seiner Lyrik zählen wir allein 23 Gedichte, die sich inhaltlich um das Motiv des Todes, des Sterbens, des Grabes, auch der Verwesung, und der Auferstehung bewegen. Schon in dem frühen Abschnitt „Was ich wohl mag” stehen die eigentümlichen Sätze: „Es ist ein rührender heiliger schöner Anblick, einer Leiche ins Gesicht zu sehen; aber sie muß ohne Flitterstaat sein. Die stille blasse Todesgestalt ist ihr Schmuck, und die Spuren der Verwesung ihr Halsgeschmeide und das erste Hahnengeschrei zur Auferstehung.” Neben dem Grab stehend hebt er die „Hände zur Wolke des Todes und der Verwesung empor”. Und dies muß ihn besonders erschüttert haben, daß der Tod den geliebten Menschen für immer fortnimmt. In dem Gedicht „Der Mensch” heißt es zum Schluß: „Denn legt er sich zu seinen Vätern nieder, / Und er kömmt nimmer wieder.”
 In den Gedenkversen an S. (seinen Jugendfreund Schönborn) lesen wir: „Auch ihn haben sie bei den andern begraben, / Und er kömmt nun nicht wieder zu uns! / Liegt nun im Grab' und verweset!” Und klagend fährt der Dichter fort: „Und kömmt nicht wieder zu uns! / Und so werden sie alle begraben werden, / Und verwesen im Grab zu Staub!” Zu dem Sprichwort „Man soll auf einem Grabe nicht schlafen!” (seltsam genug, daß Claudius ein solches, wenig bekanntes Sprichwort heranzieht) bemerkt er: „Die Verwesung ist und bleibt eine sehr nachdenkliche und ernsthafte Sache. Gewißlich geht kein Engel gleichgültig einen Grabhügel vorbei! und der ist doch eigentlich über die Grabhügel weg - ... Der Mensch ist noch nicht so ganz darüber weg ...” Das Wankende, Schwankende, das Vergängliche alles Lebens „hier unterm Mond” hat ihn erschreckt: „Ein brütend Saatfeld für den Tag der Garben; / Da wanket alles immerdar, / Und wandelt sich, und spielt mit Farben, / Mit Wasserblasen wunderbar.” Darum aber ist ihm der Glaube an die Auferstehung so ernst und wichtig. Und vielleicht am schönsten ist es, wenn er diesen Glauben nicht so unmittelbar ausspricht, wie in dem wenig bekannten Gedicht „An die Frau B... r”: In den Gedenkversen an S. (seinen Jugendfreund Schönborn) lesen wir: „Auch ihn haben sie bei den andern begraben, / Und er kömmt nun nicht wieder zu uns! / Liegt nun im Grab' und verweset!” Und klagend fährt der Dichter fort: „Und kömmt nicht wieder zu uns! / Und so werden sie alle begraben werden, / Und verwesen im Grab zu Staub!” Zu dem Sprichwort „Man soll auf einem Grabe nicht schlafen!” (seltsam genug, daß Claudius ein solches, wenig bekanntes Sprichwort heranzieht) bemerkt er: „Die Verwesung ist und bleibt eine sehr nachdenkliche und ernsthafte Sache. Gewißlich geht kein Engel gleichgültig einen Grabhügel vorbei! und der ist doch eigentlich über die Grabhügel weg - ... Der Mensch ist noch nicht so ganz darüber weg ...” Das Wankende, Schwankende, das Vergängliche alles Lebens „hier unterm Mond” hat ihn erschreckt: „Ein brütend Saatfeld für den Tag der Garben; / Da wanket alles immerdar, / Und wandelt sich, und spielt mit Farben, / Mit Wasserblasen wunderbar.” Darum aber ist ihm der Glaube an die Auferstehung so ernst und wichtig. Und vielleicht am schönsten ist es, wenn er diesen Glauben nicht so unmittelbar ausspricht, wie in dem wenig bekannten Gedicht „An die Frau B... r”:
„Daß du so gut gestorben bist,
Und all' dein Leid und alle deine Plagen
Bis in den Tod, wie's Gottes Wille ist,
Mit stillem Mut und mit Geduld getragen;
Daß du - O zürne nicht im Himmel, wo du bist!
Ich will nicht loben und nicht klagen;
Ich wollt' es bloß an deinem Grabe sagen,
Weil es die reine Wahrheit ist.”
 Johannes Pfeiffer bemerkt zu den Versen: „Ein einziger prosa-naher Satz . . . Bis in den Reim läßt das Unansehnliche der Gestaltung sich nachweisen ... Es ist die unsagbar zarte, demütig herabmindernde Ausdrucksweise eines Menschen, der weniger scheinen möchte, als er der verborgenen Innerlichkeit nach ist.” Christlicher Glaube und Sprache sind hier eine unauflösbare Einheit eingegangen. Johannes Pfeiffer bemerkt zu den Versen: „Ein einziger prosa-naher Satz . . . Bis in den Reim läßt das Unansehnliche der Gestaltung sich nachweisen ... Es ist die unsagbar zarte, demütig herabmindernde Ausdrucksweise eines Menschen, der weniger scheinen möchte, als er der verborgenen Innerlichkeit nach ist.” Christlicher Glaube und Sprache sind hier eine unauflösbare Einheit eingegangen.
 Claudius war kein Dichter der Reflexion. Vieles strömte ihm so zu, darunter auch manch harmlos-plauderndes Gedicht. Als schlichter Familienvater stand er ganz auch im Alltag, feierte gern mit den Seinen. Und auch die kleinen Ereignisse, die Geburt eines Kindes, oder die Mutter mit dem Kleinen an der Brust, der erste Zahn, oder draußen im Winter die bereiften Bäume und Äste: Alles konnte auf kindlich-fröhliche Weise besungen werden. Wir spüren, wie spontan, aus innerstem Antrieb sich das vollzog. Um die Form hat er nicht lange ringen müssen. Daß er aber etwas vom Kunst-Handwerk verstand, zeigen seine reizenden „Übungen im Stil”, in denen der Wandsbecker auf seine Weise die französische Moderne vorwegnimmt, Autoren wie Queneau oder Sarraute. Da gibt es den naiven, den verhaltenen, den bedenklichen, den planen Stil, und neben dem Kinder-Stil zeigt er uns, launig-parodierend, den galanten, den nachbarlichen, den pikanten, den freundlichen, ja auch den konfusen Stil. Mitten in diesem Allotria stehen dann auf einmal Verse und Gedichte von großer Schönheit, von genialer Einfachheit. Claudius war kein Dichter der Reflexion. Vieles strömte ihm so zu, darunter auch manch harmlos-plauderndes Gedicht. Als schlichter Familienvater stand er ganz auch im Alltag, feierte gern mit den Seinen. Und auch die kleinen Ereignisse, die Geburt eines Kindes, oder die Mutter mit dem Kleinen an der Brust, der erste Zahn, oder draußen im Winter die bereiften Bäume und Äste: Alles konnte auf kindlich-fröhliche Weise besungen werden. Wir spüren, wie spontan, aus innerstem Antrieb sich das vollzog. Um die Form hat er nicht lange ringen müssen. Daß er aber etwas vom Kunst-Handwerk verstand, zeigen seine reizenden „Übungen im Stil”, in denen der Wandsbecker auf seine Weise die französische Moderne vorwegnimmt, Autoren wie Queneau oder Sarraute. Da gibt es den naiven, den verhaltenen, den bedenklichen, den planen Stil, und neben dem Kinder-Stil zeigt er uns, launig-parodierend, den galanten, den nachbarlichen, den pikanten, den freundlichen, ja auch den konfusen Stil. Mitten in diesem Allotria stehen dann auf einmal Verse und Gedichte von großer Schönheit, von genialer Einfachheit.
 Berühmt ist sein „Abendlied”. Schon die erste Strophe: „Der Mond ist aufgegangen . . .” ruft auf wunderbare Weise die Abend-Landschaft herbei. Kindlich-tiefe Lebensweisheit spricht aus den Versen: „Seht ihr den Mond dort stehen?- / Er ist nur halb zu sehen, / Und ist doch rund und schön!” Ein Naturbild wird zum Gleichnis. Das Andere, Nicht-Sichtbare, das Eigentliche, wir nennen es das Transzendente, die „Spuren der Engel”, leuchtet auf. Wir schauen auf einmal im noch Unvollendeten das Ganze, das Vollendete. Hier wie in anderen Gedichten läßt der Dichter alles Konventionelle, aber auch bloß Artifizielle weit hinter sich. So kann er sein Gedicht an den Frühling - „Am ersten Maimorgen” - mit dem Ausruf beginnen: „Heute will ich fröhlich sein, / Keine Weis' und Sitte hören; / Will mich wälzen, und für Freude Schrein, / Und der König soll mir das nicht wehren!” Und wenn er dann den Frühling selbst beschreibt, wie er aus der „Morgenröte Hallen” hervortritt: „Einen Blumenkranz um Brust und Haar / Und auf seiner Schulter Nachtigallen”, endet sein Gedicht wie ein ländlicher Hymnus, in überraschend schöner Bildsprache: Berühmt ist sein „Abendlied”. Schon die erste Strophe: „Der Mond ist aufgegangen . . .” ruft auf wunderbare Weise die Abend-Landschaft herbei. Kindlich-tiefe Lebensweisheit spricht aus den Versen: „Seht ihr den Mond dort stehen?- / Er ist nur halb zu sehen, / Und ist doch rund und schön!” Ein Naturbild wird zum Gleichnis. Das Andere, Nicht-Sichtbare, das Eigentliche, wir nennen es das Transzendente, die „Spuren der Engel”, leuchtet auf. Wir schauen auf einmal im noch Unvollendeten das Ganze, das Vollendete. Hier wie in anderen Gedichten läßt der Dichter alles Konventionelle, aber auch bloß Artifizielle weit hinter sich. So kann er sein Gedicht an den Frühling - „Am ersten Maimorgen” - mit dem Ausruf beginnen: „Heute will ich fröhlich sein, / Keine Weis' und Sitte hören; / Will mich wälzen, und für Freude Schrein, / Und der König soll mir das nicht wehren!” Und wenn er dann den Frühling selbst beschreibt, wie er aus der „Morgenröte Hallen” hervortritt: „Einen Blumenkranz um Brust und Haar / Und auf seiner Schulter Nachtigallen”, endet sein Gedicht wie ein ländlicher Hymnus, in überraschend schöner Bildsprache:
„Und sein Antlitz ist ihm rot und weiß,
Und er träuft von Tau und Duft und Segen -
Ha! mein Tyrsus sei ein Knospenreis,
Und so tauml' ich meinem Freund entgegen.”
 Viele solcher schönen, in sich starken und ausgeglichenen Gedichte enden mit einer lakonisch-stillen Schlußzeile. So wenn er dem Wanderer zuruft, am Grabe stehen zu bleiben, eine stille Träne zu weinen: „Und denn kannst du weitergehen.” Vom gestorbenen Vater hieß es, er war ein guter Mann: „Und mir war er mehr.” Das erschütternde „Kriegslied”, das Karl Kraus im Ersten Weltkrieg für uns entdeckte, ist ganz auf solchen knappen, eindringlichen und als Refrain wiederholten Versen aufgebaut: Viele solcher schönen, in sich starken und ausgeglichenen Gedichte enden mit einer lakonisch-stillen Schlußzeile. So wenn er dem Wanderer zuruft, am Grabe stehen zu bleiben, eine stille Träne zu weinen: „Und denn kannst du weitergehen.” Vom gestorbenen Vater hieß es, er war ein guter Mann: „Und mir war er mehr.” Das erschütternde „Kriegslied”, das Karl Kraus im Ersten Weltkrieg für uns entdeckte, ist ganz auf solchen knappen, eindringlichen und als Refrain wiederholten Versen aufgebaut:
„'s ist Krieg! 's ist Krieg! O Gottes Engel wehre,
 Und rede da darein! Und rede da darein!
's ist leider Krieg - und ich begehre
 Nicht schuld daran zu sein!” Nicht schuld daran zu sein!”
 Das von Schubert vertonte Gedicht „Der Tod und das Mädchen” gehört mit seinen nur acht Zeilen zu den Wundern deutscher Dichtung. Mit Recht wurde gesagt und gefragt, wo jemals das Todesgrauen eines jungen Bluts und das tröstliche Hinübergleiten in erlösenden Schlaf so Sprache geworden sei, wie in diesem Gedicht. Man könnte von natur- und menschennaher Urpoesie sprechen. Alle Vergleiche scheitern hier. Herder hatte schon zu Beginn ihrer Freundschaft Claudius ein Genie genannt; er sei „ein Freund von sonderbarem Geiste und von einem Herzen, das wie Steinkohle glüht - still, stark und dampfigt”. Besonders die kurzen Gedichte besitzen in ihrem spruchartigen Charakter eine beispiellose Ausdruckskraft. Ob es der dem Gedicht „Der Tod” folgende Vierzeiler „Die Liebe” ist: „Die Liebe hemmet nichts, sie kennt nicht Tür noch Riegel, / Und dringt durch alles sich; / Sie ist ohn Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel, / Und schlägt sie ewiglich.”, oder das „Motet”: Das von Schubert vertonte Gedicht „Der Tod und das Mädchen” gehört mit seinen nur acht Zeilen zu den Wundern deutscher Dichtung. Mit Recht wurde gesagt und gefragt, wo jemals das Todesgrauen eines jungen Bluts und das tröstliche Hinübergleiten in erlösenden Schlaf so Sprache geworden sei, wie in diesem Gedicht. Man könnte von natur- und menschennaher Urpoesie sprechen. Alle Vergleiche scheitern hier. Herder hatte schon zu Beginn ihrer Freundschaft Claudius ein Genie genannt; er sei „ein Freund von sonderbarem Geiste und von einem Herzen, das wie Steinkohle glüht - still, stark und dampfigt”. Besonders die kurzen Gedichte besitzen in ihrem spruchartigen Charakter eine beispiellose Ausdruckskraft. Ob es der dem Gedicht „Der Tod” folgende Vierzeiler „Die Liebe” ist: „Die Liebe hemmet nichts, sie kennt nicht Tür noch Riegel, / Und dringt durch alles sich; / Sie ist ohn Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel, / Und schlägt sie ewiglich.”, oder das „Motet”:
„Der Mensch lebt und bestehet
 Nur eine kleine Zeit; Nur eine kleine Zeit;
Und alle Welt vergehet
 Mit ihrer Herrlichkeit. Mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur Einer ewig und an allen Enden,
 Und wir in seinen Händen.” Und wir in seinen Händen.”
 Als der „Wandsbecker Bote” sein Erscheinen einstellte, unternahm Claudius die Herausgabe seiner eigenen Beiträge. Die Subscriptions-Anzeige vom 1774 war unterschrieben mit „Asmus, pro tempore. Bote in Wandsbeck”. So entstand bis 1812 mit dem achten Teil, ein kunterbuntes Gesamtopus aus Gedichten verschiedenster Art, aus Prosastücken, Dialogen, Abhandlungen, fingierten Briefen an Andres, an den Vetter, auch an sich selbst (aber Asmus alias Matthias wie Andres und der Vetter waren dieselbe Person), aus Rezensionen, darunter bemerkenswerte, so über den „Werther”, Lessings „Emilia Galotti”, Hamanns „Socratische Denkwürdigkeiten”, Herders „Älteste Urkunde des Menschengeschlechts”, auch über Klopstocks „Oden” und - humorvoll - über Lavaters „Physiognomische Fragmente”. Er nannte sein „Büchel” auch „Schnurrpfeifereien”. In den späteren Jahren überwiegen die ernsten religiösen Abhandlungen. Dies alles aber in regelloser Folge, das Heitere unmittelbar neben dem Ernsten, Schnurren neben Gedichten von ergreifender Schönheit. In dieser Unordnung steckt heimliches System: Spiegelung der Welt mit ihren mancherlei Sachen, „die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehn”. Als der „Wandsbecker Bote” sein Erscheinen einstellte, unternahm Claudius die Herausgabe seiner eigenen Beiträge. Die Subscriptions-Anzeige vom 1774 war unterschrieben mit „Asmus, pro tempore. Bote in Wandsbeck”. So entstand bis 1812 mit dem achten Teil, ein kunterbuntes Gesamtopus aus Gedichten verschiedenster Art, aus Prosastücken, Dialogen, Abhandlungen, fingierten Briefen an Andres, an den Vetter, auch an sich selbst (aber Asmus alias Matthias wie Andres und der Vetter waren dieselbe Person), aus Rezensionen, darunter bemerkenswerte, so über den „Werther”, Lessings „Emilia Galotti”, Hamanns „Socratische Denkwürdigkeiten”, Herders „Älteste Urkunde des Menschengeschlechts”, auch über Klopstocks „Oden” und - humorvoll - über Lavaters „Physiognomische Fragmente”. Er nannte sein „Büchel” auch „Schnurrpfeifereien”. In den späteren Jahren überwiegen die ernsten religiösen Abhandlungen. Dies alles aber in regelloser Folge, das Heitere unmittelbar neben dem Ernsten, Schnurren neben Gedichten von ergreifender Schönheit. In dieser Unordnung steckt heimliches System: Spiegelung der Welt mit ihren mancherlei Sachen, „die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehn”.

 Innerhalb des kunterbunten Ganzen finden wir auch bemerkenswerte Betrachtungen zur Zeit, zum Politischen. Auch hier oder gerade hier zeigt sich, daß auch ein einfacher und schlichter Charakter seine Besonderheiten haben kann. Claudius war kein Reaktionär, wenn er auch, Kind seiner Zeit, den Sitten und Meinungen der Väter anhing. Er war auch kein Revolutionär. Die blutigen Greuel der Französischen Revolution verabscheute er: „Sie mordeten den König, ihren Herrn, / Sie morden sich einander, morden gern, / Und tanzen um das Blutgerüste.” Aber das ist nur die eine Seite. Claudius besaß ein ausgeprägtes Gefühl für Recht und Gerechtigkeit. Er scheute sich nicht, den Mächtigen dieser Welt den Spiegel vorzuhalten. Sein soziales Mitleid ist anfangs mehr von der modisch gewordenen Philanthropie bestimmt, wenn er z. B. den „Schwarzen in der Zuckerplantage” sprechen und klagen läßt: „Ohhh die weißen Männer! klug und schön! / Und ich hab den Männern ohn' Erbarmen / Nichts getan. / Du im Himmel! hilf mir armen / Schwarzen Mann!” Aber schärfer werden schon die Töne in seinen „Görgeliana”, den Episteln und Versen „des alten lahmen Invaliden Görgel”. So stand, gewiß nicht zur Freude des Darmstädter Landesherrn und des Ministers Moser, jene Bauernklage in der „Landzeitung”, die zur Hebung des Bauernstandes beitragen sollte. Da heißt es von den verarmten Landbewohnern: „Gehn viele da gebückt und welken / In Elend und in Müh', / Und andre zerren dran und melken, / Wie an dem lieben Vieh. / Und ist das nicht zu defendieren, / Und gar ein böser Brauch; / Die Bauern gehn doch nicht auf Vieren, / Es sind doch Menschen auch.” Bitter-ernst dünkt uns noch heute, und so war er damals auch gedacht, der Brief vom „parforcegejagten Hirsch an den brutalen Jäger”. Solche soziale Kritik war unkonventionell, aber eindrucksvoll in ihrer schlichten Menschlichkeit. Innerhalb des kunterbunten Ganzen finden wir auch bemerkenswerte Betrachtungen zur Zeit, zum Politischen. Auch hier oder gerade hier zeigt sich, daß auch ein einfacher und schlichter Charakter seine Besonderheiten haben kann. Claudius war kein Reaktionär, wenn er auch, Kind seiner Zeit, den Sitten und Meinungen der Väter anhing. Er war auch kein Revolutionär. Die blutigen Greuel der Französischen Revolution verabscheute er: „Sie mordeten den König, ihren Herrn, / Sie morden sich einander, morden gern, / Und tanzen um das Blutgerüste.” Aber das ist nur die eine Seite. Claudius besaß ein ausgeprägtes Gefühl für Recht und Gerechtigkeit. Er scheute sich nicht, den Mächtigen dieser Welt den Spiegel vorzuhalten. Sein soziales Mitleid ist anfangs mehr von der modisch gewordenen Philanthropie bestimmt, wenn er z. B. den „Schwarzen in der Zuckerplantage” sprechen und klagen läßt: „Ohhh die weißen Männer! klug und schön! / Und ich hab den Männern ohn' Erbarmen / Nichts getan. / Du im Himmel! hilf mir armen / Schwarzen Mann!” Aber schärfer werden schon die Töne in seinen „Görgeliana”, den Episteln und Versen „des alten lahmen Invaliden Görgel”. So stand, gewiß nicht zur Freude des Darmstädter Landesherrn und des Ministers Moser, jene Bauernklage in der „Landzeitung”, die zur Hebung des Bauernstandes beitragen sollte. Da heißt es von den verarmten Landbewohnern: „Gehn viele da gebückt und welken / In Elend und in Müh', / Und andre zerren dran und melken, / Wie an dem lieben Vieh. / Und ist das nicht zu defendieren, / Und gar ein böser Brauch; / Die Bauern gehn doch nicht auf Vieren, / Es sind doch Menschen auch.” Bitter-ernst dünkt uns noch heute, und so war er damals auch gedacht, der Brief vom „parforcegejagten Hirsch an den brutalen Jäger”. Solche soziale Kritik war unkonventionell, aber eindrucksvoll in ihrer schlichten Menschlichkeit.
 So verabscheute Claudius allen Streit, blieb dem Zank und Hader auch unter ihm Nahestanden fern, hielt dem zum katholischen Glauben übergetretenen Stolberg, der nicht nur von Voss mit fast teuflischem Haß verfolgt wurde, die Freundestreue. Und immer wieder rief er auf gegen Krieg und das Völker-Morden, stand er auf der Seite des Friedens. Die launig-ernste „Nachricht von meiner Audienz beim Kaiser von Japan” schließt mit den Abschiedsworten, die Asmus dem „Chan” sagt: „Ich habe noch Eins auf dem Herzen, Sire. Wir haben in Nagasaki so viele Soldaten und Canonen gesehn: wenn Du irgend umhin kannst, lieber guter Fürst, so führe nicht Krieg. Menschenblut schreiet zu Gott, und ein Eroberer hat keine Ruhe.” Am schönsten, gedrängtesten hat Claudius seine Friedensliebe in dem Gedicht „Auf den Tod der Kaiserin” ausgesprochen: So verabscheute Claudius allen Streit, blieb dem Zank und Hader auch unter ihm Nahestanden fern, hielt dem zum katholischen Glauben übergetretenen Stolberg, der nicht nur von Voss mit fast teuflischem Haß verfolgt wurde, die Freundestreue. Und immer wieder rief er auf gegen Krieg und das Völker-Morden, stand er auf der Seite des Friedens. Die launig-ernste „Nachricht von meiner Audienz beim Kaiser von Japan” schließt mit den Abschiedsworten, die Asmus dem „Chan” sagt: „Ich habe noch Eins auf dem Herzen, Sire. Wir haben in Nagasaki so viele Soldaten und Canonen gesehn: wenn Du irgend umhin kannst, lieber guter Fürst, so führe nicht Krieg. Menschenblut schreiet zu Gott, und ein Eroberer hat keine Ruhe.” Am schönsten, gedrängtesten hat Claudius seine Friedensliebe in dem Gedicht „Auf den Tod der Kaiserin” ausgesprochen:
„Sie machte Frieden! Das ist mein Gedicht.
War ihres Volkes Lust und ihres Volkes Segen.
Und ging getrost und voller Zuversicht
Dem Tod als ihrem Freund entgegen.
Ein Welt-Eroberer kann das nicht.
Sie machte Frieden! Das ist mein Gedicht.”
 Bemerkenswert sind im Fünften Teil der „Werke” (1789) die „Gespräche, die Freiheit betreffend”, Gespräche zwischen A. und B., welch letzterer ein Freiheitsfreund genannt wird. Das Gespräch hat seine Tiefen und Untiefen, das Gleichnis vom verlorenen, ungeratenen Sohn wird herangezogen. B. antwortet: „Ich bin doch nicht gefragt, ob ich, noch auf welche Art ich existieren wollte. Wie mich die Welle des Unendlichen ans Ufer herangeworfen hat, so habe ich heran müssen, um mich da eine Zeitlang herumzutreiben.” Und A., der mehr nüchtern Verhaltene, schließt das Gespräch mit den Worten: „Lieber B., die Menschen tragen Ketten, und sind Sclaven; aber sie sind nicht geboren, es zu sein, und haben die Hoffnung nicht verloren, wieder frei zu werden. Und, wenn schon auf die Unterdrückung einer Anhänglichkeit ein so wohltuendes Bewußtsein folgt; was meinst du, was der Friede sein müsse, von dem man in jenem Bewußtsein nur den ersten Anbiß hat, wenn nämlich nicht mehr von Unterdrücken die Rede ist, sondern wenn die Ketten wirklich abgenommen werden! - Und da kommt das rechte England zum Vorschein, und die rechte St. Paulskirche. - Aber lebe wohl, wir kommen hier auf heiligen Grund und Boden.” Bemerkenswert sind im Fünften Teil der „Werke” (1789) die „Gespräche, die Freiheit betreffend”, Gespräche zwischen A. und B., welch letzterer ein Freiheitsfreund genannt wird. Das Gespräch hat seine Tiefen und Untiefen, das Gleichnis vom verlorenen, ungeratenen Sohn wird herangezogen. B. antwortet: „Ich bin doch nicht gefragt, ob ich, noch auf welche Art ich existieren wollte. Wie mich die Welle des Unendlichen ans Ufer herangeworfen hat, so habe ich heran müssen, um mich da eine Zeitlang herumzutreiben.” Und A., der mehr nüchtern Verhaltene, schließt das Gespräch mit den Worten: „Lieber B., die Menschen tragen Ketten, und sind Sclaven; aber sie sind nicht geboren, es zu sein, und haben die Hoffnung nicht verloren, wieder frei zu werden. Und, wenn schon auf die Unterdrückung einer Anhänglichkeit ein so wohltuendes Bewußtsein folgt; was meinst du, was der Friede sein müsse, von dem man in jenem Bewußtsein nur den ersten Anbiß hat, wenn nämlich nicht mehr von Unterdrücken die Rede ist, sondern wenn die Ketten wirklich abgenommen werden! - Und da kommt das rechte England zum Vorschein, und die rechte St. Paulskirche. - Aber lebe wohl, wir kommen hier auf heiligen Grund und Boden.”

 Mischt sich in dieser Betrachtung noch Religion und Politik, so hat Claudius nach der Französischen Revolution sich mit den neuen politischen Meinungen intensiv beschäftigt. Über Krieg und Frieden blieben seine Ansichten unerschütterlich. Mit Sorge sah er auf die Mächtigen der Welt, ihren Macht-Dünkel und Macht-Mißbrauch: „Ach, die Kronen sind nicht ohne Bürden, / Sind nicht ohn' Gefahren, Kind! / Und es gibt für Menschenkinder Würden, / Die noch größer sind.” Erstaunlich bleibt, daß der Bote seinen Lesern den genauen Text der „Menschen-Rechte” vorlegt, deren Declarierung die französische Nationalversammlung am 2. Oktober 1789 dem König vorgelegt hatte. Er nimmt kritisch, aber in vielen Punkten zustimmend Stellung zu dieser Urkunde oder „Charta Magna”, wie er sie nennt. Eine andere wichtige Betrachtung, in der Claudius sich von einer neuen, oft übersehenen Seite zeigt, geht „Über die Neue Politik”. Das Neue System hat für ihn, den von Natur und Erziehung her Konservativen, seine Angelhaken. Aber soweit die Gewissen der Menschen, der Regierenden geweckt werden sollen, will Claudius dieser neuen Politik nicht entgegen sein: „Ich sehe freilich auch wohl ein, daß manches in der Welt anders sein könnte und sein sollte, und daß eine Besserung nicht unnötig wäre.” Aber kritisch fügt er hinzu, „daß die äußeren Einrichtungen es allein wohl nicht gar täten”. Seine, des Asmus Konsequenz ist diese: „Der Mensch also muß gebessert werden; und, würde ich raten, nicht von außen hinein.” So viele „vorläufige Bedenklichkeiten und Zweifel gegen das Neue System” der Wandsbecker Bote auch hegt, immer wieder mahnt er die Herrschenden: „Ihr Könige, und Ihr Regenten! - Euer Stuhl steht in der Welt von Gottes wegen. Und wer darauf sitzt, soll groß und unüberwindlich sein, aber mit Recht und Wahrheit! Die allein machen groß, und die allein sind unüberwindlich.” Mischt sich in dieser Betrachtung noch Religion und Politik, so hat Claudius nach der Französischen Revolution sich mit den neuen politischen Meinungen intensiv beschäftigt. Über Krieg und Frieden blieben seine Ansichten unerschütterlich. Mit Sorge sah er auf die Mächtigen der Welt, ihren Macht-Dünkel und Macht-Mißbrauch: „Ach, die Kronen sind nicht ohne Bürden, / Sind nicht ohn' Gefahren, Kind! / Und es gibt für Menschenkinder Würden, / Die noch größer sind.” Erstaunlich bleibt, daß der Bote seinen Lesern den genauen Text der „Menschen-Rechte” vorlegt, deren Declarierung die französische Nationalversammlung am 2. Oktober 1789 dem König vorgelegt hatte. Er nimmt kritisch, aber in vielen Punkten zustimmend Stellung zu dieser Urkunde oder „Charta Magna”, wie er sie nennt. Eine andere wichtige Betrachtung, in der Claudius sich von einer neuen, oft übersehenen Seite zeigt, geht „Über die Neue Politik”. Das Neue System hat für ihn, den von Natur und Erziehung her Konservativen, seine Angelhaken. Aber soweit die Gewissen der Menschen, der Regierenden geweckt werden sollen, will Claudius dieser neuen Politik nicht entgegen sein: „Ich sehe freilich auch wohl ein, daß manches in der Welt anders sein könnte und sein sollte, und daß eine Besserung nicht unnötig wäre.” Aber kritisch fügt er hinzu, „daß die äußeren Einrichtungen es allein wohl nicht gar täten”. Seine, des Asmus Konsequenz ist diese: „Der Mensch also muß gebessert werden; und, würde ich raten, nicht von außen hinein.” So viele „vorläufige Bedenklichkeiten und Zweifel gegen das Neue System” der Wandsbecker Bote auch hegt, immer wieder mahnt er die Herrschenden: „Ihr Könige, und Ihr Regenten! - Euer Stuhl steht in der Welt von Gottes wegen. Und wer darauf sitzt, soll groß und unüberwindlich sein, aber mit Recht und Wahrheit! Die allein machen groß, und die allein sind unüberwindlich.”
 Im „Beschluß” dieser Gedanken zum Politischen, auch zum Sozialen, zu Recht und Gerechtigkeit, findet Claudius Sätze von schlichter Größe und Eindringlichkeit. Obgleich er sich selbst, als „einem Schwachen”, ersparen möchte, „von der Schwachheit seiner Mitmenschen zu reden”, rafft er sich auf; denn „guter Rat ist doch immer ehrenwert, er komme vom Schwachen oder von dem Starken”. Und nun folgen die einzigartigen Sätze, die so ganz die reine Herzensgesinnung des schlichten Mannes und Boten uns enthüllen: „Wenn ein guter Hausvater bei Nacht Licht braucht, so hascht ers nicht draußen unter dem weiten Tausend-Sternen-Himmel, und bringt es durch die Fenster herein; sondern er schlägt es mit Stahl und Stein mühsam und künstlich im Hause an, und läßt es durch die Fenster hinaus leuchten. - Man kann nicht Bergauf kommen, ohne Bergan zu gehen. Und obwohl Steigen beschwerlich ist, so kommt man doch dem Gipfel immer näher, und mit jedem Schritt wird die Aussicht umher freier und schöner! Und oben ist Oben. - Wie nun der Sklave es auch machen möge, sich seiner Ketten zu entledigen; so viel ist klar, daß er durch Wissen und Vernünfteln die Ketten nicht brechen werde; sondern daß er Hand anlegen müsse, wenn es sein Ernst ist, ihrer los zu werden. - Und das ist die Besserung, die ich in Vorschlag bringe. Sie ist unser Tagewerk auf Erden, und der Große Königliche Weg zur Freiheit, der Niemand gereuet.” Im „Beschluß” dieser Gedanken zum Politischen, auch zum Sozialen, zu Recht und Gerechtigkeit, findet Claudius Sätze von schlichter Größe und Eindringlichkeit. Obgleich er sich selbst, als „einem Schwachen”, ersparen möchte, „von der Schwachheit seiner Mitmenschen zu reden”, rafft er sich auf; denn „guter Rat ist doch immer ehrenwert, er komme vom Schwachen oder von dem Starken”. Und nun folgen die einzigartigen Sätze, die so ganz die reine Herzensgesinnung des schlichten Mannes und Boten uns enthüllen: „Wenn ein guter Hausvater bei Nacht Licht braucht, so hascht ers nicht draußen unter dem weiten Tausend-Sternen-Himmel, und bringt es durch die Fenster herein; sondern er schlägt es mit Stahl und Stein mühsam und künstlich im Hause an, und läßt es durch die Fenster hinaus leuchten. - Man kann nicht Bergauf kommen, ohne Bergan zu gehen. Und obwohl Steigen beschwerlich ist, so kommt man doch dem Gipfel immer näher, und mit jedem Schritt wird die Aussicht umher freier und schöner! Und oben ist Oben. - Wie nun der Sklave es auch machen möge, sich seiner Ketten zu entledigen; so viel ist klar, daß er durch Wissen und Vernünfteln die Ketten nicht brechen werde; sondern daß er Hand anlegen müsse, wenn es sein Ernst ist, ihrer los zu werden. - Und das ist die Besserung, die ich in Vorschlag bringe. Sie ist unser Tagewerk auf Erden, und der Große Königliche Weg zur Freiheit, der Niemand gereuet.”

 Hier spricht ein Christ, nun nicht mehr bloß konservativ, gewiß auch nicht revolutionär, ein Mensch, der um der Wahrheit willen Zeugnis ablegt. Noch im Alter bekräftigt er diese Gesinnung: „Die Wahrheit bleibt und wanket nicht. - Und wer ihr einfältig und beharrlich anhanget, der wittert Morgenluft, und hält sich an das, was er hat - bis er mehr erfahren wird.” Claudius war ein Feind aller großen Worte. Er sah seine eigene Schriftstellerei ohne Dünkel, mit einem leisen Lächeln. „Überhaupt Worte sind Worte, und man kann dabei nicht genug auf seiner Hut sein. Wo sie wirkliche Gegenstände haben, da geht alles ziemlich gut und sicher; wo sie aber mit abstrakten Begriffen umgehen, da wird guter Rat teuer.” Den Gelehrten, den Philosophen gegenüber bleibt er skeptisch. Denken und Sein oder Vernunft und Existenz müssen für ihn eins sein. „Durch Worte und Floskeln wird aus dürrem Winterholz kein grünes; wohl aber durch ein gleichartiges Leben.” Hier spricht ein Christ, nun nicht mehr bloß konservativ, gewiß auch nicht revolutionär, ein Mensch, der um der Wahrheit willen Zeugnis ablegt. Noch im Alter bekräftigt er diese Gesinnung: „Die Wahrheit bleibt und wanket nicht. - Und wer ihr einfältig und beharrlich anhanget, der wittert Morgenluft, und hält sich an das, was er hat - bis er mehr erfahren wird.” Claudius war ein Feind aller großen Worte. Er sah seine eigene Schriftstellerei ohne Dünkel, mit einem leisen Lächeln. „Überhaupt Worte sind Worte, und man kann dabei nicht genug auf seiner Hut sein. Wo sie wirkliche Gegenstände haben, da geht alles ziemlich gut und sicher; wo sie aber mit abstrakten Begriffen umgehen, da wird guter Rat teuer.” Den Gelehrten, den Philosophen gegenüber bleibt er skeptisch. Denken und Sein oder Vernunft und Existenz müssen für ihn eins sein. „Durch Worte und Floskeln wird aus dürrem Winterholz kein grünes; wohl aber durch ein gleichartiges Leben.”
 So kann, ja muß er auch sagen: „Eigentlich soll niemand einen Orden zur Herstellung anderer Menschen stiften, als der selbst hergestellt ist, und also seine Genossen in Wahrheit fördern kann.” Abhold einer abstrakten, negierenden, ja ins Nichts führenden Philosophie verkannte Claudius nicht die Bedeutung der Vernunft: „Wer die Vernunft kennt, verachtet sie nicht. Sie ist ein Strahl Gottes, und nur das radicale Böse hat ihr die himmelblauen Augen verderbt. Aber, es schwebt noch um den blinden Tiresias etwas Großes und Ahnungsvolles, und sie hat, wie der König Lear, auch wenn sie irre redet, noch die Königs-Miene und einen Glanz an der Stirne.” Er schließt diese persönlichen Betrachtungen - Verteidigung gegen Angriffe der Vernünftler von draußen - mit den wiederum so kennzeichnenden Worten: „Was soll uns leidiger Trost und Großtun, wenn man darbt und vor Hunger nicht schlafen kann.” So kann, ja muß er auch sagen: „Eigentlich soll niemand einen Orden zur Herstellung anderer Menschen stiften, als der selbst hergestellt ist, und also seine Genossen in Wahrheit fördern kann.” Abhold einer abstrakten, negierenden, ja ins Nichts führenden Philosophie verkannte Claudius nicht die Bedeutung der Vernunft: „Wer die Vernunft kennt, verachtet sie nicht. Sie ist ein Strahl Gottes, und nur das radicale Böse hat ihr die himmelblauen Augen verderbt. Aber, es schwebt noch um den blinden Tiresias etwas Großes und Ahnungsvolles, und sie hat, wie der König Lear, auch wenn sie irre redet, noch die Königs-Miene und einen Glanz an der Stirne.” Er schließt diese persönlichen Betrachtungen - Verteidigung gegen Angriffe der Vernünftler von draußen - mit den wiederum so kennzeichnenden Worten: „Was soll uns leidiger Trost und Großtun, wenn man darbt und vor Hunger nicht schlafen kann.”
 Mit Neunundfünfzig, ein schon gealterter Mann, schrieb er an seinen Sohn Johannes den Brief, der wie ein Testament seines Denkens, Glaubens, Lebens noch heute zu uns spricht. Hören wir noch einige dieser Sätze: „Niemand ist weise von Mutterleibe an; Zeit und Erfahrung lehren hier, und fegen die Tenne. - Es ist nichts groß, was nicht gut ist; und nichts wahr, was nicht bestehet. - Man hat darum die Sache nicht, daß man davon reden kann und davon redet. - Erwarte nichts vom Treiben und den Treibern; und wo Geräusch auf den Gassen ist, da gehe fürbaß. - Was im Hirn ist, das ist im Hirn; und Existenz ist die erste aller Eigenschaften. - Verachte keine Religion, denn sie ist dem Geist gemeint, und du weißt nicht, was unter unansehnlichen Bildern verborgen sein könne. - Mißtraue der Gestikulation, und gebärde dich schlecht und recht. - Hänge dich an keinen Großen. - Nicht die frömmelnden, aber die frommen Menschen achte, und gehe ihnen nach. - Habe immer etwas Gutes im Sinn. - Und sinne täglich nach über Tod und Leben, ob du es finden möchtest, und habe einen freudigen Mut.” Mit Neunundfünfzig, ein schon gealterter Mann, schrieb er an seinen Sohn Johannes den Brief, der wie ein Testament seines Denkens, Glaubens, Lebens noch heute zu uns spricht. Hören wir noch einige dieser Sätze: „Niemand ist weise von Mutterleibe an; Zeit und Erfahrung lehren hier, und fegen die Tenne. - Es ist nichts groß, was nicht gut ist; und nichts wahr, was nicht bestehet. - Man hat darum die Sache nicht, daß man davon reden kann und davon redet. - Erwarte nichts vom Treiben und den Treibern; und wo Geräusch auf den Gassen ist, da gehe fürbaß. - Was im Hirn ist, das ist im Hirn; und Existenz ist die erste aller Eigenschaften. - Verachte keine Religion, denn sie ist dem Geist gemeint, und du weißt nicht, was unter unansehnlichen Bildern verborgen sein könne. - Mißtraue der Gestikulation, und gebärde dich schlecht und recht. - Hänge dich an keinen Großen. - Nicht die frömmelnden, aber die frommen Menschen achte, und gehe ihnen nach. - Habe immer etwas Gutes im Sinn. - Und sinne täglich nach über Tod und Leben, ob du es finden möchtest, und habe einen freudigen Mut.”

 Über des Boten Christenglauben zu sprechen, erübrigt sich. Von Anbeginn bis zum Ende leuchtet er auf, am schönsten, wo er nicht direkt und in oft langatmigen Abhandlungen angesprochen wird. Sein Freund Friedrich Heinrich Jacobi, der 1794 aus Pempelfurt bei Düsseldorf flüchtete und ein Jahr in Wandsbeck lebte, hat gegenüber anderen Zeitgenossen am zutreffendsten und tiefsten über Claudius geurteilt, so in der erst 1811 erschienenen Schrift „Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung”. Sinn und Ziel seiner Darlegung sollte sein, „auf die mannigfaltigste Weise darzutun, daß der religiöse bloße Idealist, und der religiöse bloße Materialist sich nur in die beiden Schalen der Muschel teilen, welche die Perle des Christentums enthält. Weder der Bote noch sein Freund, der Verfasser der Schrift von den Göttlichen Dingen, wollen eine solche Teilung, sondern die Perle selbst.” Jacobi bekennt, er gehöre zu denjenigen, „die es nicht vergessen können, wie vielen Dank allerlei Art ihnen, Asmus, Bote zu Wandsbeck, seit fünfundzwanzig Jahren abgewonnen hat: denn so lange durchwandert er nun schon an seinem Botenstab das weitläufige Deutschland.” Und Jacobi fährt fort, um den Menschen Claudius in seiner ganzen schlichten Tiefe oder vertieften Schlichtheit zu kennzeichnen: „So viel gutes Zeugnis können und dürfen wir ihm geben, daß er sich gleich geblieben, und sein sechster Teil nicht geringer an Wert ist, als die vorhergegangenen. Dieses hat er wohl seiner ernstlichen Manier zu verdanken; welche nicht zu den Manieren der Kunst gehört, die jemand annimmt, wählt oder sich selbst erschafft ... Eine Kunst, von der man zwar gestehen muß, daß sie keine Kunst ist, wie sie die ganz vornehmen Leute, die großen Virtuosen, die sich selbst dafür ausgeben, besitzen und fordern ...” Über des Boten Christenglauben zu sprechen, erübrigt sich. Von Anbeginn bis zum Ende leuchtet er auf, am schönsten, wo er nicht direkt und in oft langatmigen Abhandlungen angesprochen wird. Sein Freund Friedrich Heinrich Jacobi, der 1794 aus Pempelfurt bei Düsseldorf flüchtete und ein Jahr in Wandsbeck lebte, hat gegenüber anderen Zeitgenossen am zutreffendsten und tiefsten über Claudius geurteilt, so in der erst 1811 erschienenen Schrift „Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung”. Sinn und Ziel seiner Darlegung sollte sein, „auf die mannigfaltigste Weise darzutun, daß der religiöse bloße Idealist, und der religiöse bloße Materialist sich nur in die beiden Schalen der Muschel teilen, welche die Perle des Christentums enthält. Weder der Bote noch sein Freund, der Verfasser der Schrift von den Göttlichen Dingen, wollen eine solche Teilung, sondern die Perle selbst.” Jacobi bekennt, er gehöre zu denjenigen, „die es nicht vergessen können, wie vielen Dank allerlei Art ihnen, Asmus, Bote zu Wandsbeck, seit fünfundzwanzig Jahren abgewonnen hat: denn so lange durchwandert er nun schon an seinem Botenstab das weitläufige Deutschland.” Und Jacobi fährt fort, um den Menschen Claudius in seiner ganzen schlichten Tiefe oder vertieften Schlichtheit zu kennzeichnen: „So viel gutes Zeugnis können und dürfen wir ihm geben, daß er sich gleich geblieben, und sein sechster Teil nicht geringer an Wert ist, als die vorhergegangenen. Dieses hat er wohl seiner ernstlichen Manier zu verdanken; welche nicht zu den Manieren der Kunst gehört, die jemand annimmt, wählt oder sich selbst erschafft ... Eine Kunst, von der man zwar gestehen muß, daß sie keine Kunst ist, wie sie die ganz vornehmen Leute, die großen Virtuosen, die sich selbst dafür ausgeben, besitzen und fordern ...”
 Und nun zitiert Jacobi einige Stellen aus des Claudius Abhandlung über die Musik, gleich im ersten Bändchen. Sie bekunden, daß in den alten Zeiten die Dichter und Musiker sich nicht in der Absicht hören ließen, um als Komponisten gefeiert zu werden, sondern daß die Musik, „am Altar entsprungen”, in einer Zeit erschien, „darin sie ohne alle eigene Gerechtigkeit war, und in Knechtsgestalt Wunder tat . .. Erst später wurde aus ihr eine schöne Kunst gemacht.” Jacobi fährt fort: „Ohne eigene Gerechtigkeit, und - in Knechtsgestalt: diese zwei Bestimmungen charakterisieren die Art und Kunst unseres Freimeisters in allen seinen Werken. Wenn sich etwas neu und tief Empfundenes, oder groß und trefflich Gedachtes in seiner Einbildungskraft gestaltet hat, und nun im angeborenen Glanze hervortreten will, so hält er es an, um ihm vorher die Strahlen zu löschen; er errötet, windet und versteckt sich - will es nicht getan haben. Daher die ihm so ganz eigentümliche Einkleidung, die drollichten Wendungen, die eingemischten Späße, das Lächeln, das er dem Leser auf die Lippen bringt, indem er zugleich sein Innerstes oft bis ins Mark erschüttert.” Und nun zitiert Jacobi einige Stellen aus des Claudius Abhandlung über die Musik, gleich im ersten Bändchen. Sie bekunden, daß in den alten Zeiten die Dichter und Musiker sich nicht in der Absicht hören ließen, um als Komponisten gefeiert zu werden, sondern daß die Musik, „am Altar entsprungen”, in einer Zeit erschien, „darin sie ohne alle eigene Gerechtigkeit war, und in Knechtsgestalt Wunder tat . .. Erst später wurde aus ihr eine schöne Kunst gemacht.” Jacobi fährt fort: „Ohne eigene Gerechtigkeit, und - in Knechtsgestalt: diese zwei Bestimmungen charakterisieren die Art und Kunst unseres Freimeisters in allen seinen Werken. Wenn sich etwas neu und tief Empfundenes, oder groß und trefflich Gedachtes in seiner Einbildungskraft gestaltet hat, und nun im angeborenen Glanze hervortreten will, so hält er es an, um ihm vorher die Strahlen zu löschen; er errötet, windet und versteckt sich - will es nicht getan haben. Daher die ihm so ganz eigentümliche Einkleidung, die drollichten Wendungen, die eingemischten Späße, das Lächeln, das er dem Leser auf die Lippen bringt, indem er zugleich sein Innerstes oft bis ins Mark erschüttert.”
 Verklärt sehen wir Heutigen Matthias Claudius nicht mehr. Es sollte uns aber, gerade als Christen, nachdenklich machen, daß Dietrich Bonhoeffer zu dem Wandsbecker Boten ein persönlich geprägtes Verhältnis besaß. In Gedichten wie „Der Mensch”, im „Abendlied” und ganz besonders im Gedicht „Täglich zu singen” mit der so einprägsamen Existenz-Bejahung - „Daß ich bin, bin! Und daß ich dich, / Schön Menschlich Antlitz! habe.” erschien Bonhoeffer die Bestätigung, daß Gottes Gebot dem Menschen erlaube als Mensch vor Gott zu leben. In diesen christlichen Gedichten habe „die Zeitlichkeit, die Fülle und die Hinfälligkeit des menschlichen Lebens einen unvergleichlichen Ausdruck gefunden”. Verklärt sehen wir Heutigen Matthias Claudius nicht mehr. Es sollte uns aber, gerade als Christen, nachdenklich machen, daß Dietrich Bonhoeffer zu dem Wandsbecker Boten ein persönlich geprägtes Verhältnis besaß. In Gedichten wie „Der Mensch”, im „Abendlied” und ganz besonders im Gedicht „Täglich zu singen” mit der so einprägsamen Existenz-Bejahung - „Daß ich bin, bin! Und daß ich dich, / Schön Menschlich Antlitz! habe.” erschien Bonhoeffer die Bestätigung, daß Gottes Gebot dem Menschen erlaube als Mensch vor Gott zu leben. In diesen christlichen Gedichten habe „die Zeitlichkeit, die Fülle und die Hinfälligkeit des menschlichen Lebens einen unvergleichlichen Ausdruck gefunden”.
Quatember 1974, S. 90-101
|