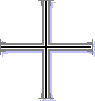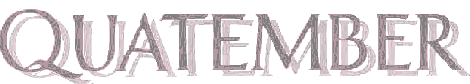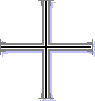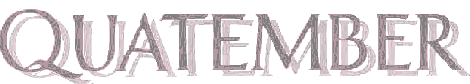Das Schicksal des Künstlers Caspar David Friedrich im Urteil von Zeitgenossen und Nachwelt ist merkwürdig genug. Nach seiner Wiederentdeckung am Jahrhundertbeginn gerieten einige seiner Bilder durch den Spürsinn von Kunstverlagen in Kunstdruckwiedergaben an die Wände deutscher Bürgerhäuser. Er schien nun ein für allemal abgestempelt. Ob das in der Bildwirkung stark verblaßte Kreuzessymbol oder ob die gefühlsbeladene Riesengebirgslandschaft der relevante Bildinhalt wären, das stand gleichsam auf der Kippe und war dem Belieben des Käufers und Betrachters überlassen. Das Schicksal des Künstlers Caspar David Friedrich im Urteil von Zeitgenossen und Nachwelt ist merkwürdig genug. Nach seiner Wiederentdeckung am Jahrhundertbeginn gerieten einige seiner Bilder durch den Spürsinn von Kunstverlagen in Kunstdruckwiedergaben an die Wände deutscher Bürgerhäuser. Er schien nun ein für allemal abgestempelt. Ob das in der Bildwirkung stark verblaßte Kreuzessymbol oder ob die gefühlsbeladene Riesengebirgslandschaft der relevante Bildinhalt wären, das stand gleichsam auf der Kippe und war dem Belieben des Käufers und Betrachters überlassen.
 Im Herbst 1972 gab es dann in London angesichts der nahenden zweihundert jährigen Wiederkehr von Friedrichs Geburtstag (5. 9. 1774) eine große Werk-Ausstellung. Diesmal war die Reaktion der Öffentlichkeit kontrovers. Es „schieden sich die Geister an seiner Kunst”. Wie kommt es, daß dieses scheinbar so stille malerische Werk nach sechs Generationen Unruhe schafft und so viele Fragen stellt, wie das auch jetzt wieder während der großen Gedächtnis-Ausstellung in Hamburg geschah?
Dem Leben und Charakterbild Friedrichs wird kaum jemand Sympathie verweigern, wie es auch die besten seiner Zeitgenossen nicht getan haben. Aber damals wie heute kann man zunächst das Empfinden einer bestimmten Rätselhaftigkeit kaum loswerden. Es trägt nicht viel ein, wollte man die Stationen des äußerlich ziemlich gleichförmig verlaufenden Lebens in biographischer Vordergründigkeit nacheinander aufzeichnen. Überblickt man aber das Ganze seiner Persönlichkeit in ihrer Zeit, dann fällt sogleich eine merkwürdige Doppelrolle auf. Einerseits ist Friedrich stark in sich gekehrt. In gefährlichen einsamen Eskapaden setzt er sich mit den Gewalten von Land, Meer und Luft wie mit der Rätselhaftigkeit und Unermeßlichkeit des Universums auseinander. In Wanderungen durch Rügen, in den Harz und in das Riesengebirge sucht er zum Elementaren der Landschaft und ihrer wechselnden Erscheinungen hindurchzudringen. Im Herbst 1972 gab es dann in London angesichts der nahenden zweihundert jährigen Wiederkehr von Friedrichs Geburtstag (5. 9. 1774) eine große Werk-Ausstellung. Diesmal war die Reaktion der Öffentlichkeit kontrovers. Es „schieden sich die Geister an seiner Kunst”. Wie kommt es, daß dieses scheinbar so stille malerische Werk nach sechs Generationen Unruhe schafft und so viele Fragen stellt, wie das auch jetzt wieder während der großen Gedächtnis-Ausstellung in Hamburg geschah?
Dem Leben und Charakterbild Friedrichs wird kaum jemand Sympathie verweigern, wie es auch die besten seiner Zeitgenossen nicht getan haben. Aber damals wie heute kann man zunächst das Empfinden einer bestimmten Rätselhaftigkeit kaum loswerden. Es trägt nicht viel ein, wollte man die Stationen des äußerlich ziemlich gleichförmig verlaufenden Lebens in biographischer Vordergründigkeit nacheinander aufzeichnen. Überblickt man aber das Ganze seiner Persönlichkeit in ihrer Zeit, dann fällt sogleich eine merkwürdige Doppelrolle auf. Einerseits ist Friedrich stark in sich gekehrt. In gefährlichen einsamen Eskapaden setzt er sich mit den Gewalten von Land, Meer und Luft wie mit der Rätselhaftigkeit und Unermeßlichkeit des Universums auseinander. In Wanderungen durch Rügen, in den Harz und in das Riesengebirge sucht er zum Elementaren der Landschaft und ihrer wechselnden Erscheinungen hindurchzudringen.
 „In Stubbenkammer verweilte er am öftesten, dort sahen ihn die Fischer manchmal mit Sorge um sein Leben auf und zwischen den Zacken der Bergwand und ihren ins Meer hinausragenden Klippen herumklettern. Wenn der Sturm am kräftigsten war und die Wogen, mit Schaum bedeckt, am höchsten heranschlugen, da stand er, von dem heranspritzenden Schaum oder auch von einem plötzlichen Ergusse des Regens durchnäßt, hinschauend wie einer, der sich an solcher gewaltigen Lust der Augen nicht satt sehen kann. Wenn ein Gewitter mit Blitz und Donner über das Meer daherzog, dann eilte er ihm, wie einer, der mit diesen Mächten den Freundschaftsbund geschlossen, entgegen. . . .” Ist es Zufall, daß Gotthilf Heinrich Schubert das Außergewöhnliche dieses Vorgangs festhielt, der ihm erschienen sein mag, als ob Friedrich auf eine für ihn entscheidende Entdeckung oder Erleuchtung gewartet oder sie gar herausgefordert habe? Und da geriet dieser so einsam in und mit sich ringende Künstler zugleich in geistige und körperliche Nähe zu den bedeutendsten Zeitgenossen, dem schöpferischen Potential jener in den Tiefen aufgerührten drei Jahrzehnte nach der französischen Revolution von 1789. Da woben Schelling und der Friedrich kongeniale Novalis die philosophischen Gedanken und dichterischen Visionen, zu denen Friedrichs Bilder bald die malerische Entsprechung schufen. Da tauchten in Friedrichs Nähe die Gebrüder Schlegel, Ludwig Tieck, Jean Paul oder Theodor Körner auf. Daß sich die Genien Heinrich von Kleists und Caspar David Friedrichs aneinander entzündeten, mag nur dem oberflächlichen Blick verwunderlich erscheinen. Rührte denn nicht der Anbruch des neuen Zeitalters vielleicht am tiefsten an diese beiden empfindsamen Seelen? Man kann getrost vermuten, daß sie darin sogar umeinander gewußt haben. „In Stubbenkammer verweilte er am öftesten, dort sahen ihn die Fischer manchmal mit Sorge um sein Leben auf und zwischen den Zacken der Bergwand und ihren ins Meer hinausragenden Klippen herumklettern. Wenn der Sturm am kräftigsten war und die Wogen, mit Schaum bedeckt, am höchsten heranschlugen, da stand er, von dem heranspritzenden Schaum oder auch von einem plötzlichen Ergusse des Regens durchnäßt, hinschauend wie einer, der sich an solcher gewaltigen Lust der Augen nicht satt sehen kann. Wenn ein Gewitter mit Blitz und Donner über das Meer daherzog, dann eilte er ihm, wie einer, der mit diesen Mächten den Freundschaftsbund geschlossen, entgegen. . . .” Ist es Zufall, daß Gotthilf Heinrich Schubert das Außergewöhnliche dieses Vorgangs festhielt, der ihm erschienen sein mag, als ob Friedrich auf eine für ihn entscheidende Entdeckung oder Erleuchtung gewartet oder sie gar herausgefordert habe? Und da geriet dieser so einsam in und mit sich ringende Künstler zugleich in geistige und körperliche Nähe zu den bedeutendsten Zeitgenossen, dem schöpferischen Potential jener in den Tiefen aufgerührten drei Jahrzehnte nach der französischen Revolution von 1789. Da woben Schelling und der Friedrich kongeniale Novalis die philosophischen Gedanken und dichterischen Visionen, zu denen Friedrichs Bilder bald die malerische Entsprechung schufen. Da tauchten in Friedrichs Nähe die Gebrüder Schlegel, Ludwig Tieck, Jean Paul oder Theodor Körner auf. Daß sich die Genien Heinrich von Kleists und Caspar David Friedrichs aneinander entzündeten, mag nur dem oberflächlichen Blick verwunderlich erscheinen. Rührte denn nicht der Anbruch des neuen Zeitalters vielleicht am tiefsten an diese beiden empfindsamen Seelen? Man kann getrost vermuten, daß sie darin sogar umeinander gewußt haben.
 Heinrich von Kleists dichterisches Werk ist in der Ahnung seines zeitlich begrenzten Lebens in Konzentration auf wesentliche Aussagen entstanden. Wenn er daher eines der wichtigsten Bilder Friedrichs, das 1809/10 entstandene „Mönch am Meer”, in seiner prägnanten Sprache leidenschaftlich würdigt und in universale Zusammenhänge einordnet, so kann man das für mehr als bloßen Zufall halten. Kleist spürte Friedrichs Berufung wie seine eigene. Will man beider Streben in seiner letzten Bedeutung erfassen, so wird man sich jenes tiefsinnigen Satzes aus Kleists „Marionettentheater” erinnern: „. . . das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist.” Beide bedrängten die aus der geistigen Krise aufgestiegenen Visionen bis zur endlichen Erschöpfung und Vernichtung. Heinrich von Kleists dichterisches Werk ist in der Ahnung seines zeitlich begrenzten Lebens in Konzentration auf wesentliche Aussagen entstanden. Wenn er daher eines der wichtigsten Bilder Friedrichs, das 1809/10 entstandene „Mönch am Meer”, in seiner prägnanten Sprache leidenschaftlich würdigt und in universale Zusammenhänge einordnet, so kann man das für mehr als bloßen Zufall halten. Kleist spürte Friedrichs Berufung wie seine eigene. Will man beider Streben in seiner letzten Bedeutung erfassen, so wird man sich jenes tiefsinnigen Satzes aus Kleists „Marionettentheater” erinnern: „. . . das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist.” Beide bedrängten die aus der geistigen Krise aufgestiegenen Visionen bis zur endlichen Erschöpfung und Vernichtung.
 Mit Kleist, dessen „Hermannsschlacht” vermutlich zuerst in Friedrichs Dresdener Wohnung gelesen wurde, mit Ernst Moritz Arndt oder mit Adam Müller pochte zeitweilig auch das politische Schicksal Deutschlands an Friedrichs Ateliertür. Friedrich geriet auch in das Blickfeld Goethes, der einige von Friedrichs Gemälden nach Weimar kommen ließ. Doch ihre Naturen waren, wie ihre naturwissenschaftlichen Vorstellungen, zu verschieden, als daß es zu einer näheren Verbindung kommen konnte. Daß der spätere Zar Nikolaus I. in Friedrichs Loschwitzer Atelier einkehrte, erklärt, daß noch in jüngster Zeit bisher unbekannte Arbeiten Friedrichs auch in russischen Museen entdeckt wurden und die sowjetische Kunstgeschichtsforschung sich neuerdings bemüht, in die wissenschaftliche Diskussion um Friedrich einzugreifen. Mit Kleist, dessen „Hermannsschlacht” vermutlich zuerst in Friedrichs Dresdener Wohnung gelesen wurde, mit Ernst Moritz Arndt oder mit Adam Müller pochte zeitweilig auch das politische Schicksal Deutschlands an Friedrichs Ateliertür. Friedrich geriet auch in das Blickfeld Goethes, der einige von Friedrichs Gemälden nach Weimar kommen ließ. Doch ihre Naturen waren, wie ihre naturwissenschaftlichen Vorstellungen, zu verschieden, als daß es zu einer näheren Verbindung kommen konnte. Daß der spätere Zar Nikolaus I. in Friedrichs Loschwitzer Atelier einkehrte, erklärt, daß noch in jüngster Zeit bisher unbekannte Arbeiten Friedrichs auch in russischen Museen entdeckt wurden und die sowjetische Kunstgeschichtsforschung sich neuerdings bemüht, in die wissenschaftliche Diskussion um Friedrich einzugreifen.
 Seit im 20. Jahrhundert, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, Friedrichs Werke gesammelt, registriert und näher erforscht werden, hat indes das Bemühen, aus persönlichen Begegnungen Friedrichs direkte Einflüsse auf sein Werk abzuleiten, zu kontroversen Meinungen geführt, ohne so oder so zu überzeugen. Gewiß lebte Friedrich in der Mitte seines Lebens in engerem Kontakt zu vielen Geistern, die gleich ihm das Gesicht seiner Zeit prägten, aber sein Anschauungshorizont, die ihm eigene Art des künstlerischen Sehens, bildeten sich ganz allein in ihm selbst, so wie er seine „Landschaftsbilder” nicht, wie später die Impressionisten, in der freien Natur malte, sondern in seinem, von allem ablenkenden Beiwerk gesäuberten Atelier: „Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst sehest das Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, daß es zurückwirke auf andere von außen und von innen.” So sieht Friedrich den Vorgang seiner eigenen schöpferischen Arbeit. Von Georg Friedrich Kersting, dem Malerfreund Friedrichs, hängt in der Hamburger Kunsthalle ein Bild, das Friedrich im Atelier zeigt. Da gibt es außer der Staffelei nur Tisch und Stuhl. In dem streng geordneten, klar gegliederten Raum verbindet einzig das Licht, das durch ein quadratisches Fenster fällt, den Künstler mit dem Weltganzen, das er im Horizont und im rechteckigen Rahmen seiner Bilder malerisch einfängt und begreift. Seit im 20. Jahrhundert, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, Friedrichs Werke gesammelt, registriert und näher erforscht werden, hat indes das Bemühen, aus persönlichen Begegnungen Friedrichs direkte Einflüsse auf sein Werk abzuleiten, zu kontroversen Meinungen geführt, ohne so oder so zu überzeugen. Gewiß lebte Friedrich in der Mitte seines Lebens in engerem Kontakt zu vielen Geistern, die gleich ihm das Gesicht seiner Zeit prägten, aber sein Anschauungshorizont, die ihm eigene Art des künstlerischen Sehens, bildeten sich ganz allein in ihm selbst, so wie er seine „Landschaftsbilder” nicht, wie später die Impressionisten, in der freien Natur malte, sondern in seinem, von allem ablenkenden Beiwerk gesäuberten Atelier: „Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst sehest das Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, daß es zurückwirke auf andere von außen und von innen.” So sieht Friedrich den Vorgang seiner eigenen schöpferischen Arbeit. Von Georg Friedrich Kersting, dem Malerfreund Friedrichs, hängt in der Hamburger Kunsthalle ein Bild, das Friedrich im Atelier zeigt. Da gibt es außer der Staffelei nur Tisch und Stuhl. In dem streng geordneten, klar gegliederten Raum verbindet einzig das Licht, das durch ein quadratisches Fenster fällt, den Künstler mit dem Weltganzen, das er im Horizont und im rechteckigen Rahmen seiner Bilder malerisch einfängt und begreift.
 Caspar David Friedrich, der Landschaftsmaler? Verführt durch den Titel der Gedächtnisschrift, die aus der Feder seines langjährigen Freundes, des Philosophen, Arztes und Malers Carl Gustav Carus, 1841, ein Jahr nach Friedrichs Tod, erschien, hat man Friedrichs Werk bis zum heutigen Tag schlichtweg in die Kategorie der Landschaftsmalerei eingeordnet. Doch haben die Landschaften Friedrichs kaum etwas gemeinsam mit den Forderungen, die Carus an die von ihm so genannte „Erdlebenbildkunst” gestellt hat. Seit ihrem Beginn im 15. Jahrhundert, zumal im 17. Jahrhundert, ist die Landschaftsmalerei charakteristischer Ausdruck neuzeitlicher Weltbetrachtung gewesen. In dem in sich widerspenstigen Gespann Carus - Friedrich und in den Divergenzen ihrer malerischen wie literarischen Äußerungen erreicht sie einen krisenhaften Höhepunkt. Carus sucht im Bild eine objektive Landschaftsinterpretation. Der Landschaftsmaler solle ein guter Kenner der Gebirgsformen, ihrer geologisch bedingten Struktur, des gesetzmäßigen Baues von Pflanzen und Bäumen und der Gesetze der atmosphärischen Erscheinungen, also Geologe, Botaniker und Meteorologe in einer Person sein. Gewiß war es kein vordergründiger Realismus, den Carus, der Physiognomiker und frühe Verfechter einer Lehre vom Unbewußten, vertrat, aber seine auf dieses Postulat gegründete Erwartung, daß die Blütezeit der Landschaftsmalerei erst noch bevorstehe, machte ihn blind gegenüber dem Phänomen, daß Friedrichs Bilder vielmehr ein Ende mehrhundertjähriger Landschaftsmalerei ankündigten, mindestens darin ähnlich dem Werk von Friedrichs Weg- und Zeitgenossen Philipp Otto Runge. Caspar David Friedrich, der Landschaftsmaler? Verführt durch den Titel der Gedächtnisschrift, die aus der Feder seines langjährigen Freundes, des Philosophen, Arztes und Malers Carl Gustav Carus, 1841, ein Jahr nach Friedrichs Tod, erschien, hat man Friedrichs Werk bis zum heutigen Tag schlichtweg in die Kategorie der Landschaftsmalerei eingeordnet. Doch haben die Landschaften Friedrichs kaum etwas gemeinsam mit den Forderungen, die Carus an die von ihm so genannte „Erdlebenbildkunst” gestellt hat. Seit ihrem Beginn im 15. Jahrhundert, zumal im 17. Jahrhundert, ist die Landschaftsmalerei charakteristischer Ausdruck neuzeitlicher Weltbetrachtung gewesen. In dem in sich widerspenstigen Gespann Carus - Friedrich und in den Divergenzen ihrer malerischen wie literarischen Äußerungen erreicht sie einen krisenhaften Höhepunkt. Carus sucht im Bild eine objektive Landschaftsinterpretation. Der Landschaftsmaler solle ein guter Kenner der Gebirgsformen, ihrer geologisch bedingten Struktur, des gesetzmäßigen Baues von Pflanzen und Bäumen und der Gesetze der atmosphärischen Erscheinungen, also Geologe, Botaniker und Meteorologe in einer Person sein. Gewiß war es kein vordergründiger Realismus, den Carus, der Physiognomiker und frühe Verfechter einer Lehre vom Unbewußten, vertrat, aber seine auf dieses Postulat gegründete Erwartung, daß die Blütezeit der Landschaftsmalerei erst noch bevorstehe, machte ihn blind gegenüber dem Phänomen, daß Friedrichs Bilder vielmehr ein Ende mehrhundertjähriger Landschaftsmalerei ankündigten, mindestens darin ähnlich dem Werk von Friedrichs Weg- und Zeitgenossen Philipp Otto Runge.
 Deutlicher sah dies Adam Müller, wenn er meint, daß die neuere Landschaftsmalerei dem Betrachter „etwas von den Spuren eines über Stimmung und Laune erhabenen Weltgeists” vermittle. Friedrich steht nicht nur an der Schwelle einer kurzzeitigen Entwicklung, die zum Impressionismus führte, seine Formensprache deutet vielmehr schon auf das radikale Verlassen des Gegenständlichen, wie es erst das 20. Jahrhundert inzwischen erlebt, aber als signifikanten Ausdruck einer im Tiefsten verwandelten Weltsicht noch kaum recht begriffen hat. Noch Rainer Maria Rilke, der um die Jahrhundertwende in die Nähe Worpswedes und seiner Malerkolonie geriet, hat fast schwermütig um das Problem gerungen, das bereits hundert Jahre zuvor in Caspar David Friedrich ans Licht drängte. An Kleists Gedanken erinnert auch Rilkes Meditieren über den Versuch, der verlorenen Natur bewußt und mit Aufwendung des gesammelten Willens so nahe zu kommen, wie wir ihr, ohne es recht zu wissen, in der Kindheit waren. „Man begreift, daß diese letzteren Künstler sind, Dichter oder Maler, Tondichter oder Baumeister, Einsame im Grunde, die, indem sie sich der Natur zuwenden, das Ewige im Vergänglichen, das im tiefsten Gesetzmäßige dem vorübergehend Begründeten vorziehen, und die, da sie die Natur nicht bereden können, an ihnen teilzunehmen, ihre Aufgabe darin sehen, die Natur zu erfassen, um sich selbst irgendwo in ihre großen Zusammenhänge einzufügen. Und mit diesen einzelnen Einsamen nähert sich die ganze Menschheit der Natur. Es ist nicht der letzte und vielleicht eigentümlichste Wert der Kunst, daß sie das Medium ist, in welchem Mensch und Landschaft sich begegnen und finden.” Wenn Rilke die Bedeutung der Kunst (am Beispiel der Landschaftsmalerei) darin spürte, daß das Objektsein der Welt, das die Neuzeit einige Jahrhunderte zu ihrem Thema gemacht hatte, wieder aufgehoben wird, so leistete er damit auch einen frühen, wohl noch kaum gewürdigten Beitrag zur Erkenntnis der Stellung und Bedeutung Friedrichs in der europäischen Kunst- und Geistesgeschichte. Deutlicher sah dies Adam Müller, wenn er meint, daß die neuere Landschaftsmalerei dem Betrachter „etwas von den Spuren eines über Stimmung und Laune erhabenen Weltgeists” vermittle. Friedrich steht nicht nur an der Schwelle einer kurzzeitigen Entwicklung, die zum Impressionismus führte, seine Formensprache deutet vielmehr schon auf das radikale Verlassen des Gegenständlichen, wie es erst das 20. Jahrhundert inzwischen erlebt, aber als signifikanten Ausdruck einer im Tiefsten verwandelten Weltsicht noch kaum recht begriffen hat. Noch Rainer Maria Rilke, der um die Jahrhundertwende in die Nähe Worpswedes und seiner Malerkolonie geriet, hat fast schwermütig um das Problem gerungen, das bereits hundert Jahre zuvor in Caspar David Friedrich ans Licht drängte. An Kleists Gedanken erinnert auch Rilkes Meditieren über den Versuch, der verlorenen Natur bewußt und mit Aufwendung des gesammelten Willens so nahe zu kommen, wie wir ihr, ohne es recht zu wissen, in der Kindheit waren. „Man begreift, daß diese letzteren Künstler sind, Dichter oder Maler, Tondichter oder Baumeister, Einsame im Grunde, die, indem sie sich der Natur zuwenden, das Ewige im Vergänglichen, das im tiefsten Gesetzmäßige dem vorübergehend Begründeten vorziehen, und die, da sie die Natur nicht bereden können, an ihnen teilzunehmen, ihre Aufgabe darin sehen, die Natur zu erfassen, um sich selbst irgendwo in ihre großen Zusammenhänge einzufügen. Und mit diesen einzelnen Einsamen nähert sich die ganze Menschheit der Natur. Es ist nicht der letzte und vielleicht eigentümlichste Wert der Kunst, daß sie das Medium ist, in welchem Mensch und Landschaft sich begegnen und finden.” Wenn Rilke die Bedeutung der Kunst (am Beispiel der Landschaftsmalerei) darin spürte, daß das Objektsein der Welt, das die Neuzeit einige Jahrhunderte zu ihrem Thema gemacht hatte, wieder aufgehoben wird, so leistete er damit auch einen frühen, wohl noch kaum gewürdigten Beitrag zur Erkenntnis der Stellung und Bedeutung Friedrichs in der europäischen Kunst- und Geistesgeschichte.
 Friedrichs Bedeutung liegt nicht darin, daß er Vollbringer und Vollstrecker in seiner Zeit wäre, sondern daß er eine Entwicklung anstößt und weithin vorwegnimmt, die erst im 20. Jahrhundert volle Kontur bekommt. Die zögernd gestellte Frage „. . . ist es nicht manchmal so, als ob ... ein Caspar David Friedrich in einem Lyonel Feininger auf neuer Stufe wiedergeboren sei?” (Kurt Leonhard) sieht nur einen Teilaspekt, meint aber wohl unbewußt und unausgesprochen das Ganze. Ähnlich sieht Werner Haftmann, daß in Franz Marc die Romantik, „die sich latent über das 19. Jahrhundert erhalten hatte”, in ihre bildnerisch akute Phase tritt. Nun stellen Friedrichs Kritiker heute gern fest, daß er nicht durchgehalten habe. Die Formgebung sei gar nicht einheitlich durch alle seine Jahre. Zuletzt sei er ins Malerisch-Illusionistische abgeglitten. Die Erscheinung des Bildes habe sich mehr und mehr dem Natureindruck genähert. Dem Betrachter sei es überlassen geblieben, ob er noch dem Künstler in der Tiefe seiner Gedanken habe folgen oder sich oberflächlichen Empfindungen habe überlassen wollen. Friedrich hat sich indes stets in asketischer Strenge auszudrücken gesucht, und wenn der seherische Auftrag an seiner Lebenskraft zehrte, so daß er im Spätwerk nur noch, wenn auch zögernd, in die allgemeinen Bahnen einlenken konnte, die der Kunst des späteren 19. Jahrhunderts vorgezeichnet waren, so ändert das nichts an der Aussagekraft des Gesamtwerkes. Friedrichs Bedeutung liegt nicht darin, daß er Vollbringer und Vollstrecker in seiner Zeit wäre, sondern daß er eine Entwicklung anstößt und weithin vorwegnimmt, die erst im 20. Jahrhundert volle Kontur bekommt. Die zögernd gestellte Frage „. . . ist es nicht manchmal so, als ob ... ein Caspar David Friedrich in einem Lyonel Feininger auf neuer Stufe wiedergeboren sei?” (Kurt Leonhard) sieht nur einen Teilaspekt, meint aber wohl unbewußt und unausgesprochen das Ganze. Ähnlich sieht Werner Haftmann, daß in Franz Marc die Romantik, „die sich latent über das 19. Jahrhundert erhalten hatte”, in ihre bildnerisch akute Phase tritt. Nun stellen Friedrichs Kritiker heute gern fest, daß er nicht durchgehalten habe. Die Formgebung sei gar nicht einheitlich durch alle seine Jahre. Zuletzt sei er ins Malerisch-Illusionistische abgeglitten. Die Erscheinung des Bildes habe sich mehr und mehr dem Natureindruck genähert. Dem Betrachter sei es überlassen geblieben, ob er noch dem Künstler in der Tiefe seiner Gedanken habe folgen oder sich oberflächlichen Empfindungen habe überlassen wollen. Friedrich hat sich indes stets in asketischer Strenge auszudrücken gesucht, und wenn der seherische Auftrag an seiner Lebenskraft zehrte, so daß er im Spätwerk nur noch, wenn auch zögernd, in die allgemeinen Bahnen einlenken konnte, die der Kunst des späteren 19. Jahrhunderts vorgezeichnet waren, so ändert das nichts an der Aussagekraft des Gesamtwerkes.
 Was ist in Friedrichs Werk eigentlich das Elementare, das Bleibende, das vielleicht erst jetzt Aufblühende, weil unser neues Verhältnis zur Welt Erhellende? Da diesem Beitrag keine Abbildungen beigegeben sind, sei die Beschränkung auf Deutungsversuche nur weniger Bilder gestattet mit der Empfehlung, wo immer möglich, die Originale in den genannten Museen zu betrachten, zumal bekanntlich keine Reproduktion das Original ersetzt. Was ist in Friedrichs Werk eigentlich das Elementare, das Bleibende, das vielleicht erst jetzt Aufblühende, weil unser neues Verhältnis zur Welt Erhellende? Da diesem Beitrag keine Abbildungen beigegeben sind, sei die Beschränkung auf Deutungsversuche nur weniger Bilder gestattet mit der Empfehlung, wo immer möglich, die Originale in den genannten Museen zu betrachten, zumal bekanntlich keine Reproduktion das Original ersetzt.
  Im Schloß Charlottenburg befindet sich das 1809/10 entstandene Gemälde „Mönch am Meer”, auf das Heinrich von Kleist in Zuspitzung von Äußerungen Clemens Brentanos und Achim von Arnims in seinen dem Bild kongenialen „Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft” leidenschaftlich hingewiesen hat: „Das Bild liegt mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen wie die Apokalypse da ... Da es in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit nichts als den Rahmen zum Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären.” Friedrich hat, so scheint es, fast zwei Jahre an dem Bild gearbeitet, aber es ist, als ob in diesem sehr frühen Bild seine innerste Anschauungskraft einen auf der Stelle empfundenen unübertrefflichen Ausdruck gefunden habe. Beherrschend ist die Waagerechte des Horizonts, die im Verein mit der tief im Bildausschnitt liegenden Uferlinie den rechteckigen Bildrahmen nach allen Seiten zu sprengen scheint. Die einzige Vertikale, die relativ winzige Gestalt des Mönches, unterbricht nicht, sondern verstärkt eher den Eindruck rahmenloser Unendlichkeit, die nicht quantitativ sondern qualitativ zu sein scheint. Kommt das davon, daß die Perspektive so gut wie verlassen ist, worauf Kleists Bemerkung zielt: „als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären”? Tiefsinnige Bemerkungen Kleists über das Wechselspiel zwischen Bild und Betrachter - „dem Anspruch, den mein Herz an das Bild macht, und meinem Abbruch, den mir das Bild tat”, so daß er „selbst der Kapuziner” ward, „der einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis” - sie deuten auf den bis heute nicht ausgeloteten Vorgang, mit dem sich in den letzten Generationen die Stellung des Menschen im Weltganzen und seine daraus entspringende innere Einstellung verändert hat. Im Schloß Charlottenburg befindet sich das 1809/10 entstandene Gemälde „Mönch am Meer”, auf das Heinrich von Kleist in Zuspitzung von Äußerungen Clemens Brentanos und Achim von Arnims in seinen dem Bild kongenialen „Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft” leidenschaftlich hingewiesen hat: „Das Bild liegt mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen wie die Apokalypse da ... Da es in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit nichts als den Rahmen zum Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären.” Friedrich hat, so scheint es, fast zwei Jahre an dem Bild gearbeitet, aber es ist, als ob in diesem sehr frühen Bild seine innerste Anschauungskraft einen auf der Stelle empfundenen unübertrefflichen Ausdruck gefunden habe. Beherrschend ist die Waagerechte des Horizonts, die im Verein mit der tief im Bildausschnitt liegenden Uferlinie den rechteckigen Bildrahmen nach allen Seiten zu sprengen scheint. Die einzige Vertikale, die relativ winzige Gestalt des Mönches, unterbricht nicht, sondern verstärkt eher den Eindruck rahmenloser Unendlichkeit, die nicht quantitativ sondern qualitativ zu sein scheint. Kommt das davon, daß die Perspektive so gut wie verlassen ist, worauf Kleists Bemerkung zielt: „als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären”? Tiefsinnige Bemerkungen Kleists über das Wechselspiel zwischen Bild und Betrachter - „dem Anspruch, den mein Herz an das Bild macht, und meinem Abbruch, den mir das Bild tat”, so daß er „selbst der Kapuziner” ward, „der einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis” - sie deuten auf den bis heute nicht ausgeloteten Vorgang, mit dem sich in den letzten Generationen die Stellung des Menschen im Weltganzen und seine daraus entspringende innere Einstellung verändert hat.
  Parallel dazu ist in der gleichen Zeit die „Abtei im Eichenwald” (Schloß Charlottenburg) entstanden. Die Landschaft ist hier zwar noch dreidimensional erkennbar, und doch lassen das dunkle Geäst der kahlen Eiche und der vom Dunst erfüllte Hintergrund sogar den Zug der Mönche, die einen Sarg zum Tor der Kirchenruine tragen, wie in die Fläche gebannt erscheinen. Der Eindruck vielförmig ausgewogener Symmetrie hebt die Darstellung weit über alles Literarisch-Anekdotische hinaus. In der Kirchenruine, die die Bildmitte bildet, erkennt man unschwer die Westwand der Ruine Eldena. Dieses Motiv kehrt bei Friedrich mehrfach wieder. Das Grabgeleit bewegt sich auf den offenen Kirchenraum zu, der den Kruzifixus umschließt, ohne ihn bergen zu können. Die einstige symbolische Gestalt der Kirche ist zerstört. Doch hier wie auch sonst bei Friedrich sind Tod und Grab nicht als Zeichen der Trauer verstanden, so daß Theodor Körner in den zwei Sonetten auf dieses Bild mit der Zuversicht schließen konnte: Parallel dazu ist in der gleichen Zeit die „Abtei im Eichenwald” (Schloß Charlottenburg) entstanden. Die Landschaft ist hier zwar noch dreidimensional erkennbar, und doch lassen das dunkle Geäst der kahlen Eiche und der vom Dunst erfüllte Hintergrund sogar den Zug der Mönche, die einen Sarg zum Tor der Kirchenruine tragen, wie in die Fläche gebannt erscheinen. Der Eindruck vielförmig ausgewogener Symmetrie hebt die Darstellung weit über alles Literarisch-Anekdotische hinaus. In der Kirchenruine, die die Bildmitte bildet, erkennt man unschwer die Westwand der Ruine Eldena. Dieses Motiv kehrt bei Friedrich mehrfach wieder. Das Grabgeleit bewegt sich auf den offenen Kirchenraum zu, der den Kruzifixus umschließt, ohne ihn bergen zu können. Die einstige symbolische Gestalt der Kirche ist zerstört. Doch hier wie auch sonst bei Friedrich sind Tod und Grab nicht als Zeichen der Trauer verstanden, so daß Theodor Körner in den zwei Sonetten auf dieses Bild mit der Zuversicht schließen konnte:
„Der Quell der Gnade ist in Tod geflossen,
Und jene sind der Seligkeit Genossen,
Die durch das Grab zum ewgen Lichte ziehen.”
  Noch sieben bis acht Jahre später verdichtet sich Friedrichs Grundanschauung zu zwei Ölbildern, die Mensch und Universum wiederum in sinnfälligste Beziehung zueinander bringen. Das um 1817 entstandene „Zwei Männer am Meer bei Mondaufgang” (Berliner Nationalgalerie) fügt Ufer, Meer und Himmel zur Folie eines universalen Raumes. Anders als beim „Mönch am Meer” ist der Mensch, diesmal nicht das passive Individuum, sondern in Gestalt der beiden Männer das zur Verantwortung füreinander berufene Geschöpf, in voller Größe in das helldunkle Licht des Universums gestellt. Eine überwältigende Symmetrie, welche Ruhe und Konzentration atmet und ausstrahlt, lädt mit großer Geste zur Meditation ein. Noch sieben bis acht Jahre später verdichtet sich Friedrichs Grundanschauung zu zwei Ölbildern, die Mensch und Universum wiederum in sinnfälligste Beziehung zueinander bringen. Das um 1817 entstandene „Zwei Männer am Meer bei Mondaufgang” (Berliner Nationalgalerie) fügt Ufer, Meer und Himmel zur Folie eines universalen Raumes. Anders als beim „Mönch am Meer” ist der Mensch, diesmal nicht das passive Individuum, sondern in Gestalt der beiden Männer das zur Verantwortung füreinander berufene Geschöpf, in voller Größe in das helldunkle Licht des Universums gestellt. Eine überwältigende Symmetrie, welche Ruhe und Konzentration atmet und ausstrahlt, lädt mit großer Geste zur Meditation ein.
  Das um 1818 entstandene Ölbild „Frau in der Morgensonne” (Folkwangmuseum in Essen) führt noch einen Schritt weiter. Vom Formalen her gesehen liegt ihm wiederum die Grundstruktur der Symmetrie zugrunde, bereichert und verstärkt durch einzelne asymmetrische Elemente. Dem Betrachter widerfährt unwillkürlich das Empfinden für die Unermeßlichkeit wie für die Ordnung der Welt. Mensch und Strahlenbündel der Sonne fallen in einer gemeinsamen Symmetrieachse zusammen. Als die für Friedrich charakteristische Rückenfigur ist die Frau in Orantinnenhaltung dem Licht zugewendet. Einen „transzendentalen Standpunkt” hat sie nach einem Vorwort Friedrich Schlegels eingenommen, so daß „alles Reale in Ideales schwindet, alles Innere aber die höchste Realität hat”. Durch ihre Stellung im Bildraum, durch Gestalt und Haltung versinnbildlicht sie reines Schauen. So hat Friedrich über den „Mönch am Meer” und über die „Zwei Männer bei Mondaufgang” hinaus hier einen weiteren wichtigen Schritt der Anschaubarkeit gewagt. Vermittels des Paradoxes unkörperlicher Körperhaftigkeit und durch Überdimensionierung der menschlichen Gestalt im Bildraum stellt er ein inneres Gleichgewicht, ein echtes Gegenüber von Mensch und Universum her, beginnt er eine Zwiesprache, wie sie erst das auf ihn folgende Jahrhundert neu zu buchstabieren begonnen hat. Der Maler selbst wird zum Objekt der Räume, die er darstellt. Das um 1818 entstandene Ölbild „Frau in der Morgensonne” (Folkwangmuseum in Essen) führt noch einen Schritt weiter. Vom Formalen her gesehen liegt ihm wiederum die Grundstruktur der Symmetrie zugrunde, bereichert und verstärkt durch einzelne asymmetrische Elemente. Dem Betrachter widerfährt unwillkürlich das Empfinden für die Unermeßlichkeit wie für die Ordnung der Welt. Mensch und Strahlenbündel der Sonne fallen in einer gemeinsamen Symmetrieachse zusammen. Als die für Friedrich charakteristische Rückenfigur ist die Frau in Orantinnenhaltung dem Licht zugewendet. Einen „transzendentalen Standpunkt” hat sie nach einem Vorwort Friedrich Schlegels eingenommen, so daß „alles Reale in Ideales schwindet, alles Innere aber die höchste Realität hat”. Durch ihre Stellung im Bildraum, durch Gestalt und Haltung versinnbildlicht sie reines Schauen. So hat Friedrich über den „Mönch am Meer” und über die „Zwei Männer bei Mondaufgang” hinaus hier einen weiteren wichtigen Schritt der Anschaubarkeit gewagt. Vermittels des Paradoxes unkörperlicher Körperhaftigkeit und durch Überdimensionierung der menschlichen Gestalt im Bildraum stellt er ein inneres Gleichgewicht, ein echtes Gegenüber von Mensch und Universum her, beginnt er eine Zwiesprache, wie sie erst das auf ihn folgende Jahrhundert neu zu buchstabieren begonnen hat. Der Maler selbst wird zum Objekt der Räume, die er darstellt.
  Daß Friedrich auch noch in seiner späteren Schaffensperiode mit gleicher Intensität die veränderte Grundbefindlichkeit des Menschen vor der Welt im Ganzen ins Bild zu bringen weiß, daß hierin also in der Tat ein Proprium seines Schaffens zu suchen ist, dafür zeugt das um 1832 entstandene Ölbild „Im Großen Gehege” (Dresdener Gemäldegalerie). Durch den in ein breites Delta sich auflösenden Fluß entsteht in der unteren Bildzone ein flach nach unten sich öffnendes Dreieck. Die entsprechende Gegenbewegung bilden die Linien des leicht überwölkten, vom Widerschein der untergegangenen Sonne gleichmäßig durchstrahlten Himmels. Zwischen beiden Zonen erstreckt sich der schmale, von den seitlichen Bildrändern geschnittene dunklere Streifen einer durch zwei Baumgruppen und einen Hügel leicht skandierten herbstlichen Landschaft. Die malerische Einzigartigkeit dieses Bildes in der Geschichte der Landschaftsmalerei ist mit Recht gerühmt worden. Doch muß man darin mehr sehen als nur den formalen Reiz, der sich auch in der reichen Farbigkeit zeigt, die der spätere Friedrich in seine Palette aufgenommen hat. Hier spricht noch einmal das Erstaunen des Malers vor dem durch seine Hand entstandenen Phänomen, daß in der Anschauung eines Stückes äußerer Natur etwas vom Weltganzen offenbar wird, das ihn anspricht und gefangennimmt. Daß Friedrich auch noch in seiner späteren Schaffensperiode mit gleicher Intensität die veränderte Grundbefindlichkeit des Menschen vor der Welt im Ganzen ins Bild zu bringen weiß, daß hierin also in der Tat ein Proprium seines Schaffens zu suchen ist, dafür zeugt das um 1832 entstandene Ölbild „Im Großen Gehege” (Dresdener Gemäldegalerie). Durch den in ein breites Delta sich auflösenden Fluß entsteht in der unteren Bildzone ein flach nach unten sich öffnendes Dreieck. Die entsprechende Gegenbewegung bilden die Linien des leicht überwölkten, vom Widerschein der untergegangenen Sonne gleichmäßig durchstrahlten Himmels. Zwischen beiden Zonen erstreckt sich der schmale, von den seitlichen Bildrändern geschnittene dunklere Streifen einer durch zwei Baumgruppen und einen Hügel leicht skandierten herbstlichen Landschaft. Die malerische Einzigartigkeit dieses Bildes in der Geschichte der Landschaftsmalerei ist mit Recht gerühmt worden. Doch muß man darin mehr sehen als nur den formalen Reiz, der sich auch in der reichen Farbigkeit zeigt, die der spätere Friedrich in seine Palette aufgenommen hat. Hier spricht noch einmal das Erstaunen des Malers vor dem durch seine Hand entstandenen Phänomen, daß in der Anschauung eines Stückes äußerer Natur etwas vom Weltganzen offenbar wird, das ihn anspricht und gefangennimmt.
 Fragt man sich endlich, ob denn nicht das „Kreuz im Gebirge”, im Jahre 1808 gemalt, vor allen anderen hätte genannt und analysiert werden müssen, so rührt man an das Kernproblem einer Friedrich-Analyse in der Zeit der zweihundertjährigen Wiederkehr seines Geburtstages. Wird nicht Friedrich gerade durch dieses Bild als christlicher Maler ausgewiesen, zumal es als Altarbild für die Hauskapelle im Schloß des Grafen von Thun-Hohenstein zu Tetschen gemalt wurde? Aber gerade dieser Tatbestand wird in einer vor einem Vierteljahrhundert erschienenen Untersuchung über „Das Bild in der evangelischen Kirche” radikal verneint: „Welch eine verzweifelte Frömmigkeit, die im Geiste Dome zertrümmert, um dann in die Natur hinauszufliehen und das einsame ‚Kreuz im Gebirge’ zu malen!” (Hans Carl von Haebler). Fragt man sich endlich, ob denn nicht das „Kreuz im Gebirge”, im Jahre 1808 gemalt, vor allen anderen hätte genannt und analysiert werden müssen, so rührt man an das Kernproblem einer Friedrich-Analyse in der Zeit der zweihundertjährigen Wiederkehr seines Geburtstages. Wird nicht Friedrich gerade durch dieses Bild als christlicher Maler ausgewiesen, zumal es als Altarbild für die Hauskapelle im Schloß des Grafen von Thun-Hohenstein zu Tetschen gemalt wurde? Aber gerade dieser Tatbestand wird in einer vor einem Vierteljahrhundert erschienenen Untersuchung über „Das Bild in der evangelischen Kirche” radikal verneint: „Welch eine verzweifelte Frömmigkeit, die im Geiste Dome zertrümmert, um dann in die Natur hinauszufliehen und das einsame ‚Kreuz im Gebirge’ zu malen!” (Hans Carl von Haebler).
 Der „im Geiste Dome zertrümmert”, ist Caspar David Friedrich. Gern verwendet er das Motiv einer verfallenen Kirche, ja den noch heute unversehrten Meißener Dom malte er ebenso wie die Jakobikirche zu Greifswald als Ruine. Selbst gab er dazu den Kommentar: „Die Zeit der Herrlichkeit des Tempels und seiner Diener ist dahin und aus dem zertrümmerten Ganzen eine andere Zeit und anderes Verlangen nach Klarheit und Wahrheit hervorgegangen.” Der „im Geiste Dome zertrümmert”, ist Caspar David Friedrich. Gern verwendet er das Motiv einer verfallenen Kirche, ja den noch heute unversehrten Meißener Dom malte er ebenso wie die Jakobikirche zu Greifswald als Ruine. Selbst gab er dazu den Kommentar: „Die Zeit der Herrlichkeit des Tempels und seiner Diener ist dahin und aus dem zertrümmerten Ganzen eine andere Zeit und anderes Verlangen nach Klarheit und Wahrheit hervorgegangen.”
 Der Kruzifixus, den Friedrich auf dem tannenumsäumten Felsen aufrichtet, hat mit den Gottesgestalten, die ihre Macht über die abendländische Kunst bis in die Spätzeit des Barock ausübten, nichts mehr zu tun. Die Gestaltwelt des Mittelalters ist auch für Friedrich zerbrochen. Die Deutung, die Friedrich selbst dem Tetschener Altar gibt, trägt die Züge ängstlicher Apologie. Doch treten auch in diesem Bild, seinem wohl frühesten Ölbild, jene Elemente nahezu in Reinheit in Erscheinung, die schon als die Friedrich eigentümliche Anschauungsform erkannt wurden. Da wird der Betrachter irritiert durch den Kontrast von nächster Nähe und weitester Ferne. Von noch keiner modernen Theorie aperspektivischen Schauens belastet, hat Friedrich mit Hilfe ausgeprägten Form- und Stilwillens die perspektivische Raumkonstruktion auf überraschend einfache Weise verlassen. Die als Dreieck komponierte silhouettenhafte untere Bildzone, die im Kreuz gipfelt und noch einen Rest räumlicher Meßbarkeit aufweist, ist auf einen unbegrenzten Hintergrund aufgeschichtet, der ähnlich irrationalen Charakter hat wie der Goldgrund mittelalterlicher Bilder. Verstärkt wird der Eindruck des Abstrakten und Strukturellen, der schon in der rhythmischen Anordnung von Kreuz und Fichtenstämmen in Erscheinung tritt, durch die Licht- und Nebelmotive des Hintergrundes. Das Farblicht scheint aus der Tiefe des Bildraumes oder - nach einem Wort von Cézanne - „von den Wurzeln der Welt” aufzusteigen. „Überall wo der Mensch wandelt, ist sein Auge so gestellt, daß er das himmlische und irdische Element mit einem Blick auffassen muß”, sagt Adam Müller zu Friedrichs Bildern. Der Kruzifixus, den Friedrich auf dem tannenumsäumten Felsen aufrichtet, hat mit den Gottesgestalten, die ihre Macht über die abendländische Kunst bis in die Spätzeit des Barock ausübten, nichts mehr zu tun. Die Gestaltwelt des Mittelalters ist auch für Friedrich zerbrochen. Die Deutung, die Friedrich selbst dem Tetschener Altar gibt, trägt die Züge ängstlicher Apologie. Doch treten auch in diesem Bild, seinem wohl frühesten Ölbild, jene Elemente nahezu in Reinheit in Erscheinung, die schon als die Friedrich eigentümliche Anschauungsform erkannt wurden. Da wird der Betrachter irritiert durch den Kontrast von nächster Nähe und weitester Ferne. Von noch keiner modernen Theorie aperspektivischen Schauens belastet, hat Friedrich mit Hilfe ausgeprägten Form- und Stilwillens die perspektivische Raumkonstruktion auf überraschend einfache Weise verlassen. Die als Dreieck komponierte silhouettenhafte untere Bildzone, die im Kreuz gipfelt und noch einen Rest räumlicher Meßbarkeit aufweist, ist auf einen unbegrenzten Hintergrund aufgeschichtet, der ähnlich irrationalen Charakter hat wie der Goldgrund mittelalterlicher Bilder. Verstärkt wird der Eindruck des Abstrakten und Strukturellen, der schon in der rhythmischen Anordnung von Kreuz und Fichtenstämmen in Erscheinung tritt, durch die Licht- und Nebelmotive des Hintergrundes. Das Farblicht scheint aus der Tiefe des Bildraumes oder - nach einem Wort von Cézanne - „von den Wurzeln der Welt” aufzusteigen. „Überall wo der Mensch wandelt, ist sein Auge so gestellt, daß er das himmlische und irdische Element mit einem Blick auffassen muß”, sagt Adam Müller zu Friedrichs Bildern.
 Und so läßt sich gerade an diesem Bild die Eigengesetzlichkeit des Kunstwerkes dartun, die nicht mit der persönlichen Subjektivität des Künstlers zu verwechseln ist. Friedrich ist Christ. Sein Werk lebt aus der Kraft christlicher Grundbefindlichkeit. Sein Bild aber lebt, wie jedes wahre Kunstwerk, nicht durch den dargestellten Inhalt, sondern durch die Einbildungskraft, aus der es entstanden ist und in der sich die Welt spiegelt. Was sonst wäre das künstlerische Ingenium? So leben auch die großen Kunstwerke des Mittelalters, die wir so sehr bewundern, nicht durch den Inhalt der dargestellten Gottesgestalten, sondern aus der jedem wahren Kunstwerk eigentümlichen Kraft der Anschauung des Universalen, das sich in der Weltstunde des Mittelalters gestalthaft verdichtete. Gerade darum sind ja für uns die großen Bildwerke mittelalterlicher Kirchenkunst bis heute lebendig geblieben und werden es bleiben. Und wenn wir diesen eigentlichen Grund ihrer Größe empfinden und bejahen, werden wir auch wieder ihrer glaubensmäßigen Kraft, die sie für den mittelalterlichen Menschen gehabt haben, ansichtig werden, die schon seit langem ins Ästhetische verharmlost wird, zumal dort, wo diese Bilder aus ihrem Zusammenhang im kirchlichen Raum herausgebrochen sind. Nicht anders dürfen wir mit Friedrichs Bildern verfahren, sofern wir seinem Werk künstlerische Qualität zubilligen. Friedrich zerstört traditionelle christliche Vorstellungen weder aus Lust an der Negation noch im Nachvollzug philosophischer Überlegungen der zeitgenössischen Romantiker, sondern aus dem Widerfahrnis, dem seine künstlerische Einbildungskraft ihn ausgesetzt hat. Aber darin liegt doch seine Größe, daß er nicht allein die Brüchigkeit und Hinfälligkeit überlebter Vorstellungen sichtbar machte, sondern daß er zur gleichen Zeit den universalen Anschauungs- und Erfahrensbereich bildnerisch ans Licht brachte, in dem sich christlicher Glaube seit dem 19. Jahrhundert neu ansiedeln, menschlich erweisen und theologisch formulieren muß. Und so läßt sich gerade an diesem Bild die Eigengesetzlichkeit des Kunstwerkes dartun, die nicht mit der persönlichen Subjektivität des Künstlers zu verwechseln ist. Friedrich ist Christ. Sein Werk lebt aus der Kraft christlicher Grundbefindlichkeit. Sein Bild aber lebt, wie jedes wahre Kunstwerk, nicht durch den dargestellten Inhalt, sondern durch die Einbildungskraft, aus der es entstanden ist und in der sich die Welt spiegelt. Was sonst wäre das künstlerische Ingenium? So leben auch die großen Kunstwerke des Mittelalters, die wir so sehr bewundern, nicht durch den Inhalt der dargestellten Gottesgestalten, sondern aus der jedem wahren Kunstwerk eigentümlichen Kraft der Anschauung des Universalen, das sich in der Weltstunde des Mittelalters gestalthaft verdichtete. Gerade darum sind ja für uns die großen Bildwerke mittelalterlicher Kirchenkunst bis heute lebendig geblieben und werden es bleiben. Und wenn wir diesen eigentlichen Grund ihrer Größe empfinden und bejahen, werden wir auch wieder ihrer glaubensmäßigen Kraft, die sie für den mittelalterlichen Menschen gehabt haben, ansichtig werden, die schon seit langem ins Ästhetische verharmlost wird, zumal dort, wo diese Bilder aus ihrem Zusammenhang im kirchlichen Raum herausgebrochen sind. Nicht anders dürfen wir mit Friedrichs Bildern verfahren, sofern wir seinem Werk künstlerische Qualität zubilligen. Friedrich zerstört traditionelle christliche Vorstellungen weder aus Lust an der Negation noch im Nachvollzug philosophischer Überlegungen der zeitgenössischen Romantiker, sondern aus dem Widerfahrnis, dem seine künstlerische Einbildungskraft ihn ausgesetzt hat. Aber darin liegt doch seine Größe, daß er nicht allein die Brüchigkeit und Hinfälligkeit überlebter Vorstellungen sichtbar machte, sondern daß er zur gleichen Zeit den universalen Anschauungs- und Erfahrensbereich bildnerisch ans Licht brachte, in dem sich christlicher Glaube seit dem 19. Jahrhundert neu ansiedeln, menschlich erweisen und theologisch formulieren muß.
 Die neuere Friedrich-Deutung, deren Ansatzpunkt das richtige Empfinden ist, daß sein Werk den Beginn einer künstlerischen und geistigen Epoche signalisiert, die über die Gegenwart hinaus in eine noch undefinierte Zukunft reicht, scheint indes noch oft genug überholte Maßstäbe anzulegen, so wenn sie in seinen Bildern eine Kompilation christlicher Einzelsymbole zu entdecken meint. Erst aus einer Gesamtanschauung von Friedrichs Werk heraus wird man wohl noch wesentliche Elemente aufspüren und aufweisen können, die für einen in Verantwortung gelebten christlichen Glauben künftig unentbehrlich sind. So ist schon Friedrich nicht fremd geblieben und in seinem Werk leicht nachweisbar jene Erfahrung von Zeit, durch die das Denken der Gegenwart von der christlichen Eschatologie wie von den Erkenntnissen der modernen Physik seine Impulse und eine neue Richtung bekommen hat. Das ist erkennbar in der Rhythmik als einem wichtigen formalen Element in Friedrichs Bildern. Davon sprechen die Darstellungen der Jahres- und Tageszeiten ebenso wie die Hünengräber- und Friedhofsbilder, die formal von der gleichen Tendenz zur aperspektivischen Weltsicht und zur Abstraktion beherrscht sind wie die großen Landschaftsbilder. Sie kreisen um den Glauben an die Auferstehung, die für Friedrich wie für den Menschen der Gegenwart zur Existenzfrage geworden ist. Die neuere Friedrich-Deutung, deren Ansatzpunkt das richtige Empfinden ist, daß sein Werk den Beginn einer künstlerischen und geistigen Epoche signalisiert, die über die Gegenwart hinaus in eine noch undefinierte Zukunft reicht, scheint indes noch oft genug überholte Maßstäbe anzulegen, so wenn sie in seinen Bildern eine Kompilation christlicher Einzelsymbole zu entdecken meint. Erst aus einer Gesamtanschauung von Friedrichs Werk heraus wird man wohl noch wesentliche Elemente aufspüren und aufweisen können, die für einen in Verantwortung gelebten christlichen Glauben künftig unentbehrlich sind. So ist schon Friedrich nicht fremd geblieben und in seinem Werk leicht nachweisbar jene Erfahrung von Zeit, durch die das Denken der Gegenwart von der christlichen Eschatologie wie von den Erkenntnissen der modernen Physik seine Impulse und eine neue Richtung bekommen hat. Das ist erkennbar in der Rhythmik als einem wichtigen formalen Element in Friedrichs Bildern. Davon sprechen die Darstellungen der Jahres- und Tageszeiten ebenso wie die Hünengräber- und Friedhofsbilder, die formal von der gleichen Tendenz zur aperspektivischen Weltsicht und zur Abstraktion beherrscht sind wie die großen Landschaftsbilder. Sie kreisen um den Glauben an die Auferstehung, die für Friedrich wie für den Menschen der Gegenwart zur Existenzfrage geworden ist.
„Warum, die Frag ist oft an mich ergangen,
Wählst du zum Gegenstand der Malerei
So oft den Tod, Vergänglichkeit und Grab?
Um ewig einst zu leben,
Muß man sich oft dem Tod ergeben.”
 In dem vor zwanzig Jahren von Günther Howe veranlaßten Gespräch zwischen Kunsthistorikern und Theologen wurde das Ende der christlichen Gottesgestalten in der Kunst des Abendlandes konstatiert. Wie wäre es aber, wenn sich in einer Wiederaufnahme dieses Gespräches herausstellte, daß sich zugleich mit diesem Ende der Beginn einer neuen künstlerischen Verwirklichung ankündigte, und daß ein Werk wie das von Caspar David Friedrich im Bezugsrahmen einer solchen Sicht neu entdeckt wird? Dann dürfte man nicht nur von einer kunstgeschichtlichen Renaissance seiner Werke, sondern von der Wiederkehr des Caspar David Friedrich sprechen In dem vor zwanzig Jahren von Günther Howe veranlaßten Gespräch zwischen Kunsthistorikern und Theologen wurde das Ende der christlichen Gottesgestalten in der Kunst des Abendlandes konstatiert. Wie wäre es aber, wenn sich in einer Wiederaufnahme dieses Gespräches herausstellte, daß sich zugleich mit diesem Ende der Beginn einer neuen künstlerischen Verwirklichung ankündigte, und daß ein Werk wie das von Caspar David Friedrich im Bezugsrahmen einer solchen Sicht neu entdeckt wird? Dann dürfte man nicht nur von einer kunstgeschichtlichen Renaissance seiner Werke, sondern von der Wiederkehr des Caspar David Friedrich sprechen
Quatember 1974, S. 216-224
|