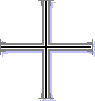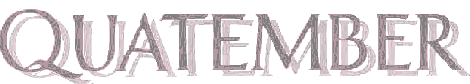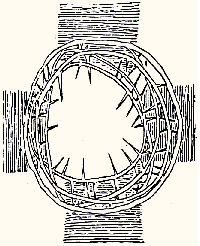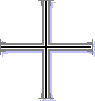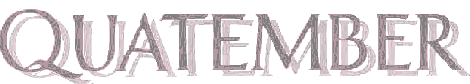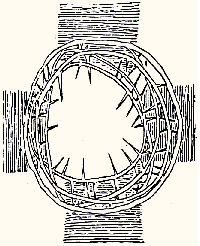Es war kein Spektakulum, das Treffen vom 13. bis zum 15. Oktober im Berneuchener Haus - obwohl immer wieder die Fernsehkamera mitlief und der Südwestfunk schon wenige Tage danach ausführlich darüber berichtete. Die ARD strahlte am Abend des 31. Oktober eine Dokumentation über das Echo aus, das Carl Friedrich von Weizsäckers Vorschlag vom Düsseldorfer Kirchentag bis jetzt gefunden hat, und in dieser Sendung nahm der Bericht über das Gespräch im Berneuchener Haus den breitesten Raum ein. Und doch war es mehr, sehr viel mehr als ein bloßer Gedankenaustausch über ethische und politische Fragen. Landesbischof Stier, der den Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR vertrat, brachte den Eindruck vieler, vielleicht sogar der meisten Teilnehmer auf den Begriff, als er die Formel vom „konziliaren Prozeß” mit den Worten des Dresdener Stadtökumenekreises verdolmetschte: „Einladung zum gemeinsamen Weg.” In der Tat waren die über einhundert Männer und Frauen in Kirchberg zusammengekommen, um gemeinsam Schritte zu tun - auf das Ziel zu, das der junge Dietrich Bonhoeffer im Jahr 1934 steckte, als er seinen Mitchristen in Fanö den „Ruf zum Frieden” zumutete. „Die Stunde eilt”, sagte er damals in seiner Auslegung von Ps. 85,9 - aber fünf Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus. Es war kein Spektakulum, das Treffen vom 13. bis zum 15. Oktober im Berneuchener Haus - obwohl immer wieder die Fernsehkamera mitlief und der Südwestfunk schon wenige Tage danach ausführlich darüber berichtete. Die ARD strahlte am Abend des 31. Oktober eine Dokumentation über das Echo aus, das Carl Friedrich von Weizsäckers Vorschlag vom Düsseldorfer Kirchentag bis jetzt gefunden hat, und in dieser Sendung nahm der Bericht über das Gespräch im Berneuchener Haus den breitesten Raum ein. Und doch war es mehr, sehr viel mehr als ein bloßer Gedankenaustausch über ethische und politische Fragen. Landesbischof Stier, der den Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR vertrat, brachte den Eindruck vieler, vielleicht sogar der meisten Teilnehmer auf den Begriff, als er die Formel vom „konziliaren Prozeß” mit den Worten des Dresdener Stadtökumenekreises verdolmetschte: „Einladung zum gemeinsamen Weg.” In der Tat waren die über einhundert Männer und Frauen in Kirchberg zusammengekommen, um gemeinsam Schritte zu tun - auf das Ziel zu, das der junge Dietrich Bonhoeffer im Jahr 1934 steckte, als er seinen Mitchristen in Fanö den „Ruf zum Frieden” zumutete. „Die Stunde eilt”, sagte er damals in seiner Auslegung von Ps. 85,9 - aber fünf Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus.
 C. F. von Weizsäcker, der gemeinsam mit Dekan i. R. Konrat Weymann zu diesem Gespräch eingeladen hatte, sagte es auf seine Weise: „Die Zeit drängt.” Eine in Vollmacht redende Versammlung der Christenheit, ein „Konzil”, das die in Friedlosigkeit, Unrecht und Schöpfungsvergessenheit gefangene Welt mit der Botschaft vom Friedens-Willen Gottes konfrontiert, werde zustandekommen, wenn man es wirklich will. Sollte es zu spät oder gar nicht zustandekommen, dann nur deshalb, weil man nicht entschieden genug darauf zugegangen ist, „weil man gedacht hat, Gott werde mit unserer Unentschlossenheit ja wohl noch Geduld haben. Dieser Gedanke freilich könnte sich als Irrtum erweisen.” Der auf den ersten Blick ein wenig umständlich anmutende Titel auf der Einladung („Ökumenisches Gespräch innerhalb der Vorüberlegungen zum ‚Konzil des Friedens’”) spiegelt bereits etwas von der Behutsamkeit, die der kleine Leitungskreis für das Zusammensein als notwendig erachtete. C. F. von Weizsäcker, der gemeinsam mit Dekan i. R. Konrat Weymann zu diesem Gespräch eingeladen hatte, sagte es auf seine Weise: „Die Zeit drängt.” Eine in Vollmacht redende Versammlung der Christenheit, ein „Konzil”, das die in Friedlosigkeit, Unrecht und Schöpfungsvergessenheit gefangene Welt mit der Botschaft vom Friedens-Willen Gottes konfrontiert, werde zustandekommen, wenn man es wirklich will. Sollte es zu spät oder gar nicht zustandekommen, dann nur deshalb, weil man nicht entschieden genug darauf zugegangen ist, „weil man gedacht hat, Gott werde mit unserer Unentschlossenheit ja wohl noch Geduld haben. Dieser Gedanke freilich könnte sich als Irrtum erweisen.” Der auf den ersten Blick ein wenig umständlich anmutende Titel auf der Einladung („Ökumenisches Gespräch innerhalb der Vorüberlegungen zum ‚Konzil des Friedens’”) spiegelt bereits etwas von der Behutsamkeit, die der kleine Leitungskreis für das Zusammensein als notwendig erachtete.
 Und in der Tat stand am Anfang nicht ein Grundsatzreferat oder die Diskussion vorgegebener Thesen, sondern der Versuch, exemplarisch etwas von den Erwartungen der Teilnehmer selbst laut werden zu lassen. Die innere Spannweite dieser ersten Voten war so groß wie die Unterschiede in der Herkunft der Sprecher: Da sprach der politisch engagierte französische Hochschullehrer (als „Bürger eines Landes, das zu den größten Waffenproduzenten und -verkäufern gehört”, und in dem diejenigen, die das nicht billigen können, sich als „lächerliche Minderheit” fühlen), aber neben ihm stand der deutsche Bundeswehrgeneral mit seinen nicht weniger vom Glauben bewegten Fragen an seine Mitchristen. Da äußerte sich der von Church and Peace herkommende Sprecher der friedenskirchlichen Tradition und der Repräsentant der orthodoxen Kirche Rumäniens, da stand die württembergische Synodale neben dem mecklenburgischen Landesbischof und der tschechische Protestant von der „Christlichen Friedenskonferenz” neben dem altkatholischen Bischof aus der Bundesrepublik Deutschland. Und in der Tat stand am Anfang nicht ein Grundsatzreferat oder die Diskussion vorgegebener Thesen, sondern der Versuch, exemplarisch etwas von den Erwartungen der Teilnehmer selbst laut werden zu lassen. Die innere Spannweite dieser ersten Voten war so groß wie die Unterschiede in der Herkunft der Sprecher: Da sprach der politisch engagierte französische Hochschullehrer (als „Bürger eines Landes, das zu den größten Waffenproduzenten und -verkäufern gehört”, und in dem diejenigen, die das nicht billigen können, sich als „lächerliche Minderheit” fühlen), aber neben ihm stand der deutsche Bundeswehrgeneral mit seinen nicht weniger vom Glauben bewegten Fragen an seine Mitchristen. Da äußerte sich der von Church and Peace herkommende Sprecher der friedenskirchlichen Tradition und der Repräsentant der orthodoxen Kirche Rumäniens, da stand die württembergische Synodale neben dem mecklenburgischen Landesbischof und der tschechische Protestant von der „Christlichen Friedenskonferenz” neben dem altkatholischen Bischof aus der Bundesrepublik Deutschland.

 Und trotzdem zeichnete sich bereits in diesen ersten Stimmen eine gemeinsame Richtung ab: Fragte Frau von Wiedebach-Nostitz nach der Kraft eines Redens vom Frieden, das sich nicht auch im nähesten Lebensbereich bewährt („Wenn wir weiter ungeborenes Leben töten, wird kein Friede!”), so forderte Landesbischof Stier aus der DDR dazu auf, zuerst einmal „im eigenen Haus” der Regionalkirche das zu verwirklichen, „was wir von einer ökumenischen Weltversammlung erwarten”; erinnerte Brigadegeneral von der Recke daran, daß gerade auch „‚Glaubensgewißheit’ sehr unbarmherzig machen kann”, so warnte Bischof Sticher von der Evangelisch-methodistischen Kirche vor Machtkämpfen in der Kirche - ein Gedanke, der durch Kirchenpräsident Spengler (Darmstadt) in der Frage zugespitzt wurde: „Wie lange werden wir die Politiker in unserer Welt noch auf unsere dogmatische Abrüstung warten lassen?” Mit diesem Grundton, der sich durch fast alle Voten des ersten Nachmittags und Abends zog, mit der Frage nach der Glaubwürdigkeit christlichen Denkens und Redens in einer Situation, die verantwortliches Handeln verlangt (Prof. Smolik, Prag) - mit diesem Grundton war der Raum geöffnet, in dem die drei Hauptreferate des zweiten Tages vielleicht intensiver gehört und bedacht werden konnten als ohne diesen Anweg. Und trotzdem zeichnete sich bereits in diesen ersten Stimmen eine gemeinsame Richtung ab: Fragte Frau von Wiedebach-Nostitz nach der Kraft eines Redens vom Frieden, das sich nicht auch im nähesten Lebensbereich bewährt („Wenn wir weiter ungeborenes Leben töten, wird kein Friede!”), so forderte Landesbischof Stier aus der DDR dazu auf, zuerst einmal „im eigenen Haus” der Regionalkirche das zu verwirklichen, „was wir von einer ökumenischen Weltversammlung erwarten”; erinnerte Brigadegeneral von der Recke daran, daß gerade auch „‚Glaubensgewißheit’ sehr unbarmherzig machen kann”, so warnte Bischof Sticher von der Evangelisch-methodistischen Kirche vor Machtkämpfen in der Kirche - ein Gedanke, der durch Kirchenpräsident Spengler (Darmstadt) in der Frage zugespitzt wurde: „Wie lange werden wir die Politiker in unserer Welt noch auf unsere dogmatische Abrüstung warten lassen?” Mit diesem Grundton, der sich durch fast alle Voten des ersten Nachmittags und Abends zog, mit der Frage nach der Glaubwürdigkeit christlichen Denkens und Redens in einer Situation, die verantwortliches Handeln verlangt (Prof. Smolik, Prag) - mit diesem Grundton war der Raum geöffnet, in dem die drei Hauptreferate des zweiten Tages vielleicht intensiver gehört und bedacht werden konnten als ohne diesen Anweg.
 Der Vormittag gehörte ganz Professor von Weizsäcker, der mit seinem frei gehaltenen Vortrag einige Grundgedanken seiner Schrift „Die Zeit drängt” (Carl Hanser Verlag, München und Wien, 1986) kommentierte und entfaltete. Den Hintergrund bildete dabei der entschiedene Wille zur Nüchternheit (einschließlich der Hoffnung, daß das als notwendig Erkannte auch getan werden möge) und die Einsicht, daß die wirkliche Lösung der erkannten Probleme „eine Frage der Gnade” ist - „in unserer Kraft liegt es nicht”. Daß sich die Menschheit „in einer Krise befindet, deren katastrophaler Höhepunkt wahrscheinlich noch vor uns liegt”, illustrierte von Weizsäcker an Themen aus der Ökologie (die Kernenergie und ihr Zusammenhang mit der Kriegsgefahr), aus der um Gerechtigkeit ringenden Politik (die sozialen Probleme der großen Minderheiten, die Aufgabe des kulturellen Ausgleichs, die ungelösten Fragen des Bevölkerungswachstums und des Weltmarktes) und aus dem Fragenkomplex Frieden und Abrüstung. Der Vormittag gehörte ganz Professor von Weizsäcker, der mit seinem frei gehaltenen Vortrag einige Grundgedanken seiner Schrift „Die Zeit drängt” (Carl Hanser Verlag, München und Wien, 1986) kommentierte und entfaltete. Den Hintergrund bildete dabei der entschiedene Wille zur Nüchternheit (einschließlich der Hoffnung, daß das als notwendig Erkannte auch getan werden möge) und die Einsicht, daß die wirkliche Lösung der erkannten Probleme „eine Frage der Gnade” ist - „in unserer Kraft liegt es nicht”. Daß sich die Menschheit „in einer Krise befindet, deren katastrophaler Höhepunkt wahrscheinlich noch vor uns liegt”, illustrierte von Weizsäcker an Themen aus der Ökologie (die Kernenergie und ihr Zusammenhang mit der Kriegsgefahr), aus der um Gerechtigkeit ringenden Politik (die sozialen Probleme der großen Minderheiten, die Aufgabe des kulturellen Ausgleichs, die ungelösten Fragen des Bevölkerungswachstums und des Weltmarktes) und aus dem Fragenkomplex Frieden und Abrüstung.
 Es ist nicht sinnvoll, im Rahmen dieses kurzen Berichtes die Wege nachzuzeichnen, auf denen der Philosoph und Analytiker der Weltsituation die Herkunft unserer heutigen Probleme beschrieb und deutete. Aber da fielen Sätze, die gerade wegen ihres Begründungszusammenhanges ein Gewicht erhielten, welches dem Hörer kein Vergessen und kein Verdrängen mehr ermöglicht: „... Wir sind in der Gefahr, die Existenzbasis der Pflanzen, Tiere und Menschen im Ablauf einiger Jahrzehnte zu zerstören ... Ich bin noch heute nicht der Meinung, daß in einer friedlichen Welt die Kernenergie in ihren technischen Problemen nicht beherrscht werden könnte. Aber die Meinung, das Schicksal werde dafür sorgen, daß dort, wo Reaktoren und Wiederaufarbeitungsanlagen stehen, niemals Krieg geführt werden wird, die habe ich nicht. Und unter diesen Umständen kann ich nicht mit gutem Gewissen für Kernenergieanlagen eintreten... Die Atomwaffe ist das Weckersignal, das uns gebietet aufzuwachen und die Institution des Krieges zu überwinden ... Ich weiß nicht, wie das heute geschehen wird; das Wahrscheinliche ist, daß es nicht geschehen wird... Aber das ist die gestellte Aufgabe.” Es ist nicht sinnvoll, im Rahmen dieses kurzen Berichtes die Wege nachzuzeichnen, auf denen der Philosoph und Analytiker der Weltsituation die Herkunft unserer heutigen Probleme beschrieb und deutete. Aber da fielen Sätze, die gerade wegen ihres Begründungszusammenhanges ein Gewicht erhielten, welches dem Hörer kein Vergessen und kein Verdrängen mehr ermöglicht: „... Wir sind in der Gefahr, die Existenzbasis der Pflanzen, Tiere und Menschen im Ablauf einiger Jahrzehnte zu zerstören ... Ich bin noch heute nicht der Meinung, daß in einer friedlichen Welt die Kernenergie in ihren technischen Problemen nicht beherrscht werden könnte. Aber die Meinung, das Schicksal werde dafür sorgen, daß dort, wo Reaktoren und Wiederaufarbeitungsanlagen stehen, niemals Krieg geführt werden wird, die habe ich nicht. Und unter diesen Umständen kann ich nicht mit gutem Gewissen für Kernenergieanlagen eintreten... Die Atomwaffe ist das Weckersignal, das uns gebietet aufzuwachen und die Institution des Krieges zu überwinden ... Ich weiß nicht, wie das heute geschehen wird; das Wahrscheinliche ist, daß es nicht geschehen wird... Aber das ist die gestellte Aufgabe.”

 Die Frage nach der Herkunft der Probleme - Weizsäcker suchte sie in einem aufregenden Exkurs zur Geschichte der Hochkulturen zu beantworten - leitete über zu dem, was in seinen Augen den einzigen Schlüssel zu gelingender Zukunft der Gattung Mensch darstellt: die Wahrnehmung von Traditionen, die von der alttestamentlichen Prophetie und von der Bergpredigt Jesu her in der Christenheit bewahrt und immer wieder neu artikuliert worden sind. Wo „die Macht luxuriert” und „jeder noch stärker sein möchte, als er schon ist”, da ist die Einsicht in den Willen Gottes gefordert - die Einsicht, daß die Spontaneität der Liebe nicht an den Grenzen der je eigenen Gruppe haltmachen darf. Dies war die Bedingung dafür, daß Israel leben konnte, es ist auch die Bedingung unseres Überlebens. An dieser Gewißheit entzündet sich für Weizsäcker der Impuls hin auf eine gemeinsame christliche Friedenstheologie. „Sie wird erstmals seit 1700 Jahren möglich”, und ihre Rahmenbedingung ist, daß „die politische Institution des Krieges überwunden werden muß und kann: kann, weil sie muß.” Die damit verbundene Forderung des „Verzichts der Staaten auf das Souveränitätsrecht des Krieges” ist allerdings ein Ziel, das in unüberwindlicher Spannung zu der Situation zu stehen scheint, die seit Konstantin das Leben der Christen bestimmt: als „Herren der unerlösten Welt” politische Verantwortung zu tragen und „mit den Mitteln der Gewalt dem Elend in der Welt zu steuern”. Die Frage nach der Herkunft der Probleme - Weizsäcker suchte sie in einem aufregenden Exkurs zur Geschichte der Hochkulturen zu beantworten - leitete über zu dem, was in seinen Augen den einzigen Schlüssel zu gelingender Zukunft der Gattung Mensch darstellt: die Wahrnehmung von Traditionen, die von der alttestamentlichen Prophetie und von der Bergpredigt Jesu her in der Christenheit bewahrt und immer wieder neu artikuliert worden sind. Wo „die Macht luxuriert” und „jeder noch stärker sein möchte, als er schon ist”, da ist die Einsicht in den Willen Gottes gefordert - die Einsicht, daß die Spontaneität der Liebe nicht an den Grenzen der je eigenen Gruppe haltmachen darf. Dies war die Bedingung dafür, daß Israel leben konnte, es ist auch die Bedingung unseres Überlebens. An dieser Gewißheit entzündet sich für Weizsäcker der Impuls hin auf eine gemeinsame christliche Friedenstheologie. „Sie wird erstmals seit 1700 Jahren möglich”, und ihre Rahmenbedingung ist, daß „die politische Institution des Krieges überwunden werden muß und kann: kann, weil sie muß.” Die damit verbundene Forderung des „Verzichts der Staaten auf das Souveränitätsrecht des Krieges” ist allerdings ein Ziel, das in unüberwindlicher Spannung zu der Situation zu stehen scheint, die seit Konstantin das Leben der Christen bestimmt: als „Herren der unerlösten Welt” politische Verantwortung zu tragen und „mit den Mitteln der Gewalt dem Elend in der Welt zu steuern”.
 Carl Friedrich von Weizsäcker blieb gegenüber diesem Dilemma seine eigene Position nicht schuldig - eine Position, die sich noch an der achten der 1959 mit Günter Howe erarbeiteten elf Heidelberger Thesen orientiert: „Die Kirche muß die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in Freiheit zu sichern, als eine heute noch mögliche christliche Handlungsweise anerkennen.” Im Rückblick auf diese These also, sagte von Weizsäcker: „Ich bin überzeugt, daß die Schaffung des Weltfriedens die Forderung ist, und derjenige, der heute schon so zu leben sucht, wie man dann wird leben müssen, gewaltlos, der muß die Billigung der Kirche haben. Die Kirche darf das nicht verwerfen. Aber denjenigen, der glaubt, er könne das Interim durch den weiteren Besitz von Waffen schützen, bis eine bessere Lösung gefunden ist (wofür nur wenige Jahrzehnte Zeit ist!), den werde ich nicht als christlichen Bruder verwerfen.” Carl Friedrich von Weizsäcker blieb gegenüber diesem Dilemma seine eigene Position nicht schuldig - eine Position, die sich noch an der achten der 1959 mit Günter Howe erarbeiteten elf Heidelberger Thesen orientiert: „Die Kirche muß die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in Freiheit zu sichern, als eine heute noch mögliche christliche Handlungsweise anerkennen.” Im Rückblick auf diese These also, sagte von Weizsäcker: „Ich bin überzeugt, daß die Schaffung des Weltfriedens die Forderung ist, und derjenige, der heute schon so zu leben sucht, wie man dann wird leben müssen, gewaltlos, der muß die Billigung der Kirche haben. Die Kirche darf das nicht verwerfen. Aber denjenigen, der glaubt, er könne das Interim durch den weiteren Besitz von Waffen schützen, bis eine bessere Lösung gefunden ist (wofür nur wenige Jahrzehnte Zeit ist!), den werde ich nicht als christlichen Bruder verwerfen.”
 Allerdings fuhr von Weizsäcker dann fort: „Die These zu benutzen um zu sagen: ‚Die Abschreckung schützt uns ja, und der Friedensdienst besteht darin, diese Garantie aufrechtzuerhalten’, das ist ein Irrtum, das ist Selbstbelügung. Sie schützt uns noch ein kleines Weilchen - mehr nicht.” Als mindestens ebenso gewichtig wie solch ein klares Wort empfanden wohl alle die Verknüpfung dieser Stellungnahme mit dem Hirtenwort der amerikanischen katholischen Bischöfe von 1983, das - mit der Lehre vom „Gerechten Krieg” argumentierend -zu gleichen Schlußfolgerungen kommt. Allerdings fuhr von Weizsäcker dann fort: „Die These zu benutzen um zu sagen: ‚Die Abschreckung schützt uns ja, und der Friedensdienst besteht darin, diese Garantie aufrechtzuerhalten’, das ist ein Irrtum, das ist Selbstbelügung. Sie schützt uns noch ein kleines Weilchen - mehr nicht.” Als mindestens ebenso gewichtig wie solch ein klares Wort empfanden wohl alle die Verknüpfung dieser Stellungnahme mit dem Hirtenwort der amerikanischen katholischen Bischöfe von 1983, das - mit der Lehre vom „Gerechten Krieg” argumentierend -zu gleichen Schlußfolgerungen kommt.
 Das zweite Referat, gehalten von Bundesminister a. D. Erhard Eppler, zielte dann ganz präzise auf „denkbare Inhalte eines konziliaren Prozesses”. Hatte bereits von Weizsäcker die Versuchung angesprochen, sich bei einem Konzil „entweder auf leidenschaftliche oder auf fromm-nichtssagende Formeln zu einigen” (und beide müßten „im Detail konsequenzlos bleiben”), so stellte Eppler an den Anfang den Hinweis auf die Gefahr, daß das Konzil „repräsentativ, jedoch nicht eindeutig, oder aber eindeutig, jedoch nicht repräsentativ” sein könnte. Dieser Gefahr müsse um so entschiedener gewehrt werden, wenn man daran denkt, was sich seit der Formulierung der Heidelberger Thesen politisch abgespielt hat: Das zweite Referat, gehalten von Bundesminister a. D. Erhard Eppler, zielte dann ganz präzise auf „denkbare Inhalte eines konziliaren Prozesses”. Hatte bereits von Weizsäcker die Versuchung angesprochen, sich bei einem Konzil „entweder auf leidenschaftliche oder auf fromm-nichtssagende Formeln zu einigen” (und beide müßten „im Detail konsequenzlos bleiben”), so stellte Eppler an den Anfang den Hinweis auf die Gefahr, daß das Konzil „repräsentativ, jedoch nicht eindeutig, oder aber eindeutig, jedoch nicht repräsentativ” sein könnte. Dieser Gefahr müsse um so entschiedener gewehrt werden, wenn man daran denkt, was sich seit der Formulierung der Heidelberger Thesen politisch abgespielt hat:

 An die Stelle einer Philosophie von Abschreckung und Selbstabschreckung (mit der Alternative „Gemeinsam leben oder gemeinsam sterben”), trat mehr und mehr das Konzept der je eigenen Unverwundbarkeit - doch „der unverwundbare Herr der Bombe wäre der Herr über diesen Erdball”. Das aber könne keine Seite der anderen zubilligen, und darum trachte man nach „permanenter Verfeinerung atomarer Waffen zu dem Zweck, den atomaren Krieg wieder begrenzbar, führbar und sogar gewinnbar zu machen. Dies war für die Verfasser der Heidelberger Thesen ... 1959 noch unvorstellbar.” Welche Fragen werden uns im Gespräch über diesen Erfahrungs- und Denkzusammenhang gemeinsam weiterbringen? Der Referent versuchte im Hauptteil seiner Ausführungen mit sieben Problemstellungen etwas „vom Rahmen der Wirklichkeit abzustecken, auf die sich eine Theologie des Friedens beziehen könnte”. An die Stelle einer Philosophie von Abschreckung und Selbstabschreckung (mit der Alternative „Gemeinsam leben oder gemeinsam sterben”), trat mehr und mehr das Konzept der je eigenen Unverwundbarkeit - doch „der unverwundbare Herr der Bombe wäre der Herr über diesen Erdball”. Das aber könne keine Seite der anderen zubilligen, und darum trachte man nach „permanenter Verfeinerung atomarer Waffen zu dem Zweck, den atomaren Krieg wieder begrenzbar, führbar und sogar gewinnbar zu machen. Dies war für die Verfasser der Heidelberger Thesen ... 1959 noch unvorstellbar.” Welche Fragen werden uns im Gespräch über diesen Erfahrungs- und Denkzusammenhang gemeinsam weiterbringen? Der Referent versuchte im Hauptteil seiner Ausführungen mit sieben Problemstellungen etwas „vom Rahmen der Wirklichkeit abzustecken, auf die sich eine Theologie des Friedens beziehen könnte”.
 An den Anfang stellte Erhard Eppler die Frage nach der Möglichkeit eines durch Menschen verschuldeten atomaren Winters. Was bedeutet diese Möglichkeit für eine christliche Lehre vom Frieden? Was bedeutet es, daß auch nur die Explosion eines kleinen Teiles der atomaren Bestände genügen würde, um den Wechsel von „Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht” zu beenden? „Wir haben darüber Rechenschaft abzulegen”, sagte Eppler. „Dürfen sich Christen... an der Vorbereitung eines Krieges beteiligen, der zur unterschiedslosen Ausrottung der Menschheit in einer Abfolge von Katastrophen führen kann?” (Und diese Frage gilt auch dann, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Krieges nur mit 5 % anzusetzen wäre - in Wirklichkeit liegt sie erheblich höher.) „Dürfen sie um der Behauptung von Werten willen einen solchen Krieg riskieren, der das Subjekt aller Wertverwirklichung, den Menschen, als Gattung eliminieren kann?” An den Anfang stellte Erhard Eppler die Frage nach der Möglichkeit eines durch Menschen verschuldeten atomaren Winters. Was bedeutet diese Möglichkeit für eine christliche Lehre vom Frieden? Was bedeutet es, daß auch nur die Explosion eines kleinen Teiles der atomaren Bestände genügen würde, um den Wechsel von „Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht” zu beenden? „Wir haben darüber Rechenschaft abzulegen”, sagte Eppler. „Dürfen sich Christen... an der Vorbereitung eines Krieges beteiligen, der zur unterschiedslosen Ausrottung der Menschheit in einer Abfolge von Katastrophen führen kann?” (Und diese Frage gilt auch dann, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Krieges nur mit 5 % anzusetzen wäre - in Wirklichkeit liegt sie erheblich höher.) „Dürfen sie um der Behauptung von Werten willen einen solchen Krieg riskieren, der das Subjekt aller Wertverwirklichung, den Menschen, als Gattung eliminieren kann?”
 Von den übrigen Fragen, die Eppler formulierte, sollen hier nur die letzten wörtlich zitiert sein: Von den übrigen Fragen, die Eppler formulierte, sollen hier nur die letzten wörtlich zitiert sein:
 „Welchen Stellenwert im Leben von Christen kann die Sicherheit haben” („Sicherheit” - securitas - im Sinne der Teilhabe an einem Herrschaftssystem, das sich den „jenseits des Limes” Lebenden nur als potentiell Unterworfenen vorstellen kann) ? Wir könnten bereits den von Bonhoeffer prognostizierten „Zeitpunkt erreicht haben, wo offenbar wird: Summa securitas est summa insecuritas (Höchste Sicherheit bedeutet höchste Unsicherheit)”. Wenn wir darüber nachdenken und miteinander sprechen, werden wir vielleicht entdecken, „daß wir um so hartnäckiger der römischen securitas nachjagen, je gründlicher uns die christliche certitudo, die Gewißheit der Gotteskindschaft, abhanden gekommen ist”. „Welchen Stellenwert im Leben von Christen kann die Sicherheit haben” („Sicherheit” - securitas - im Sinne der Teilhabe an einem Herrschaftssystem, das sich den „jenseits des Limes” Lebenden nur als potentiell Unterworfenen vorstellen kann) ? Wir könnten bereits den von Bonhoeffer prognostizierten „Zeitpunkt erreicht haben, wo offenbar wird: Summa securitas est summa insecuritas (Höchste Sicherheit bedeutet höchste Unsicherheit)”. Wenn wir darüber nachdenken und miteinander sprechen, werden wir vielleicht entdecken, „daß wir um so hartnäckiger der römischen securitas nachjagen, je gründlicher uns die christliche certitudo, die Gewißheit der Gotteskindschaft, abhanden gekommen ist”.
 „Was heute in der Rüstung geschieht, läßt sich nicht plausibel machen... Was jede Seite der anderen antun kann und im äußersten Fall auch will (sonst wirkt ja keine Abschreckung), ist so furchtbar, daß man es nur Menschen antun kann, die man nur noch als Feinde, zumindest als Werkzeug des bösen Feindes in den Blick bekommt.” Es ist zu fragen: „Dürfen sich dann Christen an der Produktion ideologischer Feindbilder beteiligen?” „Was heute in der Rüstung geschieht, läßt sich nicht plausibel machen... Was jede Seite der anderen antun kann und im äußersten Fall auch will (sonst wirkt ja keine Abschreckung), ist so furchtbar, daß man es nur Menschen antun kann, die man nur noch als Feinde, zumindest als Werkzeug des bösen Feindes in den Blick bekommt.” Es ist zu fragen: „Dürfen sich dann Christen an der Produktion ideologischer Feindbilder beteiligen?”
 „Könnte das Gebot der Feindesliebe als Weg zum Frieden (auch zwischen Staaten und Blöcken) doch mehr bedeuten, als viele Theologen in den letzten 1700 und besonders in den letzten 35 Jahren angenommen haben?” Wenn Feindesliebe nicht ein Gefühl, sondern ein Tun ist (P. Lapide), stellt sich die Frage anders: „Was heißt es, wenn wir dem, den wir für unsern Feind halten oder der sich für unsern Feind hält, so begegnen, daß er die Chance erhält, etwas anderes zu werden als unser Feind - nämlich unser Gegenspieler, unser Rivale, vielleicht schließlich unser Partner bei gemeinsamen Aufgaben? ... Entfeindung beginnt... mit der Annahme des anderen, mit der Annahme seiner Sorgen, seiner Ängste, ja seiner Vorurteile... Vielleicht ist gemeinsame Sicherheit von der gegen den anderen zu errüstenden Sicherheit so fundamental verschieden, daß sich beides nicht mit demselben Begriff benennen läßt.” „Könnte das Gebot der Feindesliebe als Weg zum Frieden (auch zwischen Staaten und Blöcken) doch mehr bedeuten, als viele Theologen in den letzten 1700 und besonders in den letzten 35 Jahren angenommen haben?” Wenn Feindesliebe nicht ein Gefühl, sondern ein Tun ist (P. Lapide), stellt sich die Frage anders: „Was heißt es, wenn wir dem, den wir für unsern Feind halten oder der sich für unsern Feind hält, so begegnen, daß er die Chance erhält, etwas anderes zu werden als unser Feind - nämlich unser Gegenspieler, unser Rivale, vielleicht schließlich unser Partner bei gemeinsamen Aufgaben? ... Entfeindung beginnt... mit der Annahme des anderen, mit der Annahme seiner Sorgen, seiner Ängste, ja seiner Vorurteile... Vielleicht ist gemeinsame Sicherheit von der gegen den anderen zu errüstenden Sicherheit so fundamental verschieden, daß sich beides nicht mit demselben Begriff benennen läßt.”
 Soweit Epplers Fragen. Fast nahtlos schloß sich diesen Überlegungen das Referat des orthodoxen Metropoliten von Minsk und Weißrußland an: „Hoffnung wider alle Hoffnung.” Bei allem Vorbehalt gegen den durch von Weizsäcker ursprünglich benutzten Begriff „Konzil” (nach orthodoxem Verständnis, definieren im „Ökumenischen Konzil” Hirten und Lehrer allein Wahrheiten des Glaubens im engeren Sinne), bejahte er doch nicht nur die Intention, die sich im Vorschlag eines solchen Treffens artikuliert, sondern zeigte, daß im entsprechenden russischen Begriff die wechselseitige Annahme enthalten, ja geradezu gemeint ist. Konziliarität (russ.: sobornost) bezeichnet „eine vielfältige Gesamtheit, eine Gesammeltheit von Denkweisen, die durch Liebe verbunden sind” (so der russische Philosoph und Theolöge Chomjakow, 1804-1860), eine „Vielheit, die durch die Kraft der Liebe in eine freie und organische Ganzheit gesammelt wird”. Bereits Dostojewskij faßt die hier keimhaft enthaltene (von Wladimir Solowjow entfaltete) Idee von der All-Einheit im Bild der wechselseitigen Abhängigkeit: „Alle haben Schuld für alle.” Metropolit Philaret knüpfte an diesen Satz an, als er sagte, „daß alle Menschen in einer geheimnisvollen Einheit, in Solidarität miteinander verbunden sind, die potentiell die Möglichkeit echter Brüderlichkeit enthält”. Soweit Epplers Fragen. Fast nahtlos schloß sich diesen Überlegungen das Referat des orthodoxen Metropoliten von Minsk und Weißrußland an: „Hoffnung wider alle Hoffnung.” Bei allem Vorbehalt gegen den durch von Weizsäcker ursprünglich benutzten Begriff „Konzil” (nach orthodoxem Verständnis, definieren im „Ökumenischen Konzil” Hirten und Lehrer allein Wahrheiten des Glaubens im engeren Sinne), bejahte er doch nicht nur die Intention, die sich im Vorschlag eines solchen Treffens artikuliert, sondern zeigte, daß im entsprechenden russischen Begriff die wechselseitige Annahme enthalten, ja geradezu gemeint ist. Konziliarität (russ.: sobornost) bezeichnet „eine vielfältige Gesamtheit, eine Gesammeltheit von Denkweisen, die durch Liebe verbunden sind” (so der russische Philosoph und Theolöge Chomjakow, 1804-1860), eine „Vielheit, die durch die Kraft der Liebe in eine freie und organische Ganzheit gesammelt wird”. Bereits Dostojewskij faßt die hier keimhaft enthaltene (von Wladimir Solowjow entfaltete) Idee von der All-Einheit im Bild der wechselseitigen Abhängigkeit: „Alle haben Schuld für alle.” Metropolit Philaret knüpfte an diesen Satz an, als er sagte, „daß alle Menschen in einer geheimnisvollen Einheit, in Solidarität miteinander verbunden sind, die potentiell die Möglichkeit echter Brüderlichkeit enthält”.
 Darum konnte der Gast aus der Russischen Orthodoxen Kirche auch das Ziel der erhofften Weltversammlung aus seiner Tradition heraus formulieren: „... die Vereinigung und Aktivierung der christlichen Bemühungen um die Festigung des Friedens auf unserm Planeten, um die Abwendung einer nuklearen Katastrophe und um die Bewahrung der heiligen Gabe des Lebens auf der Erde, um die Schaffung der Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens für alle Menschen.” Weil „der Tod als Zerstörung eine Folge der Sünde und der Entfernung von Gott” ist, werde deutlich, „daß die Frage der Beziehung des Menschen zur heiligen Gabe des Lebens die Grundlagen unseres Glaubens und der christlichen Hoffnung berührt”. Damit aber ist die g a n z e C h r i s t e n h e i t herausgefordert - „eine Erscheinung, die keine Analogie in der Kirchengeschichte hat...” Die Christenheit könnte zur „rettenden Hoffnung” werden „für eine Welt, die - menschlich gesprochen - keine Hoffnung mehr hat”. Darum konnte der Gast aus der Russischen Orthodoxen Kirche auch das Ziel der erhofften Weltversammlung aus seiner Tradition heraus formulieren: „... die Vereinigung und Aktivierung der christlichen Bemühungen um die Festigung des Friedens auf unserm Planeten, um die Abwendung einer nuklearen Katastrophe und um die Bewahrung der heiligen Gabe des Lebens auf der Erde, um die Schaffung der Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens für alle Menschen.” Weil „der Tod als Zerstörung eine Folge der Sünde und der Entfernung von Gott” ist, werde deutlich, „daß die Frage der Beziehung des Menschen zur heiligen Gabe des Lebens die Grundlagen unseres Glaubens und der christlichen Hoffnung berührt”. Damit aber ist die g a n z e C h r i s t e n h e i t herausgefordert - „eine Erscheinung, die keine Analogie in der Kirchengeschichte hat...” Die Christenheit könnte zur „rettenden Hoffnung” werden „für eine Welt, die - menschlich gesprochen - keine Hoffnung mehr hat”.
 Eindrücklich war wohl nicht nur für den Berichterstatter, daß der Metropolit gerade in diesem Zusammenhang an das Gebet erinnerte, in dem wir Christus bitten, „uns von oben her Hilfe zu senden und von dem wir immer hoffen, daß er sich mit seiner Vorsehung in die historischen Schicksale der Welt einmischt”. Und dann das frei gesprochene Nachwort: „Freilich hätten wir größere Hoffnung, wenn Reykjavik anders geendet hätte. Wir fühlen das alle, verstehen es alle, bedauern es alle - aber wir verzweifeln nicht... Wir werden stehen auf unsern Positionen des Evangeliums ... Wir werden das Gewissen aufwecken, vor allem das der Christen. Es ist hier gesagt worden, daß es sehr viele Christen in der Welt gibt. Wo sind sie? Warum schweigen sie? Warum sprechen sie nicht mit ganzer Stimme?” Eindrücklich war wohl nicht nur für den Berichterstatter, daß der Metropolit gerade in diesem Zusammenhang an das Gebet erinnerte, in dem wir Christus bitten, „uns von oben her Hilfe zu senden und von dem wir immer hoffen, daß er sich mit seiner Vorsehung in die historischen Schicksale der Welt einmischt”. Und dann das frei gesprochene Nachwort: „Freilich hätten wir größere Hoffnung, wenn Reykjavik anders geendet hätte. Wir fühlen das alle, verstehen es alle, bedauern es alle - aber wir verzweifeln nicht... Wir werden stehen auf unsern Positionen des Evangeliums ... Wir werden das Gewissen aufwecken, vor allem das der Christen. Es ist hier gesagt worden, daß es sehr viele Christen in der Welt gibt. Wo sind sie? Warum schweigen sie? Warum sprechen sie nicht mit ganzer Stimme?”
 Auch diese notwendigen Fragen - Fragen an uns selber - Fragen, die sich nicht verdrängen lassen. Schon in den abendlichen Gruppengesprächen zeichnete sich dann immer deutlicher ab, was thematisch den letzten Vormittag bestimmen sollte: Wie wird es weitergehen? Wie können Gemeinsamkeiten wachsen? Was können wir selbst tun? Der Heidelberger Theologe Wolfgang Huber war es, der an dieser Stelle ein Stück Wegweisung zu geben vermochte. Er tat es, indem er unter fünf Leitgedanken aus Bonhoeffers Rede von 1934 („Kirche und Völkerwelt”, Ansprache auf der ökumenischen Konferenz in Fanö am 28.8.1934, Gesammelte Schriften I, S. 216-219) die Perspektiven sichtbar machte, die sich für uns Heutige, für unser Denken und für unser Handeln ergeben. Auch diese notwendigen Fragen - Fragen an uns selber - Fragen, die sich nicht verdrängen lassen. Schon in den abendlichen Gruppengesprächen zeichnete sich dann immer deutlicher ab, was thematisch den letzten Vormittag bestimmen sollte: Wie wird es weitergehen? Wie können Gemeinsamkeiten wachsen? Was können wir selbst tun? Der Heidelberger Theologe Wolfgang Huber war es, der an dieser Stelle ein Stück Wegweisung zu geben vermochte. Er tat es, indem er unter fünf Leitgedanken aus Bonhoeffers Rede von 1934 („Kirche und Völkerwelt”, Ansprache auf der ökumenischen Konferenz in Fanö am 28.8.1934, Gesammelte Schriften I, S. 216-219) die Perspektiven sichtbar machte, die sich für uns Heutige, für unser Denken und für unser Handeln ergeben.

| (1) | „Frieden soll sein, weil Christus in der Welt ist” - das bedeutet: Weil Christus versöhnend in die Wirklichkeit der Welt eingegangen ist und allem Opferkult ein Ende gesetzt hat, haben wir keine Möglichkeit mehr, das Böse auf andere zu projizieren und auf Kosten ihres Opfers unser eigenes Leben und das unserer jeweiligen Gemeinschaft zu heilen. Heilung unseres Zusammenlebens geschieht allein dort, wo wir Schuld bekennen und Feindesliebe zu lernen beginnen. |
| (2) | „Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit” - das bedeutet: Die im Evangelium gründende Gewißheit der Gotteskindschaft aller Geschöpfe läßt uns erkennen, daß wir nur gemeinsam den Frieden zu gewinnen vermögen und nicht über die Bedrohung der anderen. Es gilt nicht mehr der Satz: „Ich bin sicher, weil der andere unsicher ist”, sondern wir sind sicher, wo wir gemeinsam lernen, die gegenwärtige Wirklichkeit wahrzunehmen. |
| (3) | „Das ökumenische Konzil ist versammelt.” Was Bonhoeffer als verbindlichste Form kirchlicher Äußerung proklamierte, ist das Modell, an dem wir uns im konziliaren Prozeß zu orientieren haben: beginnend an der Basis der Gemeinde, die sich im Gottesdienst versammelt - hinzielend auf die größtmögliche Gemeinschaft (Ökumene) - die Pluralität der Gesamtkirche ernstnehmend - einig im Willen, der gefundenen Wahrheit Raum zu verschaffen. |
| (4) | „Müssen wir uns von den Heiden im Osten beschämen lassen?” Bonhoeffers damaliger Hinweis auf Gandhi zielt auf die Frage, ob die Option auf die Bergpredigt für uns Christen eigentlich selbst verbindlich ist. Halten wir den gewaltfreien Weg Jesu für verpflichtend? Erkennen wir an, daß er die Option für die Armen und für die Natur einschließt? |
| (5) | „... heute noch - wer weiß, ob wir uns im nächsten Jahr noch wiederfinden?” Das Friedensthema ist konzilsreif, aber die Kirchen sind nicht konzilsfähig.
 Dieser Widerspruch muß uns veranlassen, erste Schritte zu verabreden: in der Hoffnung, daß wir uns noch wiederfinden werden. Dieser Widerspruch muß uns veranlassen, erste Schritte zu verabreden: in der Hoffnung, daß wir uns noch wiederfinden werden. |
 Wolfgang Huber deutete solche Schritte an und gab so den Teilnehmern des Gesprächs Hilfen mit auf den Weg: Wolfgang Huber deutete solche Schritte an und gab so den Teilnehmern des Gesprächs Hilfen mit auf den Weg:
- Es geht darum, „Lernsituationen der Feindesliebe in den Gemeinden” zu schaffen, Situationen, in denen wir lernen, uns mit den Augen des anderen zu sehen; dies „schließt ein, daß ich lerne, wieso ich des anderen Feind bin, wieso er mich als Feind erfährt”;
- es geht um Stärkung der direkten kirchlichen Kontakte über die Blockgrenzen hinweg;
- wir müssen uns darüber verabreden, daß die Klärung unseres Beitrags im konziliaren Prozeß in Gemeinden und Kirchen zum Schwerpunktthema der nächsten zwei Jahre wird.

 Aus der großen Zahl der Voten und Anfragen in der abschließenden Gesprächsrunde - sie wurde wie die gesamte Tagung moderiert von Professor Konrad Raiser und spie gelte etwas von der spannungsreichen Situation in den Gemeinden und Kirchen, im Westen und im Osten -, aus der Fülle dieser Stellungnahmen seien nur vier Stimmen ausgewählt, die auf je eigene Weise zu konkretisieren suchten, was Professor Huber entworfen hatte: Aus der großen Zahl der Voten und Anfragen in der abschließenden Gesprächsrunde - sie wurde wie die gesamte Tagung moderiert von Professor Konrad Raiser und spie gelte etwas von der spannungsreichen Situation in den Gemeinden und Kirchen, im Westen und im Osten -, aus der Fülle dieser Stellungnahmen seien nur vier Stimmen ausgewählt, die auf je eigene Weise zu konkretisieren suchten, was Professor Huber entworfen hatte:
 Ein Ja zur Gewaltfreiheit bedarf der Bereitschaft, daß wir bereits im alltäglichen Umgehen miteinander, an der Basis sozusagen, etwas von dem einüben, was wir in der Eucharistie betend hören: „Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat...” (H. Pickert, Oberst i. G.) Ein Ja zur Gewaltfreiheit bedarf der Bereitschaft, daß wir bereits im alltäglichen Umgehen miteinander, an der Basis sozusagen, etwas von dem einüben, was wir in der Eucharistie betend hören: „Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat...” (H. Pickert, Oberst i. G.)
 Dazu gehört vor allem, daß wir unsere Gesprächspartner nicht „in irgendeine Ecke” stellen, sondern ihnen und damit auch uns selber die Möglichkeit zum Mitgehen mit anderen oder sogar zum Umdenken geben. (K. Weymann) Dazu gehört vor allem, daß wir unsere Gesprächspartner nicht „in irgendeine Ecke” stellen, sondern ihnen und damit auch uns selber die Möglichkeit zum Mitgehen mit anderen oder sogar zum Umdenken geben. (K. Weymann)
 Wo wir aber selbst durch andere mit „Etiketten” versehen werden, ist Apologetik am wenigsten angezeigt; wer sich permanent zu rechtfertigen sucht, gerät in Gefahr sich zu verbiegen. (E. Eppler) Wo wir aber selbst durch andere mit „Etiketten” versehen werden, ist Apologetik am wenigsten angezeigt; wer sich permanent zu rechtfertigen sucht, gerät in Gefahr sich zu verbiegen. (E. Eppler)
 Die Sensibilität der Gemeinde für verstehenden Umgang über die Grenzen hinweg, wächst in der konkreten Arbeit vor Ort - dort, wo wir unmittelbar den „anderen” begegnen, die uns brauchen, zum Beispiel denen, die als Asylsuchende in unser Land kommen. (Bischof S. Kraft) Die Sensibilität der Gemeinde für verstehenden Umgang über die Grenzen hinweg, wächst in der konkreten Arbeit vor Ort - dort, wo wir unmittelbar den „anderen” begegnen, die uns brauchen, zum Beispiel denen, die als Asylsuchende in unser Land kommen. (Bischof S. Kraft)
 In diesen und anderen Hinweisen wurde sichtbar, daß der konziliare Prozeß, der uns hoffentlich in absehbarer Zeit - und rechtzeitig! - auf ein „Konzil”, auf den Punkt vollmächtigen, gemeinsamen und konkreten Bekennens hinführt, nicht eine Sache weniger Repräsentanten der Kirchen sein kann. Dieser Prozeß fordert vielmehr jeden heraus, der sich als Glied am Leibe Christi weiß. Und der Weg, den wir zu gehen haben, wird ein Weg nüchternen Nachdenkens und angstlosen Handelns sein müssen; wir werden ihn nur gehen können, indem wir uns betend und feiernd der Gemeinschaft vergewissern, die uns mit allen Schwestern und Brüdern in der Christenheit verbindet. Solche Gemeinschaft gründet aber in der anderen communio, die er uns schenkte, als er seinen Sohn sandte, „damit die Welt durch ihn gerettet wird” (Joh. 3,17). In diesen und anderen Hinweisen wurde sichtbar, daß der konziliare Prozeß, der uns hoffentlich in absehbarer Zeit - und rechtzeitig! - auf ein „Konzil”, auf den Punkt vollmächtigen, gemeinsamen und konkreten Bekennens hinführt, nicht eine Sache weniger Repräsentanten der Kirchen sein kann. Dieser Prozeß fordert vielmehr jeden heraus, der sich als Glied am Leibe Christi weiß. Und der Weg, den wir zu gehen haben, wird ein Weg nüchternen Nachdenkens und angstlosen Handelns sein müssen; wir werden ihn nur gehen können, indem wir uns betend und feiernd der Gemeinschaft vergewissern, die uns mit allen Schwestern und Brüdern in der Christenheit verbindet. Solche Gemeinschaft gründet aber in der anderen communio, die er uns schenkte, als er seinen Sohn sandte, „damit die Welt durch ihn gerettet wird” (Joh. 3,17).
 Darum wären die Gespräche im Berneuchener Haus so nicht denkbar gewesen ohne die Stundengebete, die uns vom Morgen bis zum Abend begleiteten (die Vesper am 14. Oktober wurde nach orthodoxer Form gehalten); sie wären vollends nicht denkbar gewesen ohne die Eucharistiefeiern zum Tagesbeginn (am Dienstag in der Liturgie der Evangelischen Michaelsbruderschaft, am Mittwoch nach altkatholisch/anglikanischem Ritus). Carl F. von Weizsäcker drückte dies als Ertrag der Kirchberger Tage in seinem Schlußwort aus, als er bekannte, „daß die Ordnung des Lebens in diesem Hause, die erschütternde Erfahrung der gemeinsamen Feier von Brot und Wein... unerläßlich ist dafür, daß wir etwas zuwegebringen”. Darum wären die Gespräche im Berneuchener Haus so nicht denkbar gewesen ohne die Stundengebete, die uns vom Morgen bis zum Abend begleiteten (die Vesper am 14. Oktober wurde nach orthodoxer Form gehalten); sie wären vollends nicht denkbar gewesen ohne die Eucharistiefeiern zum Tagesbeginn (am Dienstag in der Liturgie der Evangelischen Michaelsbruderschaft, am Mittwoch nach altkatholisch/anglikanischem Ritus). Carl F. von Weizsäcker drückte dies als Ertrag der Kirchberger Tage in seinem Schlußwort aus, als er bekannte, „daß die Ordnung des Lebens in diesem Hause, die erschütternde Erfahrung der gemeinsamen Feier von Brot und Wein... unerläßlich ist dafür, daß wir etwas zuwegebringen”.
 Als Dekan Weymann - die Teilnehmer verabschiedend - noch einmal an das Bild auf dem Einladungsblatt erinnerte und vom dornenvollen Weg des Friedens sprach, der gleichwohl unter dem Glanz des Kreuzes steht, mußte ich an Taulers Lied denken: Als Dekan Weymann - die Teilnehmer verabschiedend - noch einmal an das Bild auf dem Einladungsblatt erinnerte und vom dornenvollen Weg des Friedens sprach, der gleichwohl unter dem Glanz des Kreuzes steht, mußte ich an Taulers Lied denken:
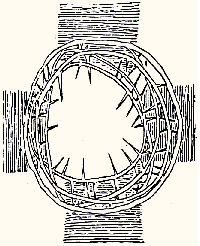
Zu Bethlehem geboren
im Stall ein Kindelein,
gibt sich für uns verloren;
gelobet muß es sein.
Und wer dies Kind mit Freuden
umfangen, küssen will,
muß vorher mit ihm leiden
groß Pein und Marter viel,
danach mit ihm auch sterben
und geistlich auferstehn,
ewigs Leben zu erben,
wie an ihm ist geschehn.
 Der alttestamentliche Prophet hat den erhofften Retter, den wir in Marias Sohn erkennen, „Wunder-Rat” und „Friede-Fürst” genannt. Das müßte uns zu denken geben. Der alttestamentliche Prophet hat den erhofften Retter, den wir in Marias Sohn erkennen, „Wunder-Rat” und „Friede-Fürst” genannt. Das müßte uns zu denken geben.
Quatember 1987, S. 28-34
|