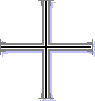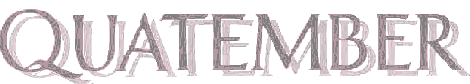Vortrag beim Gesamtkonvent der Evangelischen Michaelsbruderschaft in Hannover am 8. Oktober 1988
I.
 In seinen zeitkritischen Bemerkungen „Zeitgeist und Berner Geist” hat Jeremias Gotthelf vor nun bald 140 Jahren ein eindrucksvolles Szenarium des Widerstreits von überkommenem Glauben und aufgeklärter Bürgerlichkeit entworfen. Vertreter verschiedener geistiger Welten prallen aufeinander. Zwischen zwei Verhandlungen kommen Amtsrichter miteinander ins Gespräch. Weil es um Pfarrerssachen geht, ist auch vom christlichen Glauben die Rede. Bei dieser Gelegenheit heißt es: In seinen zeitkritischen Bemerkungen „Zeitgeist und Berner Geist” hat Jeremias Gotthelf vor nun bald 140 Jahren ein eindrucksvolles Szenarium des Widerstreits von überkommenem Glauben und aufgeklärter Bürgerlichkeit entworfen. Vertreter verschiedener geistiger Welten prallen aufeinander. Zwischen zwei Verhandlungen kommen Amtsrichter miteinander ins Gespräch. Weil es um Pfarrerssachen geht, ist auch vom christlichen Glauben die Rede. Bei dieser Gelegenheit heißt es:
 „Der Glaube gab viel hin und her zu reden. Die meisten wollten noch was glauben, einen christlichen Sinn haben, aber es war ihnen nicht recht klar, was er eigentlich sei, woraus er bestehe, wo sie ihn hätten. Und abermals wurde weidlich auf die Pfarrer geschimpft; wenn sie die gehörige Bildung hätten und recht predigten, das heißt zeitgemäß, das heißt im Geiste des Zeitgeistes, so wäre alles ganz anders” (Gesamtausgabe Eugen Rentsch Verlag, Bern, 1966, S. 112). „Der Glaube gab viel hin und her zu reden. Die meisten wollten noch was glauben, einen christlichen Sinn haben, aber es war ihnen nicht recht klar, was er eigentlich sei, woraus er bestehe, wo sie ihn hätten. Und abermals wurde weidlich auf die Pfarrer geschimpft; wenn sie die gehörige Bildung hätten und recht predigten, das heißt zeitgemäß, das heißt im Geiste des Zeitgeistes, so wäre alles ganz anders” (Gesamtausgabe Eugen Rentsch Verlag, Bern, 1966, S. 112).
 Inzwischen, das ist der nur geringe Unterschied zwischen Bern damals und Hannover heute, ist einigermaßen unklar, was „zeitgemäß” heißt, was „im Geiste des Zeitgeistes” zu sagen wäre. Darüber gibt es viel Streit unter uns. Der einstmalige Fortschrittsoptimismus ist ins Gerede gekommen. Die neue Zunft fundamentalistischer Verweigerer ist eine ziemlich bunte Koalition. Und ob die Pfarrer inzwischen die damals gewünschte „gehörige Bildung” besitzen, will ich dahingestellt sein lassen. Sie haben durch vielfältige Berufe Konkurrenz bekommen. Auf jeden Fall ist bis heute, folgt man dem Gesamteindruck öffentlicher christlicher Rede, nicht klarer geworden, „was der Glaube eigentlich sei, woraus er bestehe, wo sie ihn hätten”. Inzwischen, das ist der nur geringe Unterschied zwischen Bern damals und Hannover heute, ist einigermaßen unklar, was „zeitgemäß” heißt, was „im Geiste des Zeitgeistes” zu sagen wäre. Darüber gibt es viel Streit unter uns. Der einstmalige Fortschrittsoptimismus ist ins Gerede gekommen. Die neue Zunft fundamentalistischer Verweigerer ist eine ziemlich bunte Koalition. Und ob die Pfarrer inzwischen die damals gewünschte „gehörige Bildung” besitzen, will ich dahingestellt sein lassen. Sie haben durch vielfältige Berufe Konkurrenz bekommen. Auf jeden Fall ist bis heute, folgt man dem Gesamteindruck öffentlicher christlicher Rede, nicht klarer geworden, „was der Glaube eigentlich sei, woraus er bestehe, wo sie ihn hätten”.
 Man sollte meinen, was der Glaube zum Inhalt habe, darüber sei keine Unsicherheit möglich, weil das Glaubensbekenntnis der Kirche unzweideutig darüber Auskunft gebe. Nach einer seit Mitte der sechziger Jahre entstandenen wahren Flut an neu formulierten Glaubensbekenntnissen ist da jedoch Zweifel am Platze. Zwar wollten sie in ihrer Mehrzahl, zumindest zunächst, nicht an die Stelle von Apostolikum und Nizäno-Konstantinopolitanum treten. Jedoch dokumentieren sie, wie das ein Interpret eher beiläufig genannt hat, auch die Überzeugung, daß „das Apostolikum niemals eine ewige, sondern nur eine geschichtliche Wahrheit enthält” (Hanno Keller in: Bekenntnis in Bewegung, 1969, S. 163). Man sollte meinen, was der Glaube zum Inhalt habe, darüber sei keine Unsicherheit möglich, weil das Glaubensbekenntnis der Kirche unzweideutig darüber Auskunft gebe. Nach einer seit Mitte der sechziger Jahre entstandenen wahren Flut an neu formulierten Glaubensbekenntnissen ist da jedoch Zweifel am Platze. Zwar wollten sie in ihrer Mehrzahl, zumindest zunächst, nicht an die Stelle von Apostolikum und Nizäno-Konstantinopolitanum treten. Jedoch dokumentieren sie, wie das ein Interpret eher beiläufig genannt hat, auch die Überzeugung, daß „das Apostolikum niemals eine ewige, sondern nur eine geschichtliche Wahrheit enthält” (Hanno Keller in: Bekenntnis in Bewegung, 1969, S. 163).

 Der in diesem Zusammenhang etwas schiefe Gegensatz ewige-geschichtliche Wahrheit setzt ins Zwielicht, daß es trotz aller immer neu notwendigen Aneignung und Interpretation von einmal gefundenen Formulierungen des Glaubens einen in der Geschichte gewachsenen Konsens der Christenheit gibt, der verbindlich und bindend bleibt, solange der Glaube einer Gemeinschaft oder eines Einzelnen sich auf die Apostel als erste Zeugen des Glaubens berufen will. Karl Lehmann bemerkt einmal: „Es wäre gefährlich, wollten wir immer nur das aus der Heiligen Schrift und aus der kirchlichen Überlieferung heraushören, was uns paßt. Vielleicht wäre Christus dann nur die Initialzündung zur Erfüllung unserer eigenen Tagträume, nur das Stichwort der Hoffnungen unserer Umwelt und so nicht mehr der Herr unseres Lebens, dem wir zu dienen haben.” Es gilt nämlich: „Je stärker ein legitimer Pluralismus von Verkündigungsformeln in den Kirchen sich durchsetzen wird, um so dringlicher wird die wirkliche Einheit des auch worthaften Bekenntnisses der Kirche. Der Glaube muß sich ... im Wort des Bekenntnisses artikulieren, gesagt werden können und darf nicht in die wort- und bildlose, unerreichbare Form absoluter Unanschaulichkeit verschwinden” (in: Gegenwart des Glaubens, 1974, S. 137 und 136). Der in diesem Zusammenhang etwas schiefe Gegensatz ewige-geschichtliche Wahrheit setzt ins Zwielicht, daß es trotz aller immer neu notwendigen Aneignung und Interpretation von einmal gefundenen Formulierungen des Glaubens einen in der Geschichte gewachsenen Konsens der Christenheit gibt, der verbindlich und bindend bleibt, solange der Glaube einer Gemeinschaft oder eines Einzelnen sich auf die Apostel als erste Zeugen des Glaubens berufen will. Karl Lehmann bemerkt einmal: „Es wäre gefährlich, wollten wir immer nur das aus der Heiligen Schrift und aus der kirchlichen Überlieferung heraushören, was uns paßt. Vielleicht wäre Christus dann nur die Initialzündung zur Erfüllung unserer eigenen Tagträume, nur das Stichwort der Hoffnungen unserer Umwelt und so nicht mehr der Herr unseres Lebens, dem wir zu dienen haben.” Es gilt nämlich: „Je stärker ein legitimer Pluralismus von Verkündigungsformeln in den Kirchen sich durchsetzen wird, um so dringlicher wird die wirkliche Einheit des auch worthaften Bekenntnisses der Kirche. Der Glaube muß sich ... im Wort des Bekenntnisses artikulieren, gesagt werden können und darf nicht in die wort- und bildlose, unerreichbare Form absoluter Unanschaulichkeit verschwinden” (in: Gegenwart des Glaubens, 1974, S. 137 und 136).
 Es mag nützlich sein, zunächst einen der neuen Texte seine Wirkung tun zu lassen. In einem Ostergottesdienst in Martin Luthers Wittenberg lautete das Credo vor zwei Jahren so: Es mag nützlich sein, zunächst einen der neuen Texte seine Wirkung tun zu lassen. In einem Ostergottesdienst in Martin Luthers Wittenberg lautete das Credo vor zwei Jahren so:
Ich glaube an die heilige Aufregung der Frauen,
die beim Aufgehen der Ostersonne
den weggewälzten Stein sahen.
Ich teile ihre Hoffnung auf eine gelingende Gemeinschaft
der Heiligen, einer Gemeinschaft befreiter Schwestern,
erlöster Brüder, wo keiner wie ein Stein
das Leben des anderen verschließt.
Ich glaube an die wahre Unsterblichkeit Jesu,
in dessen Begegnungen die tiefe Kraft des Lebens
der Menschen ganz nahe kam,
der unabhängig von der Macht und Meinung
anderer alles Lebensverneinende anging,
sich einmischte und aufrieb,
bis ihm selbst das Recht zu leben genommen wurde
und er gemordet wurde unter dem Haß.
So reiht er sich in jene scheinbar endlose Kette
Mißachteter und Ermordeter, deren Leid
sich nicht in Worte fassen läßt.
Und dennoch können wir nicht schweigen,
sonst würden wir irr.
Ich glaube an das zarte zerbrechliche Geheimnis
des Lebens, das wir Gott nennen,
verborgen wie ein Korn in der Erde,
das uns in allem fragend begegnet
und unsere Liebe, unsere Angewiesenheit
und Verantwortung wachruft. Amen.
 (aus: Women in a changing world. Prayers and Poems, (aus: Women in a changing world. Prayers and Poems,
 Songs and Stories, January 1988, No. 25, S. 45) Songs and Stories, January 1988, No. 25, S. 45)

 Der Verfasserin dieses Textes ist eine beachtliche Einfühlung in den weltlichen und kirchlichen Zeitgeist unserer Jahre gelungen. Aber klärt dieses Arrangement aus biblischen Anleihen und Meinungen schon darüber auf, was der Osterglaube am Anfang und in der Geschichte der Kirche war? Da werden heutige Sehnsüchte und Hoffnungen in Worte gefaßt und dem alten Bekenntnis aufgepfropft. Doch ist der Inhalt christlichen Glaubens wirklich „die heilige Aufregung von Frauen”, die „Hoffnung auf eine gelingende Gemeinschaft der Heiligen”, die „wahre Unsterblichkeit” eines aus der endlosen Kette Mißachteter, „das zarte zerbrechliche Geheimnis des Lebens”? Der Verfasserin dieses Textes ist eine beachtliche Einfühlung in den weltlichen und kirchlichen Zeitgeist unserer Jahre gelungen. Aber klärt dieses Arrangement aus biblischen Anleihen und Meinungen schon darüber auf, was der Osterglaube am Anfang und in der Geschichte der Kirche war? Da werden heutige Sehnsüchte und Hoffnungen in Worte gefaßt und dem alten Bekenntnis aufgepfropft. Doch ist der Inhalt christlichen Glaubens wirklich „die heilige Aufregung von Frauen”, die „Hoffnung auf eine gelingende Gemeinschaft der Heiligen”, die „wahre Unsterblichkeit” eines aus der endlosen Kette Mißachteter, „das zarte zerbrechliche Geheimnis des Lebens”?
 Heutige Interessen und Hilflosigkeiten werden in das christlich Überkommene hineingelesen, das Fremde der Vergangenheit wird in alltäglich Gewohntes aufgelöst. Das sind alles Es-Aussagen, psychische Zustände, Vermutungen, Wünsche. Was fehlt, ist das eindeutig-identifizierbare, unverwechselbare Subjekt. Vergeblich sucht der Leser die nüchterne Objektivität biblischer oder altkirchlicher Aussagen. Die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Jesus und Gott, der Motor klassischer Bekenntnisaussagen, bleibt im Nebel. Heutige Interessen und Hilflosigkeiten werden in das christlich Überkommene hineingelesen, das Fremde der Vergangenheit wird in alltäglich Gewohntes aufgelöst. Das sind alles Es-Aussagen, psychische Zustände, Vermutungen, Wünsche. Was fehlt, ist das eindeutig-identifizierbare, unverwechselbare Subjekt. Vergeblich sucht der Leser die nüchterne Objektivität biblischer oder altkirchlicher Aussagen. Die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Jesus und Gott, der Motor klassischer Bekenntnisaussagen, bleibt im Nebel.
 In diesem Dokument einer bemühten Gefühlsaufwallung ist so vieles gut gemeint. Die Sätze jedoch klingen nur noch wie ein fernes Echo auf das Zeugnis der Apostel, sie sind eigentümlich hilf- und kraftlos, produzieren Stimmungen, können aber kaum einem Leben Halt, Gestalt und Richtung geben. Vielleicht meinen manche, durch die Herz und Kopf beanspruchende Anstrengung des Glaubens müde Gewordene, sie kämen so aus der Etappe religiöser Nachzügler heraus und gewännen wieder Anschluß an den Geist der Zeit. Ein elementares Interesse an den Geheimnissen der Christenheit bei fragenden Zeitgenossen wird so jedoch kaum wach werden. Vergleichbare Empfindungen werden auf dem Markt der Anschauungen vielfach feilgeboten. Und anstelle des Konsenses, den das eine Bekenntnis zwischen den vielen und auf mancherlei Weise Glaubenden stiften soll, entsteht Dissens, Streit. Zerfällt die gemeinsame Sprache, diffundiert auch der eine, viele umfassende Glaube. In diesem Dokument einer bemühten Gefühlsaufwallung ist so vieles gut gemeint. Die Sätze jedoch klingen nur noch wie ein fernes Echo auf das Zeugnis der Apostel, sie sind eigentümlich hilf- und kraftlos, produzieren Stimmungen, können aber kaum einem Leben Halt, Gestalt und Richtung geben. Vielleicht meinen manche, durch die Herz und Kopf beanspruchende Anstrengung des Glaubens müde Gewordene, sie kämen so aus der Etappe religiöser Nachzügler heraus und gewännen wieder Anschluß an den Geist der Zeit. Ein elementares Interesse an den Geheimnissen der Christenheit bei fragenden Zeitgenossen wird so jedoch kaum wach werden. Vergleichbare Empfindungen werden auf dem Markt der Anschauungen vielfach feilgeboten. Und anstelle des Konsenses, den das eine Bekenntnis zwischen den vielen und auf mancherlei Weise Glaubenden stiften soll, entsteht Dissens, Streit. Zerfällt die gemeinsame Sprache, diffundiert auch der eine, viele umfassende Glaube.
 Apostolischer Glaube heute - zwei Zeiten sind in dem Thema ineinander verschränkt: eine ferne Vergangenheit, in der Männer wie Petrus und Johannes lebten, auch Frauen, natürlich, wie Priscilla und Lydia, und die Gegenwart, in der wir uns einmal reichlich selbstbewußt und dann wieder ratlos vorfinden; ein Ehedem, in dem der christliche Glaube einen ungeheuren Siegeszug durch eine ihm noch feindliche Welt antrat, und ein Heute, in dem er sich, so empfinden es manche bei uns, wieder aus unserem Umkreis zurückzieht, verdampft, verflüchtigt, sich manchmal für kurze Zeit auch mit rasch wechselnden Moden verbündet. Zeiten aber stehen nicht hermetisch verschlossen gegeneinander und nebeneinander. Unser Jetzt kommt von weit her, gräbt einer nur tief genug, so trifft er auf Schichten, Ablagerungen, Energiequellen. Apostolischer Glaube: das ist schwarzes Gold, das nur aus der Tiefe des Gedächtnisses der Kirche heraufgeholt und von Beimengungen gereinigt, entschlackt werden muß. Apostolischer Glaube heute - zwei Zeiten sind in dem Thema ineinander verschränkt: eine ferne Vergangenheit, in der Männer wie Petrus und Johannes lebten, auch Frauen, natürlich, wie Priscilla und Lydia, und die Gegenwart, in der wir uns einmal reichlich selbstbewußt und dann wieder ratlos vorfinden; ein Ehedem, in dem der christliche Glaube einen ungeheuren Siegeszug durch eine ihm noch feindliche Welt antrat, und ein Heute, in dem er sich, so empfinden es manche bei uns, wieder aus unserem Umkreis zurückzieht, verdampft, verflüchtigt, sich manchmal für kurze Zeit auch mit rasch wechselnden Moden verbündet. Zeiten aber stehen nicht hermetisch verschlossen gegeneinander und nebeneinander. Unser Jetzt kommt von weit her, gräbt einer nur tief genug, so trifft er auf Schichten, Ablagerungen, Energiequellen. Apostolischer Glaube: das ist schwarzes Gold, das nur aus der Tiefe des Gedächtnisses der Kirche heraufgeholt und von Beimengungen gereinigt, entschlackt werden muß.

II.
 Der Ökumenische Rat der Kirchen ist gegründet worden als Instrument, die in viele Traditionen auseinandergefallene Christenheit wieder zur Einheit des Glaubens zusammenzuführen. Der lange und mühsame Weg erreichte einen ersten Höhepunkt, als es möglich wurde, im Blick auf Taufe, Eucharistie und Amt weitreichende Konvergenzen zu formulieren. Sogleich wurde aber auch der Einwand laut: Es genügt nicht, sich in Fragen kirchlicher Vollzüge zu einigen. Entscheidend ist der Inhalt des Glaubens. Entsprechend stellte sich die Aufgabe, den allen gemeinsamen einen Glauben so auszusagen, daß die Einheit der Kirchen im Bekenntnis nicht länger bloßer Wunsch bliebe, sondern erfahrbare Wirklichkeit würde. Die Aufgabe war alt und ist seit den Anfängen der ökumenischen Bewegung immer wieder in Erinnerung gerufen worden (seit der Hauptkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung 1927 in Lausanne). Jetzt konnte sie nicht mehr länger aufgeschoben werden. Der Ökumenische Rat der Kirchen ist gegründet worden als Instrument, die in viele Traditionen auseinandergefallene Christenheit wieder zur Einheit des Glaubens zusammenzuführen. Der lange und mühsame Weg erreichte einen ersten Höhepunkt, als es möglich wurde, im Blick auf Taufe, Eucharistie und Amt weitreichende Konvergenzen zu formulieren. Sogleich wurde aber auch der Einwand laut: Es genügt nicht, sich in Fragen kirchlicher Vollzüge zu einigen. Entscheidend ist der Inhalt des Glaubens. Entsprechend stellte sich die Aufgabe, den allen gemeinsamen einen Glauben so auszusagen, daß die Einheit der Kirchen im Bekenntnis nicht länger bloßer Wunsch bliebe, sondern erfahrbare Wirklichkeit würde. Die Aufgabe war alt und ist seit den Anfängen der ökumenischen Bewegung immer wieder in Erinnerung gerufen worden (seit der Hauptkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung 1927 in Lausanne). Jetzt konnte sie nicht mehr länger aufgeschoben werden.
 Zunächst wurde der Versuch gemacht, in Anknüpfung an biblische Texte (z. B. Eph. 1, 3-14) den gemeinsamen Glauben neu zu formulieren. Es zeigte sich rasch, daß gute Absichten und theologische Kenntnisse für solch ein Unternehmen nicht ausreichen. Gelegenheiten zur Formulierung rezipierfähiger Glaubensbekenntnisse sind nicht jederzeit gegeben. Es gibt Stunden geschichtlicher Kontingenz, die niemand herbeizwingen kann. Gerade in der Geschichte der Kirche drängt sich den Handelnden die Erfahrung auf, daß allem geschichtsmächtigen Machen ein Empfangen vorausgeht. Nur selten sind die Augenblicke, in denen Einsichten des Glaubens eine solche Evidenz gewinnen, daß sie für alle ausgesagt und von allen aufgenommen werden können. Zunächst wurde der Versuch gemacht, in Anknüpfung an biblische Texte (z. B. Eph. 1, 3-14) den gemeinsamen Glauben neu zu formulieren. Es zeigte sich rasch, daß gute Absichten und theologische Kenntnisse für solch ein Unternehmen nicht ausreichen. Gelegenheiten zur Formulierung rezipierfähiger Glaubensbekenntnisse sind nicht jederzeit gegeben. Es gibt Stunden geschichtlicher Kontingenz, die niemand herbeizwingen kann. Gerade in der Geschichte der Kirche drängt sich den Handelnden die Erfahrung auf, daß allem geschichtsmächtigen Machen ein Empfangen vorausgeht. Nur selten sind die Augenblicke, in denen Einsichten des Glaubens eine solche Evidenz gewinnen, daß sie für alle ausgesagt und von allen aufgenommen werden können.
 Es ist ein törichtes Verlangen, die Lebendigkeit der Kirche an ihrer Produktivität von Texten messen zu wollen: So wenig sich Blütezeiten des reformatorischen Liedes arrangieren lassen, so wenig sind wir in der Lage, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem der gemeinsame Glaube sich in apostolischer Treue neu, überzeugend und einladend aussprechen läßt. Die lutherische Reformation hat deshalb trotz ihrer staunenswerten religiösen Fruchtbarkeit - gerade in literarischer Hinsicht - nicht etwa neue Glaubensbekenntnisse formuliert, sondern auf dem Boden und in der Tradition der altkirchlichen Bekenntnisse den überkommenen Glauben neu ausgelegt. Die eigenen Erkenntnisse wurden so apostolisch unterfangen und im Horizont der ökumenischen Christenheit zur Geltung gebracht. Ohne solche Demut vor der Geschichte des Glaubens und ohne eine Begrenzung des eigenen Anspruchs werden aus reformerischen Bewegungen nur zu leicht Häresien. Es ist ein törichtes Verlangen, die Lebendigkeit der Kirche an ihrer Produktivität von Texten messen zu wollen: So wenig sich Blütezeiten des reformatorischen Liedes arrangieren lassen, so wenig sind wir in der Lage, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem der gemeinsame Glaube sich in apostolischer Treue neu, überzeugend und einladend aussprechen läßt. Die lutherische Reformation hat deshalb trotz ihrer staunenswerten religiösen Fruchtbarkeit - gerade in literarischer Hinsicht - nicht etwa neue Glaubensbekenntnisse formuliert, sondern auf dem Boden und in der Tradition der altkirchlichen Bekenntnisse den überkommenen Glauben neu ausgelegt. Die eigenen Erkenntnisse wurden so apostolisch unterfangen und im Horizont der ökumenischen Christenheit zur Geltung gebracht. Ohne solche Demut vor der Geschichte des Glaubens und ohne eine Begrenzung des eigenen Anspruchs werden aus reformerischen Bewegungen nur zu leicht Häresien.
 Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung hat sich deshalb im weiteren Verlauf ihrer Arbeit älterer Einsichten erinnert, die Absicht, ein neues ökumenisches Glaubensbekenntnis zu formulieren, aufgegeben und stattdessen das auf die Konzilien von Nizäa und Konstantinopel zurückgehende sogenannte Nizäno-Konstantinopolitanum zur Grundlage ihrer Arbeit gemacht. Die Aufgabe, vor der die Kirchen stehen, wird dabei dreifach bestimmt: Das Credo soll anerkannt, neu ausgelegt und „je nach den Erfordernissen der Situation” neu bekannt - also aktuell konkretisiert wie etwa 1934 in Barmen - werden. Ausdrücklich heißt es, „daß der Entwurf eines neuen Bekenntnisses, das das Nizänum als ökumenisches Symbol des apostolischen Glaubens ersetzen soll, unangebracht ist” (H. G. Link, Gemeinsam glauben und bekennen, 1987, S. 282). Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung hat sich deshalb im weiteren Verlauf ihrer Arbeit älterer Einsichten erinnert, die Absicht, ein neues ökumenisches Glaubensbekenntnis zu formulieren, aufgegeben und stattdessen das auf die Konzilien von Nizäa und Konstantinopel zurückgehende sogenannte Nizäno-Konstantinopolitanum zur Grundlage ihrer Arbeit gemacht. Die Aufgabe, vor der die Kirchen stehen, wird dabei dreifach bestimmt: Das Credo soll anerkannt, neu ausgelegt und „je nach den Erfordernissen der Situation” neu bekannt - also aktuell konkretisiert wie etwa 1934 in Barmen - werden. Ausdrücklich heißt es, „daß der Entwurf eines neuen Bekenntnisses, das das Nizänum als ökumenisches Symbol des apostolischen Glaubens ersetzen soll, unangebracht ist” (H. G. Link, Gemeinsam glauben und bekennen, 1987, S. 282).

 Für mich sind in dieser „Umkehr” der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung die „Zeichen der Zeit” an einer durchaus nicht sekundären Stelle richtig verstanden worden. Die Einheit der Kirche wird nicht mehr von einem Fortschritt erwartet, der die bisherige Geschichte in neuen Formulierungen des Glaubens übersteigt und überbietet, sondern von einer neuen Einkehr in ihren apostolischen Ursprung. Die Geschichte ist nicht bloßes Material, über das wir frei verfügen und gebieten können. Sie ist freilich auch nicht ein Verhängnis, dem wir auf Gedeih und Verderb willenlos ausgeliefert sind. Technokratischer Machbarkeitswahn und apathische Entscheidungsunfähigkeit sind nur die zwei Seiten des gleichen Irrtums. Die Übernahme geschichtlicher Entscheidungen kann nur durch produktive Aneignung erfolgen, durch die sie sich freilich auch verändern, neue Möglichkeiten zeigen, Überraschungen freigeben. Für mich sind in dieser „Umkehr” der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung die „Zeichen der Zeit” an einer durchaus nicht sekundären Stelle richtig verstanden worden. Die Einheit der Kirche wird nicht mehr von einem Fortschritt erwartet, der die bisherige Geschichte in neuen Formulierungen des Glaubens übersteigt und überbietet, sondern von einer neuen Einkehr in ihren apostolischen Ursprung. Die Geschichte ist nicht bloßes Material, über das wir frei verfügen und gebieten können. Sie ist freilich auch nicht ein Verhängnis, dem wir auf Gedeih und Verderb willenlos ausgeliefert sind. Technokratischer Machbarkeitswahn und apathische Entscheidungsunfähigkeit sind nur die zwei Seiten des gleichen Irrtums. Die Übernahme geschichtlicher Entscheidungen kann nur durch produktive Aneignung erfolgen, durch die sie sich freilich auch verändern, neue Möglichkeiten zeigen, Überraschungen freigeben.
 Aber nur in der Bescheidung, Nachfolger zu sein und nicht Anfänger, nur in der Verweigerung prometheischer Überhebung können wir der Einheit der Christenheit und der Vitalität unserer Kirchentümer aufhelfen. Die kreativ genannte Mentalität, die zum schnellen Konsum Texte und Lieder und Bekenntnisse anfertigt, ist viel zu sehr das Kind einer fatalen Überfluß- und Wegwerfgesellschaft, als daß sie Dauerhaftes, Bleibendes, Beständiges schaffen könnte. Der apostolische Glaube verlangt auch heute mehr Aufmerksamkeit, größere Geduld, einen Geschmack für Qualität. Das ist kein Plädoyer für Musealität - wie wir Michaelsbrüder sie häufig erfahren lassen - oder gar elitäre Arroganz. Es ist nicht schon damit getan, daß einer in historischen Kostümen herumläuft. Antiquiertheit und Bindung an die Entscheidungen der Geschichte sind nicht dasselbe. Ganz ohne Anstrengung geht es nicht. Treue zu den Vorgaben der Geschichte ist etwas anderes als sklavische Abhängigkeit. Aber nur in der Bescheidung, Nachfolger zu sein und nicht Anfänger, nur in der Verweigerung prometheischer Überhebung können wir der Einheit der Christenheit und der Vitalität unserer Kirchentümer aufhelfen. Die kreativ genannte Mentalität, die zum schnellen Konsum Texte und Lieder und Bekenntnisse anfertigt, ist viel zu sehr das Kind einer fatalen Überfluß- und Wegwerfgesellschaft, als daß sie Dauerhaftes, Bleibendes, Beständiges schaffen könnte. Der apostolische Glaube verlangt auch heute mehr Aufmerksamkeit, größere Geduld, einen Geschmack für Qualität. Das ist kein Plädoyer für Musealität - wie wir Michaelsbrüder sie häufig erfahren lassen - oder gar elitäre Arroganz. Es ist nicht schon damit getan, daß einer in historischen Kostümen herumläuft. Antiquiertheit und Bindung an die Entscheidungen der Geschichte sind nicht dasselbe. Ganz ohne Anstrengung geht es nicht. Treue zu den Vorgaben der Geschichte ist etwas anderes als sklavische Abhängigkeit.
 Die Geschichte freilich kann nur ihre Mächtigkeit entfalten, wenn sie gegenwärtig ist. Das Nizäno-Konstantinopolitanum ist nicht dazu geschaffen worden, um lediglich gelehrt kommentiert und in Seminaren seziert zu werden. Sein eigentlicher Gebrauch erfolgt in der gottesdienstlichen Versammlung. Bekenntnis und Gebet, Hymnus und Lehre, Selbstübergabe an Gott und Verkündigung vor den Menschen liegen in diesem alten Credo so unübertrefflich ineinander, daß es eine bedauerliche und bedenkliche Verarmung darstellt, wenn unsere Gemeinden seit einigen Jahren schon fast nur noch das Apostolikum verwenden, das Nizäno-Konstantinopolitanum dagegen nahezu unbekannt geworden ist. Bei diesem Verlust darf es nicht bleiben. Von Gott reden, das braucht hymnischen Überschwang, selbstvergessenen Lobpreis. Die grassierende Gottlosigkeit läßt sich nicht beheben, wenn die Lobgesänge verschwiegen werden, über denen Gott wohnt (Ps. 22,4). Hier ist Umkehr nötig und möglich. Die Geschichte freilich kann nur ihre Mächtigkeit entfalten, wenn sie gegenwärtig ist. Das Nizäno-Konstantinopolitanum ist nicht dazu geschaffen worden, um lediglich gelehrt kommentiert und in Seminaren seziert zu werden. Sein eigentlicher Gebrauch erfolgt in der gottesdienstlichen Versammlung. Bekenntnis und Gebet, Hymnus und Lehre, Selbstübergabe an Gott und Verkündigung vor den Menschen liegen in diesem alten Credo so unübertrefflich ineinander, daß es eine bedauerliche und bedenkliche Verarmung darstellt, wenn unsere Gemeinden seit einigen Jahren schon fast nur noch das Apostolikum verwenden, das Nizäno-Konstantinopolitanum dagegen nahezu unbekannt geworden ist. Bei diesem Verlust darf es nicht bleiben. Von Gott reden, das braucht hymnischen Überschwang, selbstvergessenen Lobpreis. Die grassierende Gottlosigkeit läßt sich nicht beheben, wenn die Lobgesänge verschwiegen werden, über denen Gott wohnt (Ps. 22,4). Hier ist Umkehr nötig und möglich.

III.
 Bei den mancherlei Rufen zur Umkehr darf es nicht dazu kommen, daß nun auch wir gedankenlos in die Richtung rennen, in die eine Mehrheit längst schon unterwegs ist und dann unseren Glauben an eine Fahnenstange hängen als Legitimation dafür, daß die Richtung stimmt. Soll nach dem zuerst monarchistischen und dann nationalistischen Mißbrauch jetzt der gesellschaftliche Mißbrauch des christlichen Glaubens legitimiert werden? Mir wäre bei der üblich gewordenen protestantischen Staats-, Wirtschafts-, Militär-, ja überhaupt Institutionenkritik wohler, wenn ich sie nicht als die ebenso einseitige Kehrtwende früherer gedankenarmer Verklärung eben dieser Einrichtungen wahrnehmen müßte. Wenn man in der einen Richtung sein Ziel offensichtlich verfehlt hat, einfach in die entgegengesetzte Richtung zu rennen, mag zwar subjektiv besten Absichten entspringen, garantiert aber noch lange nicht den Erfolg, auch richtig anzukommen. Bei den mancherlei Rufen zur Umkehr darf es nicht dazu kommen, daß nun auch wir gedankenlos in die Richtung rennen, in die eine Mehrheit längst schon unterwegs ist und dann unseren Glauben an eine Fahnenstange hängen als Legitimation dafür, daß die Richtung stimmt. Soll nach dem zuerst monarchistischen und dann nationalistischen Mißbrauch jetzt der gesellschaftliche Mißbrauch des christlichen Glaubens legitimiert werden? Mir wäre bei der üblich gewordenen protestantischen Staats-, Wirtschafts-, Militär-, ja überhaupt Institutionenkritik wohler, wenn ich sie nicht als die ebenso einseitige Kehrtwende früherer gedankenarmer Verklärung eben dieser Einrichtungen wahrnehmen müßte. Wenn man in der einen Richtung sein Ziel offensichtlich verfehlt hat, einfach in die entgegengesetzte Richtung zu rennen, mag zwar subjektiv besten Absichten entspringen, garantiert aber noch lange nicht den Erfolg, auch richtig anzukommen.
 Evangelischer Glaube war niemals durch eine lange geschichtliche Erfahrung gehalten. Er stand auf gegen ein zu einfaches Konzept von Kontinuität und legitimer Entwicklung. Der Protestantismus hatte deshalb stets einige Sensibilität für sich ankündigende Entwicklungen, Brüche, Zeit-Tendenzen, die moderne Welt. Darüber ist aber geradezu sein Spielbein zum Standbein geworden, sind Luthers Söhne und Töchter von dauernder Unruhe gepackt, der Epheserbrief nennt das „von jedem Wind einer Lehre bewegt und umhergetrieben durch trügerisches Spiel der Menschen” (4,14). Evangelischer Glaube war niemals durch eine lange geschichtliche Erfahrung gehalten. Er stand auf gegen ein zu einfaches Konzept von Kontinuität und legitimer Entwicklung. Der Protestantismus hatte deshalb stets einige Sensibilität für sich ankündigende Entwicklungen, Brüche, Zeit-Tendenzen, die moderne Welt. Darüber ist aber geradezu sein Spielbein zum Standbein geworden, sind Luthers Söhne und Töchter von dauernder Unruhe gepackt, der Epheserbrief nennt das „von jedem Wind einer Lehre bewegt und umhergetrieben durch trügerisches Spiel der Menschen” (4,14).
 Natürlich muß der Glaube heute bekannt werden. Aber wir dürfen nicht dem Heute verfallen. Deshalb muß unsere erste Aufmerksamkeit der Abkehr von allen modischen Spielereien und der Einkehr in die Ruhe apostolischer Gewißheit gelten. Die Schlagzeilen der Zeit wechseln rascher, als wir uns drehen können. Es gibt eine alerte Schlaumeierei, die man sich bei den Kindern der Welt gefallen läßt, bei den Männern und Frauen des Glaubens aber nur peinlich findet. Zeitgenossenschaft: die ist dringend und nötig, aber Buhlen mit dem Zeitgeist: darüber kann man, wie P. L. Berger einmal bemerkt, sehr schnell zum Witwer werden. Natürlich muß der Glaube heute bekannt werden. Aber wir dürfen nicht dem Heute verfallen. Deshalb muß unsere erste Aufmerksamkeit der Abkehr von allen modischen Spielereien und der Einkehr in die Ruhe apostolischer Gewißheit gelten. Die Schlagzeilen der Zeit wechseln rascher, als wir uns drehen können. Es gibt eine alerte Schlaumeierei, die man sich bei den Kindern der Welt gefallen läßt, bei den Männern und Frauen des Glaubens aber nur peinlich findet. Zeitgenossenschaft: die ist dringend und nötig, aber Buhlen mit dem Zeitgeist: darüber kann man, wie P. L. Berger einmal bemerkt, sehr schnell zum Witwer werden.
 Der Glaube taugt selten nur als Verstärker zu dem, was ohnehin auf dem Markt der Meinungen gehandelt wird. Häufig ist er seines langen geschichtlichen Atems wegen eher eine Aufklärung über Vorurteile, eine Störung zu billiger Übereinkünfte, ein Widerstand gegen eine nur eindimensionale Wahrnehmung der Wirklichkeit. Gebrannte Kinder sollen das Feuer nicht mutwillig suchen.
IV. Der Glaube taugt selten nur als Verstärker zu dem, was ohnehin auf dem Markt der Meinungen gehandelt wird. Häufig ist er seines langen geschichtlichen Atems wegen eher eine Aufklärung über Vorurteile, eine Störung zu billiger Übereinkünfte, ein Widerstand gegen eine nur eindimensionale Wahrnehmung der Wirklichkeit. Gebrannte Kinder sollen das Feuer nicht mutwillig suchen.
IV.
 Zeichen der Zeit, meinen wir, sind Signale, die jeder zur Kenntnis nimmt, um die jeder weiß. Aber ist das richtig? Der Abschnitt im Matthäus-Evangelium mahnt zur Vorsicht. „Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen; könnt ihr denn nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen?” (16,3). Jesus mokiert sich geradezu über die Unfähigkeit seiner Zeitgenossen. Das Wetter können sie voraussagen, aber die geistige Großwetterlage nehmen sie nicht wahr. Mit den Zeichen der Zeit ist es ein seltsam Ding. Mancher, der sich auszukennen meint, spricht nur von metereologischen Erscheinungen. Auch heutigentags ist noch nicht ausgemacht, ob das, wovon viele und also auch die Christenmenschen reden, wirklich die geistige Signatur unserer Zeit kennzeichnet. Zeichen der Zeit, meinen wir, sind Signale, die jeder zur Kenntnis nimmt, um die jeder weiß. Aber ist das richtig? Der Abschnitt im Matthäus-Evangelium mahnt zur Vorsicht. „Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen; könnt ihr denn nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen?” (16,3). Jesus mokiert sich geradezu über die Unfähigkeit seiner Zeitgenossen. Das Wetter können sie voraussagen, aber die geistige Großwetterlage nehmen sie nicht wahr. Mit den Zeichen der Zeit ist es ein seltsam Ding. Mancher, der sich auszukennen meint, spricht nur von metereologischen Erscheinungen. Auch heutigentags ist noch nicht ausgemacht, ob das, wovon viele und also auch die Christenmenschen reden, wirklich die geistige Signatur unserer Zeit kennzeichnet.

 Mit aller Vorsicht nenne ich drei Sachverhalte: Mit aller Vorsicht nenne ich drei Sachverhalte:
 1. Die Natur ist durcheinandergeraten. 1. Die Natur ist durcheinandergeraten.
 2. Die Menschen sind sich ihrer selbst ungewiß geworden. 2. Die Menschen sind sich ihrer selbst ungewiß geworden.
 3. Das Prinzip Hoffnung funktioniert nicht mehr. 3. Das Prinzip Hoffnung funktioniert nicht mehr.
 Die Themen stehen in einer Entsprechung zu jeweils einem Artikel unseres Glaubensbekenntnisses. Diese Beziehung bestimmt Auswahl und Formulierung. Die Themen stehen in einer Entsprechung zu jeweils einem Artikel unseres Glaubensbekenntnisses. Diese Beziehung bestimmt Auswahl und Formulierung.
1. Die Natur ist durcheinandergeraten
 Vor unseren Augen vollziehen sich erregende Veränderungen. Vor unseren Augen vollziehen sich erregende Veränderungen.
 Jahrtausendelang war die Natur eine dem Menschen feindliche Übermacht. Jahrtausendelang war die Natur eine dem Menschen feindliche Übermacht.
 Naturkatastrophen begleiteten sein Leben. Die Ohnmacht des Menschen war offenbar. Der Anblick des Meeres weckte nicht romantisches Urlauber-Entzücken, sondern elementare Todesangst. Die Natur erschien als unerschöpflich, überwältigend groß, von unabsehbarer Dauer. Des Menschen Spanne Zeit war demgegenüber kurz, seine Macht begrenzt, seine Abhängigkeit evident. Von Anfang an nimmt allerdings der Mensch eine Sonderrolle ein im Reich der Natur. Kraft seines Geistes kann er sich anders als andere Wesen von seiner Umwelt unterscheiden und Natur durch Kultur überformen. Für lange Zeit aber stehen Selbständigkeit und Übermacht der Natur außer Frage. Naturkatastrophen begleiteten sein Leben. Die Ohnmacht des Menschen war offenbar. Der Anblick des Meeres weckte nicht romantisches Urlauber-Entzücken, sondern elementare Todesangst. Die Natur erschien als unerschöpflich, überwältigend groß, von unabsehbarer Dauer. Des Menschen Spanne Zeit war demgegenüber kurz, seine Macht begrenzt, seine Abhängigkeit evident. Von Anfang an nimmt allerdings der Mensch eine Sonderrolle ein im Reich der Natur. Kraft seines Geistes kann er sich anders als andere Wesen von seiner Umwelt unterscheiden und Natur durch Kultur überformen. Für lange Zeit aber stehen Selbständigkeit und Übermacht der Natur außer Frage.
 Das ändert sich offenkundig in der Neuzeit und vollendet sich in unseren Tagen. Von einem Teil der Natur wird der Mensch zum Subjekt der Natur. Einstmals als Ergebnis betroffen von der Evolution, nimmt er jetzt die Evolution in seine eigenen Hände. Der Biologe Frederic Vester spricht von der Natur als einer Firma, „die in vier Milliarden Jahren nicht bankrott gemacht hat. Jetzt ist der Mensch Mitunternehmer in dieser Firma geworden. Wird er auch, wie die Natur, vier Milliarden Jahre mit Erfolg wirtschaften?” Das ändert sich offenkundig in der Neuzeit und vollendet sich in unseren Tagen. Von einem Teil der Natur wird der Mensch zum Subjekt der Natur. Einstmals als Ergebnis betroffen von der Evolution, nimmt er jetzt die Evolution in seine eigenen Hände. Der Biologe Frederic Vester spricht von der Natur als einer Firma, „die in vier Milliarden Jahren nicht bankrott gemacht hat. Jetzt ist der Mensch Mitunternehmer in dieser Firma geworden. Wird er auch, wie die Natur, vier Milliarden Jahre mit Erfolg wirtschaften?”
 Natürlich hat es auch schon ökologische Katastrophen in vormoderner Zeit gegeben. Natürlich sind Pflanzen- und Tierarten immer schon der Evolution zum Opfer gebracht worden. Aber was jetzt vor unseren Augen und Ohren geschieht, ist von einer neuen, noch nie dagewesenen Qualität. Auf die Ozonschicht haben die Menschen niemals zuvor Einfluß ausgeübt. Meere sind zu keiner Zeit gestorben. Das Erbgut hat sich durch langfristige Mutationen verändert, nicht aber durch kurzfristige technische Eingriffe. Natürlich hat es auch schon ökologische Katastrophen in vormoderner Zeit gegeben. Natürlich sind Pflanzen- und Tierarten immer schon der Evolution zum Opfer gebracht worden. Aber was jetzt vor unseren Augen und Ohren geschieht, ist von einer neuen, noch nie dagewesenen Qualität. Auf die Ozonschicht haben die Menschen niemals zuvor Einfluß ausgeübt. Meere sind zu keiner Zeit gestorben. Das Erbgut hat sich durch langfristige Mutationen verändert, nicht aber durch kurzfristige technische Eingriffe.
 Was ist geschehen? Im Bilde gesprochen: Der Mensch ist vom Geschöpf zum Schöpfer, vom Angestellten in der Firma Natur zum Inhaber geworden. Das ist ein radikaler Wandel. Er hat viel mit dem apostolischen Glauben zu tun. Er vollendet den Glauben an Gott den Schöpfer und stellt ihn gleichzeitig auf den Kopf. Was ist geschehen? Im Bilde gesprochen: Der Mensch ist vom Geschöpf zum Schöpfer, vom Angestellten in der Firma Natur zum Inhaber geworden. Das ist ein radikaler Wandel. Er hat viel mit dem apostolischen Glauben zu tun. Er vollendet den Glauben an Gott den Schöpfer und stellt ihn gleichzeitig auf den Kopf.

 Aber ist in dieser Situation Umkehr das richtige Wort? Mir will es reichlich naiv erscheinen, so zu tun, als könnten wir Menschen wieder in den Stand der Unschuld zurückkehren. Zurück können wir nicht, aber angesichts der eingetretenen Folgen den ersten Artikel unseres Glaubensbekenntnisses neu buchstabieren: Aber ist in dieser Situation Umkehr das richtige Wort? Mir will es reichlich naiv erscheinen, so zu tun, als könnten wir Menschen wieder in den Stand der Unschuld zurückkehren. Zurück können wir nicht, aber angesichts der eingetretenen Folgen den ersten Artikel unseres Glaubensbekenntnisses neu buchstabieren:
„Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.”
 Allmacht ist kein uns Menschen zukommendes Prädikat. Unsere schöpferischen Kräfte, sie gibt es, daran besteht kein Zweifel, sind abgeleitet von dem, dem allein der Titel Schöpfer zukommt. Aber wenn schon der Glaube Allmacht und Schöpferkraft Gottes auf seine Fürsorge ausrichtet und deshalb im Vaternamen zentriert, dann steht es dem Menschen entsprechend gut an, sich mehr als Verwalter in Gottes Schöpfung denn als Inhaber, mehr als Pfleger und Heger denn als Herrscher und Tyrann zu verstehen. Vieles vermag der Mensch. Aber er hat noch nicht gelernt, die Abschätzung der Risiken seiner Unternehmungen mit derselben Sorgfalt durchzuführen, wie sich der Lust am immer neuen Erfinden und Machen hinzugeben. Die früher grenzenlos vielfältig erscheinende Natur könnte sehr bald todlangweilig werden, wenn der Mensch nicht endlich Grenzen wahrnimmt, sich nicht selber Grenzen setzt. Das Bekenntnis zu Gott dem Schöpfer ist zugleich eine Platzanweisung für den Menschen: Er ist Mitgeschöpf, vielfach ausgezeichnet und hervorgehoben, aber in eine bleibende Solidarität zu allen anderen Geschöpfen gestellt. Und er ist als Sachwalter Gottes ein Schöpfer zweiter Ordnung sozusagen, cooperator dei, nicht deus. Allmacht ist kein uns Menschen zukommendes Prädikat. Unsere schöpferischen Kräfte, sie gibt es, daran besteht kein Zweifel, sind abgeleitet von dem, dem allein der Titel Schöpfer zukommt. Aber wenn schon der Glaube Allmacht und Schöpferkraft Gottes auf seine Fürsorge ausrichtet und deshalb im Vaternamen zentriert, dann steht es dem Menschen entsprechend gut an, sich mehr als Verwalter in Gottes Schöpfung denn als Inhaber, mehr als Pfleger und Heger denn als Herrscher und Tyrann zu verstehen. Vieles vermag der Mensch. Aber er hat noch nicht gelernt, die Abschätzung der Risiken seiner Unternehmungen mit derselben Sorgfalt durchzuführen, wie sich der Lust am immer neuen Erfinden und Machen hinzugeben. Die früher grenzenlos vielfältig erscheinende Natur könnte sehr bald todlangweilig werden, wenn der Mensch nicht endlich Grenzen wahrnimmt, sich nicht selber Grenzen setzt. Das Bekenntnis zu Gott dem Schöpfer ist zugleich eine Platzanweisung für den Menschen: Er ist Mitgeschöpf, vielfach ausgezeichnet und hervorgehoben, aber in eine bleibende Solidarität zu allen anderen Geschöpfen gestellt. Und er ist als Sachwalter Gottes ein Schöpfer zweiter Ordnung sozusagen, cooperator dei, nicht deus.
 Diesen Ort anzuerkennen verlangt Demut, Bescheidung. Will er in Konkurrenz zu Gott dem Schöpfer treten, ihn gar übertreffen und ablösen, so wird der Mensch schließlich von diesem Frevel selber tödlich getroffen. Der Gottesglaube ist nicht, wie viele wähnen, ein Luxus, den sich manche leisten; ein privates Deutungsmuster der Lebensrätsel, ohne das manche nicht existieren können; ein Relikt aus kulturgeschichtlich überholten Zeiten, dem man wie der Folklore ein Refugium überläßt. Ohne die Ehrfurcht vor einem Größeren, ohne den Respekt vor dem nicht selber Gemachten geht der Mensch mitsamt der Natur vor die Hunde. Diesen Ort anzuerkennen verlangt Demut, Bescheidung. Will er in Konkurrenz zu Gott dem Schöpfer treten, ihn gar übertreffen und ablösen, so wird der Mensch schließlich von diesem Frevel selber tödlich getroffen. Der Gottesglaube ist nicht, wie viele wähnen, ein Luxus, den sich manche leisten; ein privates Deutungsmuster der Lebensrätsel, ohne das manche nicht existieren können; ein Relikt aus kulturgeschichtlich überholten Zeiten, dem man wie der Folklore ein Refugium überläßt. Ohne die Ehrfurcht vor einem Größeren, ohne den Respekt vor dem nicht selber Gemachten geht der Mensch mitsamt der Natur vor die Hunde.
 „Gott erkennen, heißt den Menschen neu sehen” (J. Ratzinger, Glaube als Erkenntnis und Praxis, in: Theologische Prinzipienlehre, 1982, S. 70), seine Größe und seine Grenzen, seine Möglichkeiten und seine Gefahren. „Gott erkennen, heißt den Menschen neu sehen” (J. Ratzinger, Glaube als Erkenntnis und Praxis, in: Theologische Prinzipienlehre, 1982, S. 70), seine Größe und seine Grenzen, seine Möglichkeiten und seine Gefahren.
 Aber nicht nur der vom Glauben geöffnete Blick auf den Menschen nimmt anderes wahr. Die Wirklichkeit als Ganzes und in ihren einzelnen Erscheinungen erschließt sich in anderer Weise. Sie ist nicht mehr nur totes Material, ohne feste Konturen, zur beliebigen Verwendung freigegeben. In ihr steckt vorgängig ein eigener Wert/sie birgt in sich einen vorauslaufenden Sinn. Wir Menschen können ja nicht Sinn erfinden, sondern müssen ihn finden. Wir können nicht frei schalten und walten, sondern müssen dem entsprechen, was vorgegeben ist. Aber nicht nur der vom Glauben geöffnete Blick auf den Menschen nimmt anderes wahr. Die Wirklichkeit als Ganzes und in ihren einzelnen Erscheinungen erschließt sich in anderer Weise. Sie ist nicht mehr nur totes Material, ohne feste Konturen, zur beliebigen Verwendung freigegeben. In ihr steckt vorgängig ein eigener Wert/sie birgt in sich einen vorauslaufenden Sinn. Wir Menschen können ja nicht Sinn erfinden, sondern müssen ihn finden. Wir können nicht frei schalten und walten, sondern müssen dem entsprechen, was vorgegeben ist.

 Erhard Eppler hat auf dem diesjährigen Kirchentag in Erfurt gesagt - und war sich dabei wahrscheinlich nicht bewußt, daß er in der Scholastik reflektierte Gedanken aufgenommen hat: „Jedes Tierschutzgesetz geht von einem Eigenrecht des Tieres aus, nicht unnötig gequält zu werden. Zwar wird es kaum einen bindenden Katalog der Rechte des Tieres oder der Pflanze gehen können, so wie es Menschenrechte gibt. Der Mensch darf die Tiere töten, die er zu seinem Nutzen vor ihren natürlichen Feinden schützt. Aber darf er alles? Darf er aus Tieren Freßmaschinen, Legemaschinen machen? Könnte es nicht so etwas gehen wie das Recht der Kreatur, eben diese Kreatur zu sein, das Recht des Kalbes, ein Kalb, das Recht der Henne, eine Henne zu sein, das Recht des Seehundes, in einem lebendigen Meer ein Seehund zu sein?” (in: Amtsblatt Nr. 14 vom 25.7.1988 der Ev.-luth. Kirche in Thüringen, S. 130). Erhard Eppler hat auf dem diesjährigen Kirchentag in Erfurt gesagt - und war sich dabei wahrscheinlich nicht bewußt, daß er in der Scholastik reflektierte Gedanken aufgenommen hat: „Jedes Tierschutzgesetz geht von einem Eigenrecht des Tieres aus, nicht unnötig gequält zu werden. Zwar wird es kaum einen bindenden Katalog der Rechte des Tieres oder der Pflanze gehen können, so wie es Menschenrechte gibt. Der Mensch darf die Tiere töten, die er zu seinem Nutzen vor ihren natürlichen Feinden schützt. Aber darf er alles? Darf er aus Tieren Freßmaschinen, Legemaschinen machen? Könnte es nicht so etwas gehen wie das Recht der Kreatur, eben diese Kreatur zu sein, das Recht des Kalbes, ein Kalb, das Recht der Henne, eine Henne zu sein, das Recht des Seehundes, in einem lebendigen Meer ein Seehund zu sein?” (in: Amtsblatt Nr. 14 vom 25.7.1988 der Ev.-luth. Kirche in Thüringen, S. 130).
 Das sind keine nur akademischen Überlegungen oder nostalgischen Träumereien. Das sind Artikel unseres Glaubens, die einer instrumentell verstrickten Vernunft aufhelfen können, wieder vernünftig zu werden. Das sind keine nur akademischen Überlegungen oder nostalgischen Träumereien. Das sind Artikel unseres Glaubens, die einer instrumentell verstrickten Vernunft aufhelfen können, wieder vernünftig zu werden.
 Der Glaube greift über das nur Natürliche und Kreatürliche hinaus. Gott ist der Schöpfer der „sichtbaren und der unsichtbaren Welt”. Die Kulturen und Zivilisationen, die in der Geschichte entstanden sind, verdanken sich nicht nur dem menschlichen Erfindungsgeist, sondern ebenso und zuvor Gottes Schöpfermacht. Könnte es deshalb nicht auch kulturelle Vorgaben geben, die um des Menschen willen nicht beliebig disponibel sind? Mir jedenfalls stellt sich zum Beispiel im Zusammenhang unserer Diskussion um den Schutz des Sonntags diese Frage. Der Glaube greift über das nur Natürliche und Kreatürliche hinaus. Gott ist der Schöpfer der „sichtbaren und der unsichtbaren Welt”. Die Kulturen und Zivilisationen, die in der Geschichte entstanden sind, verdanken sich nicht nur dem menschlichen Erfindungsgeist, sondern ebenso und zuvor Gottes Schöpfermacht. Könnte es deshalb nicht auch kulturelle Vorgaben geben, die um des Menschen willen nicht beliebig disponibel sind? Mir jedenfalls stellt sich zum Beispiel im Zusammenhang unserer Diskussion um den Schutz des Sonntags diese Frage.
 Mir scheint: Wie Pflanzen einen ihnen gemäßen Lebensraum - einen Biotop - brauchen, so brauchen wir Menschen soziale und kulturelle Vorgaben - einen Soziotop -, ohne den wir krank werden. Gemeint ist damit eine Rhythmisierung des Lebens mit sich abwechselnden Zeiten der Arbeit und der Feier, verläßlich wiederkehrende Gelegenheiten zum Austausch mit anderen, eine Umwelt, die nicht nur Hektik ausstrahlt, sondern auch zur Ruhe kommen läßt. Inzwischen kennen wir die bedrohlichen Folgen der Zerstörung unserer natürlichen Umwelt. Lange Zeit hat man Warnungen als sentimentale Vorgestrigkeit denunziert. Inzwischen leuchten sie ein. Der christliche Glaube plädiert mit seinem Eintreten für den Sonntag für eine kulturelle Ökologie. Das ist nicht anmaßender kirchlicher Anspruch. Das verlangt der apostolische Glaube inmitten der Zeichen der Zeit. Mir scheint: Wie Pflanzen einen ihnen gemäßen Lebensraum - einen Biotop - brauchen, so brauchen wir Menschen soziale und kulturelle Vorgaben - einen Soziotop -, ohne den wir krank werden. Gemeint ist damit eine Rhythmisierung des Lebens mit sich abwechselnden Zeiten der Arbeit und der Feier, verläßlich wiederkehrende Gelegenheiten zum Austausch mit anderen, eine Umwelt, die nicht nur Hektik ausstrahlt, sondern auch zur Ruhe kommen läßt. Inzwischen kennen wir die bedrohlichen Folgen der Zerstörung unserer natürlichen Umwelt. Lange Zeit hat man Warnungen als sentimentale Vorgestrigkeit denunziert. Inzwischen leuchten sie ein. Der christliche Glaube plädiert mit seinem Eintreten für den Sonntag für eine kulturelle Ökologie. Das ist nicht anmaßender kirchlicher Anspruch. Das verlangt der apostolische Glaube inmitten der Zeichen der Zeit.
2. Die Menschen sind sich ihrer selbst ungewiß geworden
 Es mag mit dieser eben skizzierten veränderten Rolle des Menschen in seiner Welt zusammenhängen: Der Mensch ist eigenartig unsicher geworden. „Unbehaust” hat man ihn nach dem Kriege genannt, seiner selbst rätselhaft ungewiß ist der heutige Eindruck. Wie geordnet war die Welt des deutschen Bürgers. Da war alles vorgegeben und klar und übersichtlich. Im Einklang mit seinem Lebensbereich existierte das Landvolk in einer hierarchisch gegliederten Welt. Jedem war eine Spanne Lebenszeit zugemessen. Ob oben, unten oder irgendwo mittendrin, darüber entschieden Herkommen und benennbare Glücksumstände. Ein höheres Wesen durchwaltete das Leben. Über Geburt wie Tod wie die wenigen Höhepunkte war durch ritualisierte Übereinkünfte vorentschieden. Jeder wußte, was er zu tun und zu lassen hatte. Und für fehlerhaftes Verhalten wurden die dafür vorgesehenen Sanktionen ohne großen Widerspruch akzeptiert. Wer schon forschte nach, ob etwa ein Tod auf ein Versäumnis eines Arztes zurückzuführen war? Verfügungen wurden hingenommen. Obrigkeiten hatten es nicht viel schwerer als der liebe Gott. Es mag mit dieser eben skizzierten veränderten Rolle des Menschen in seiner Welt zusammenhängen: Der Mensch ist eigenartig unsicher geworden. „Unbehaust” hat man ihn nach dem Kriege genannt, seiner selbst rätselhaft ungewiß ist der heutige Eindruck. Wie geordnet war die Welt des deutschen Bürgers. Da war alles vorgegeben und klar und übersichtlich. Im Einklang mit seinem Lebensbereich existierte das Landvolk in einer hierarchisch gegliederten Welt. Jedem war eine Spanne Lebenszeit zugemessen. Ob oben, unten oder irgendwo mittendrin, darüber entschieden Herkommen und benennbare Glücksumstände. Ein höheres Wesen durchwaltete das Leben. Über Geburt wie Tod wie die wenigen Höhepunkte war durch ritualisierte Übereinkünfte vorentschieden. Jeder wußte, was er zu tun und zu lassen hatte. Und für fehlerhaftes Verhalten wurden die dafür vorgesehenen Sanktionen ohne großen Widerspruch akzeptiert. Wer schon forschte nach, ob etwa ein Tod auf ein Versäumnis eines Arztes zurückzuführen war? Verfügungen wurden hingenommen. Obrigkeiten hatten es nicht viel schwerer als der liebe Gott.

 Solche Mentalitäten haben sich verloren. Es wird nach Gründen geforscht. Schuldige werden gesucht. Für die Dauer des Lebens sind mehr noch als das eigene Verhalten die Ärzte zuständig. Zwar gibt es noch immer Trends, denen die Mehrzahl folgt. Aber Verabredungen scheint es nicht mehr verbindlich zu geben. Man wünscht sich einen raschen und plötzlichen, möglichst unbewußten Tod oder stirbt, angeschlossen an die Apparate einer hochentwickelten Technik. Von einer ars moriendi sind wir weiter entfernt als jemals zuvor. Die Hoffnung auf eine Vollendung des Lebens in Gott durchs Sterben hindurch ist eine seltene Ausnahme. Natürlich, die Menschen sind Kreaturen geblieben. Sie lachen und weinen wie eh und je. Sie sehnen sich nach Glück und wollen ihre Ferien genießen. Aber sie können ihr Glück schwerer durch Gefährdungen hindurchretten. Aus Ehen für ein Leben werden Partnerschaften auf Zeit. Berufe müssen gewechselt werden. Das Leben, noch immer der Ernstfall, wird erfahren wie ein Experiment auf Dauer. Solche Mentalitäten haben sich verloren. Es wird nach Gründen geforscht. Schuldige werden gesucht. Für die Dauer des Lebens sind mehr noch als das eigene Verhalten die Ärzte zuständig. Zwar gibt es noch immer Trends, denen die Mehrzahl folgt. Aber Verabredungen scheint es nicht mehr verbindlich zu geben. Man wünscht sich einen raschen und plötzlichen, möglichst unbewußten Tod oder stirbt, angeschlossen an die Apparate einer hochentwickelten Technik. Von einer ars moriendi sind wir weiter entfernt als jemals zuvor. Die Hoffnung auf eine Vollendung des Lebens in Gott durchs Sterben hindurch ist eine seltene Ausnahme. Natürlich, die Menschen sind Kreaturen geblieben. Sie lachen und weinen wie eh und je. Sie sehnen sich nach Glück und wollen ihre Ferien genießen. Aber sie können ihr Glück schwerer durch Gefährdungen hindurchretten. Aus Ehen für ein Leben werden Partnerschaften auf Zeit. Berufe müssen gewechselt werden. Das Leben, noch immer der Ernstfall, wird erfahren wie ein Experiment auf Dauer.
 Was ist der Mensch? Die Frage schon wird kaum noch zugelassen. Wo alles im Fluß ist, sich ändert, ungewiß, erscheint Klarheit als Unmöglichkeit, wie eine Fata Morgana. Wo es keine anerkannte Instanz außerhalb und oberhalb des Menschen gibt, wird in der Tat die Frage des Menschen nach sich selbst zur Torheit. „Zur Freiheit verurteilt” heißt die Auskunft von Sartre. Aber Freiheiten, die niemand gewährt, die absolut sind und nur vor mir selber verantwortet werden müssen, sind ein zweifelhaftes Vergnügen. Was ist der Mensch? Die Frage schon wird kaum noch zugelassen. Wo alles im Fluß ist, sich ändert, ungewiß, erscheint Klarheit als Unmöglichkeit, wie eine Fata Morgana. Wo es keine anerkannte Instanz außerhalb und oberhalb des Menschen gibt, wird in der Tat die Frage des Menschen nach sich selbst zur Torheit. „Zur Freiheit verurteilt” heißt die Auskunft von Sartre. Aber Freiheiten, die niemand gewährt, die absolut sind und nur vor mir selber verantwortet werden müssen, sind ein zweifelhaftes Vergnügen.
 Die Menschen der Gegenwart sind ihrer selbst ungewiß geworden. Die Menschen der Gegenwart sind ihrer selbst ungewiß geworden.
 In dieser Situation sagt das Credo von Jesus Christus: In dieser Situation sagt das Credo von Jesus Christus:
„Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.”
 Eine fremde Rede ist das. Aber gibt es nicht die Erfahrung, daß ein Mensch für den anderen helfend einsteht? Vielleicht sind wir uns unserer selbst nur deshalb nicht sicher, weil wir fixiert sind auf uns selbst und zu selten auf den Menschen neben uns blicken, der für uns da sein will. Die ganze Last, die wir uns selber mit unseren kaum noch gestellten, auf jeden Fall ungelösten Fragen sind, kann keiner von unserer Art übernehmen. Deshalb muß einer zu uns kommen, der „aus dem Vater geboren ist vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt (- also nicht durch In-vitro-Fertilisation entstanden -), nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.” Eine fremde Rede ist das. Aber gibt es nicht die Erfahrung, daß ein Mensch für den anderen helfend einsteht? Vielleicht sind wir uns unserer selbst nur deshalb nicht sicher, weil wir fixiert sind auf uns selbst und zu selten auf den Menschen neben uns blicken, der für uns da sein will. Die ganze Last, die wir uns selber mit unseren kaum noch gestellten, auf jeden Fall ungelösten Fragen sind, kann keiner von unserer Art übernehmen. Deshalb muß einer zu uns kommen, der „aus dem Vater geboren ist vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt (- also nicht durch In-vitro-Fertilisation entstanden -), nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.”

 Von dieser Sprache geht Gewißheit aus. Ich selber kann auf eigene Rechnung und aus mir selber meiner selbst nicht gewiß sein. Gewißheit verbürgen auch nicht wie einstmals gesellschaftliche Verhältnisse und bürgerliche Platzanweisungen. Meiner selbst gewiß sein kann ich, weil ein anderer von weit her zu mir kommt. „Ich hab dich lieb” - das vertreibt einer Liebenden die Frage, wozu sie auf die Welt gekommen sei. „Ich bin dein Bruder”, das ist die Antwort Gottes auf die nicht einmal mehr gestellte Frage, wer wir Menschen sind: Töchter und Söhne Gottes, Freunde Jesu, gerufen in dieses und berufen zum ewigen Leben. Hier ist Gewißheit. Hier bekommt der Mensch Boden unter seine Füße. „Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn.” Von dieser Sprache geht Gewißheit aus. Ich selber kann auf eigene Rechnung und aus mir selber meiner selbst nicht gewiß sein. Gewißheit verbürgen auch nicht wie einstmals gesellschaftliche Verhältnisse und bürgerliche Platzanweisungen. Meiner selbst gewiß sein kann ich, weil ein anderer von weit her zu mir kommt. „Ich hab dich lieb” - das vertreibt einer Liebenden die Frage, wozu sie auf die Welt gekommen sei. „Ich bin dein Bruder”, das ist die Antwort Gottes auf die nicht einmal mehr gestellte Frage, wer wir Menschen sind: Töchter und Söhne Gottes, Freunde Jesu, gerufen in dieses und berufen zum ewigen Leben. Hier ist Gewißheit. Hier bekommt der Mensch Boden unter seine Füße. „Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn.”
3. Das Prinzip Hoffnung funktioniert nicht mehr
 Das Zeichen am Himmel der Neuzeit war ein vitaler Fortschrittsoptimismus. Das Mittelalter wurde dunkel genannt, die seitherige Weltgeschichte war kaum mehr als das Vorspiel zu einer Zeit allgemeinen Wohlstands und individuellen Glücks. Die Erziehung des Menschengeschlechts führe zu immer höherer Humanität. Die Reste an Barbarei werde man bald hinter sich gelassen haben. So war das Zeitgefühl. Der Marxismus ist die Verdoppelung solcher Hoffnungen, jetzt auf alle Menschen einschließlich des Proletariats ausgedehnt, nicht mehr nur beschränkt aufs Geistige und zivilisierte Formen der Gesittung, sondern ausgedehnt auf die elementaren Lebensbedingungen der Ökonomie. Das Zeichen am Himmel der Neuzeit war ein vitaler Fortschrittsoptimismus. Das Mittelalter wurde dunkel genannt, die seitherige Weltgeschichte war kaum mehr als das Vorspiel zu einer Zeit allgemeinen Wohlstands und individuellen Glücks. Die Erziehung des Menschengeschlechts führe zu immer höherer Humanität. Die Reste an Barbarei werde man bald hinter sich gelassen haben. So war das Zeitgefühl. Der Marxismus ist die Verdoppelung solcher Hoffnungen, jetzt auf alle Menschen einschließlich des Proletariats ausgedehnt, nicht mehr nur beschränkt aufs Geistige und zivilisierte Formen der Gesittung, sondern ausgedehnt auf die elementaren Lebensbedingungen der Ökonomie.
 Der Erste Weltkrieg hat solche Höhenflüge erschüttert. Und die Barbarei unserer jüngsten Geschichte - am 9. November liegt die Pogromnacht 50 Jahre zurück - hat die Idee einer allmählich wachsenden höheren Sittlichkeit als Täuschung erwiesen. Das Eis zwischen Humanität und Barbarei ist dünn, die Verführung des von älteren Bindungen frei gewordenen Menschen größer als jemals zuvor. Die chaotischen Mächte des Unbewußten sorgen für Einbrüche, die sich die durchschnittliche Alltagsvernunft nicht vorstellen kann. Der Erste Weltkrieg hat solche Höhenflüge erschüttert. Und die Barbarei unserer jüngsten Geschichte - am 9. November liegt die Pogromnacht 50 Jahre zurück - hat die Idee einer allmählich wachsenden höheren Sittlichkeit als Täuschung erwiesen. Das Eis zwischen Humanität und Barbarei ist dünn, die Verführung des von älteren Bindungen frei gewordenen Menschen größer als jemals zuvor. Die chaotischen Mächte des Unbewußten sorgen für Einbrüche, die sich die durchschnittliche Alltagsvernunft nicht vorstellen kann.
 Nein, es wird niemals alles besser und schöner und größer werden. Der Fortschritt frißt seine Kinder. Wir haben das Wort „ambivalent” in unseren Sprachschatz aufgenommen und sprechen damit von vornherein die Vermutung aus, daß jeder Gewinn auch Verlust bedeutet. Die „Dialektik der Aufklärung” (Adorno/Horkheimer) setzt nicht die Aufklärung ins Unrecht, wohl aber die Einfalt simpler Hoffnungen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung geschichtlicher Entwicklung weckt Verlegenheiten. Nein, es wird niemals alles besser und schöner und größer werden. Der Fortschritt frißt seine Kinder. Wir haben das Wort „ambivalent” in unseren Sprachschatz aufgenommen und sprechen damit von vornherein die Vermutung aus, daß jeder Gewinn auch Verlust bedeutet. Die „Dialektik der Aufklärung” (Adorno/Horkheimer) setzt nicht die Aufklärung ins Unrecht, wohl aber die Einfalt simpler Hoffnungen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung geschichtlicher Entwicklung weckt Verlegenheiten.
 Apokalyptische Visionen gehen um. Die westlichen Zivilisationen sind von Weltuntergangsstimmungen geplagt. Die Skepsis der Wissenden ist größer als ihr Optimismus. Ob es noch einmal und wie lange wohl gutgehen werde, ist ein gesellschaftliches Ratespiel in Intellektuellenkreisen vom Renommee eines Club of Rome. Apokalyptische Visionen gehen um. Die westlichen Zivilisationen sind von Weltuntergangsstimmungen geplagt. Die Skepsis der Wissenden ist größer als ihr Optimismus. Ob es noch einmal und wie lange wohl gutgehen werde, ist ein gesellschaftliches Ratespiel in Intellektuellenkreisen vom Renommee eines Club of Rome.
 Der Lebenshunger unserer Generation stellt kein Gegenargument dar. Bevor die Titanic unterging, tanzte man vergnügt. Gier ist dort am größten, wo unsicher geworden ist, wie lange ich etwas bekomme. Nihilismus produziert nicht nur Apathie, sondern auch Gier. Der Lebenshunger unserer Generation stellt kein Gegenargument dar. Bevor die Titanic unterging, tanzte man vergnügt. Gier ist dort am größten, wo unsicher geworden ist, wie lange ich etwas bekomme. Nihilismus produziert nicht nur Apathie, sondern auch Gier.
 Das wirkt sich im Alltagsverhalten aus. Eine chassidische Geschichte weiß davon so zu erzählen: Das wirkt sich im Alltagsverhalten aus. Eine chassidische Geschichte weiß davon so zu erzählen:

 „Ein Mensch mit Namen Choni ging einmal über Land und sah einen Mann, der einen Johannesbrotbaum pflanzte. Er blieb bei ihm stehen und sah ihm zu und fragte: ‚Wann wird das Bäumchen wohl Früchte tragen?’ Der Mann erwiderte: ‚In 70 Jahren.’ Da sprach Choni: ‚Du Tor! Denkst du in 70 Jahren noch zu leben und die Früchte deiner Arbeit zu genießen? Sondern pflanze lieber einen Baum, der früher Früchte trägt, daß du dich ihrer erfreust in deinem Leben.’ Der Mann aber hatte sein Werk vollendet und sah freudig darauf, und er antwortete: ‚Als ich zur Welt kam, da fand ich Johannisbrotbäume und aß von ihnen, ohne daß ich sie gepflanzt hatte, denn das hatten meine Väter getan. Habe ich nun genossen, wo ich nicht gearbeitet habe, so will ich einen Baum pflanzen für meine Kinder oder Enkel, daß sie davon genießen. Wir Menschen mögen nur bestehen, wenn einer dem anderen die Hand reicht. Siehe, ich bin ein einfacher Mann, aber wir haben ein Sprichwort: Gefährten oder Tod’.” (nach Eise Schubert-Christaller, In deinen Toren Jerusalem, 1952, S. 11 ff.) „Ein Mensch mit Namen Choni ging einmal über Land und sah einen Mann, der einen Johannesbrotbaum pflanzte. Er blieb bei ihm stehen und sah ihm zu und fragte: ‚Wann wird das Bäumchen wohl Früchte tragen?’ Der Mann erwiderte: ‚In 70 Jahren.’ Da sprach Choni: ‚Du Tor! Denkst du in 70 Jahren noch zu leben und die Früchte deiner Arbeit zu genießen? Sondern pflanze lieber einen Baum, der früher Früchte trägt, daß du dich ihrer erfreust in deinem Leben.’ Der Mann aber hatte sein Werk vollendet und sah freudig darauf, und er antwortete: ‚Als ich zur Welt kam, da fand ich Johannisbrotbäume und aß von ihnen, ohne daß ich sie gepflanzt hatte, denn das hatten meine Väter getan. Habe ich nun genossen, wo ich nicht gearbeitet habe, so will ich einen Baum pflanzen für meine Kinder oder Enkel, daß sie davon genießen. Wir Menschen mögen nur bestehen, wenn einer dem anderen die Hand reicht. Siehe, ich bin ein einfacher Mann, aber wir haben ein Sprichwort: Gefährten oder Tod’.” (nach Eise Schubert-Christaller, In deinen Toren Jerusalem, 1952, S. 11 ff.)
 Woher aber das Zutrauen nehmen, wenn es geschwunden ist? Jedenfalls ruht sogar die Vorsorge für die nächsten Generationen auf einer Verantwortung auf, die sich aus Gottvertrauen nährt und von sich selber wegblicken kann auf andere, die sein werden, wenn ich schon lange nicht mehr bin. Woher aber das Zutrauen nehmen, wenn es geschwunden ist? Jedenfalls ruht sogar die Vorsorge für die nächsten Generationen auf einer Verantwortung auf, die sich aus Gottvertrauen nährt und von sich selber wegblicken kann auf andere, die sein werden, wenn ich schon lange nicht mehr bin.
 Nachdem die Hoffnungssurrogate der Neuzeit sich erschöpft haben, gewinnt der apostolische Glaube eine neue Plausibilität: Nachdem die Hoffnungssurrogate der Neuzeit sich erschöpft haben, gewinnt der apostolische Glaube eine neue Plausibilität:
„Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist
und lebendig macht...
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.”
 Abschied nehmen läßt sich's leichter, wenn einer weiß, daß ihm die Heimat nicht verlorengeht. Unbesorgt sein um sich seihst kann der, für den gesorgt ist. Der von uns so sträflich vernachlässigte Glaube an Gottes kommende Welt ist auch das Remedium für realistische Diesseitserwartungen. Diese Erde muß entlastet werden von übergroßen Erwartungen und schädlichen Verzweiflungen. Das aber setzt voraus, daß die Menschen wieder ihre Hoffnung setzen auf Gottes Geist, der lebendig macht - hier und dort. Abschied nehmen läßt sich's leichter, wenn einer weiß, daß ihm die Heimat nicht verlorengeht. Unbesorgt sein um sich seihst kann der, für den gesorgt ist. Der von uns so sträflich vernachlässigte Glaube an Gottes kommende Welt ist auch das Remedium für realistische Diesseitserwartungen. Diese Erde muß entlastet werden von übergroßen Erwartungen und schädlichen Verzweiflungen. Das aber setzt voraus, daß die Menschen wieder ihre Hoffnung setzen auf Gottes Geist, der lebendig macht - hier und dort.
V.
 Das Wort Umkehr ist zu Hause im Zusammenhang der Gewissensforschung angesichts der Gebote. Wer lügt oder stiehlt oder die Ehe bricht, soll es künftig bleiben lassen, also umkehren. Vielleicht entspricht die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes schubah mit metanoia viel besser unserer geistesgeschichtlichen Lage, als die Philologen zulassen wollen. Metanoia, also Sinneswandel, Gewinnung einer neuen Bewußtheit, nach vorn denken und nicht nach rückwärts gehen, das ist es, was die Zeichen der Zeit von uns fordern. Neues aber liegt nicht auf der Straße, auch kein neues Bewußtsein. Das Neue war immer die Ausschöpfung noch nicht genutzter Möglichkeiten von Überkommenem, Vergessenem, Altem. Deshalb will ich unbeirrt festhalten am apostolischen Glauben, ihn nicht anpassen, biegen und verbiegen. Die Väter von Nizäa und Konstantinopel verdienen Vertrauen. Sie wollen freilich nicht nur kopiert werden. Sie verlangen eine selbständige Aneignung des alten Bekenntnisses. Mein Versuch einer Anwendung und Auslegung ist ans Ende gekommen. Das Wort Umkehr ist zu Hause im Zusammenhang der Gewissensforschung angesichts der Gebote. Wer lügt oder stiehlt oder die Ehe bricht, soll es künftig bleiben lassen, also umkehren. Vielleicht entspricht die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes schubah mit metanoia viel besser unserer geistesgeschichtlichen Lage, als die Philologen zulassen wollen. Metanoia, also Sinneswandel, Gewinnung einer neuen Bewußtheit, nach vorn denken und nicht nach rückwärts gehen, das ist es, was die Zeichen der Zeit von uns fordern. Neues aber liegt nicht auf der Straße, auch kein neues Bewußtsein. Das Neue war immer die Ausschöpfung noch nicht genutzter Möglichkeiten von Überkommenem, Vergessenem, Altem. Deshalb will ich unbeirrt festhalten am apostolischen Glauben, ihn nicht anpassen, biegen und verbiegen. Die Väter von Nizäa und Konstantinopel verdienen Vertrauen. Sie wollen freilich nicht nur kopiert werden. Sie verlangen eine selbständige Aneignung des alten Bekenntnisses. Mein Versuch einer Anwendung und Auslegung ist ans Ende gekommen.
Quatember 1989, S. 23-33
Siehe auch: Hans-Dietrich Paus - Apostolischer Glaube heute
|