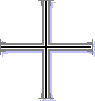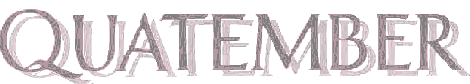Bei der Auswahl und Zuordnung der Lesungen ergibt sich für die Mitte dieser Tage eine gewisse Übereinstimmung mit dem Kalender in der römisch-katholischen Kirche (Schutzengelfest), indem am 2.10. speziell von Engeln als schützenden Begleitern (Rafael) die Rede ist. Es folgen die anderen Erzengel: am 3.10. speziell als kämpfende Mächte (Michael), am 4.10. speziell als verkündigende Boten (Gabriel). (Daß so der erst kürzlich festgelegte „Tag der deutschen Einheit” mit dem speziellen Erinnern des alten Schutzpatrons des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zusammenfällt, dem mag man Bedeutsamkeit zumessen oder auch nicht.) Bei der Auswahl und Zuordnung der Lesungen ergibt sich für die Mitte dieser Tage eine gewisse Übereinstimmung mit dem Kalender in der römisch-katholischen Kirche (Schutzengelfest), indem am 2.10. speziell von Engeln als schützenden Begleitern (Rafael) die Rede ist. Es folgen die anderen Erzengel: am 3.10. speziell als kämpfende Mächte (Michael), am 4.10. speziell als verkündigende Boten (Gabriel). (Daß so der erst kürzlich festgelegte „Tag der deutschen Einheit” mit dem speziellen Erinnern des alten Schutzpatrons des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zusammenfällt, dem mag man Bedeutsamkeit zumessen oder auch nicht.)
 Das Tagzeitenbuch zählt die Michaelis-Woche zur Trinitatiszeit III (13. bis 18. Sonntag nach Trinitatis). Der Wochen - bzw. Festpsalm 148 (Nr. 748) mit der zusagenden Antiphon :„Der Engel des Herrn lagert sich...” entspricht dem Tagzeitenbuch von 1967 und früheren Vorschlägen. Bei den Stücken zu Abend und Morgen werden nicht nur je eigene Responsorien, Hymnen und Antiphonen zu den Cantica vorgesehen (zu Johannis ist das Tagzeitenbuch da „bescheidener”), sondern auch für den Mittag gibt es einen eigenen Hymnus, während als Responsorium dasjenige vorgesehen ist, das gewöhnlicherweise im Mittagsgebet / Sext gesungen wird. (Dieses Faktum läßt sich auch so deuten, daß im Mittagsgebet gewöhnlicherweise das Responsorium von Michaelis angestimmt wird.) Dieses besonders reiche Angebot, vor allem mit drei Hymnen, bedeutet - wie oft betont - kein liturgisches Muß, sondern die Möglichkeit, die Bedeutung dieses Festes durch eine differenzierte Gestaltung zu unterstreichen. Das gilt erst recht für das Stundengebet an den Tagen, an denen die Michaelsbrüder alljährlich ihr Michaelsfest feiern. Das Tagzeitenbuch zählt die Michaelis-Woche zur Trinitatiszeit III (13. bis 18. Sonntag nach Trinitatis). Der Wochen - bzw. Festpsalm 148 (Nr. 748) mit der zusagenden Antiphon :„Der Engel des Herrn lagert sich...” entspricht dem Tagzeitenbuch von 1967 und früheren Vorschlägen. Bei den Stücken zu Abend und Morgen werden nicht nur je eigene Responsorien, Hymnen und Antiphonen zu den Cantica vorgesehen (zu Johannis ist das Tagzeitenbuch da „bescheidener”), sondern auch für den Mittag gibt es einen eigenen Hymnus, während als Responsorium dasjenige vorgesehen ist, das gewöhnlicherweise im Mittagsgebet / Sext gesungen wird. (Dieses Faktum läßt sich auch so deuten, daß im Mittagsgebet gewöhnlicherweise das Responsorium von Michaelis angestimmt wird.) Dieses besonders reiche Angebot, vor allem mit drei Hymnen, bedeutet - wie oft betont - kein liturgisches Muß, sondern die Möglichkeit, die Bedeutung dieses Festes durch eine differenzierte Gestaltung zu unterstreichen. Das gilt erst recht für das Stundengebet an den Tagen, an denen die Michaelsbrüder alljährlich ihr Michaelsfest feiern.
 Wie immer wir Engel in unser heutiges Weltverständnis einordnen, die ganze Bibel ist voll von Engelerscheinungen und in allen Phasen des Kirchenjahres, besonders auch an seinen Höhepunkten, haben diese Boten Gottes ihren Platz: Im Advent kündigen sie die Geburt des Messias (Lk 1,26 ff) und seines Vorläufers (Lk 1,11 ff) an. Zu Weihnachten vernehmen die Hirten von ihnen die „große Freude” und das „Ehre sei Gott in der Höhe” (Lk 2,10-14). Nach Epiphanias drängen sie zur Flucht vor Herodes (Mt 2,13). In den Fasten dienen sie Jesus, der dem Versucher widerstanden hat (Mt 4,11). In der Passion stärken sie den Einsamen in Gethsemane (Lk 22,43)- Zu Ostern wälzen sie den Stein vom Grab und deuten den verstörten Frauen das Ereignis (Mt 28,3-5). Bei der Himmelfahrt weisen sie die jünger auf ihren Auftrag (Apg 1,11) hin. An Pfingsten werden selbst Winde zu Gottes Boten und Feuerflammen zu seinen Dienern (Ps 104,4 / Apg 2,2.3). Und Engel begleiten dann auch den weiteren Weg der Apostel und der werdenden Kirche (Apg ,26;12,7;27,23). Wie immer wir Engel in unser heutiges Weltverständnis einordnen, die ganze Bibel ist voll von Engelerscheinungen und in allen Phasen des Kirchenjahres, besonders auch an seinen Höhepunkten, haben diese Boten Gottes ihren Platz: Im Advent kündigen sie die Geburt des Messias (Lk 1,26 ff) und seines Vorläufers (Lk 1,11 ff) an. Zu Weihnachten vernehmen die Hirten von ihnen die „große Freude” und das „Ehre sei Gott in der Höhe” (Lk 2,10-14). Nach Epiphanias drängen sie zur Flucht vor Herodes (Mt 2,13). In den Fasten dienen sie Jesus, der dem Versucher widerstanden hat (Mt 4,11). In der Passion stärken sie den Einsamen in Gethsemane (Lk 22,43)- Zu Ostern wälzen sie den Stein vom Grab und deuten den verstörten Frauen das Ereignis (Mt 28,3-5). Bei der Himmelfahrt weisen sie die jünger auf ihren Auftrag (Apg 1,11) hin. An Pfingsten werden selbst Winde zu Gottes Boten und Feuerflammen zu seinen Dienern (Ps 104,4 / Apg 2,2.3). Und Engel begleiten dann auch den weiteren Weg der Apostel und der werdenden Kirche (Apg ,26;12,7;27,23).
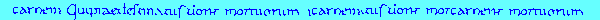
 Was wir so und in anderen Perikopen das Jahr über verstreut von Engeln erfahren, wird zu Michaelis noch einmal eigens thematisiert. Dabei gehört zur Gestalt des Erzengels Michael vor allem das Kämpferische, (vgl. Jos 5, Offb 12, 1.Mos 32, Dan 10) „zuerst den Fürst der Engel, der die Streiter führt zum Kampf.- Michael, der einst den Satan mit dem Schwerte niederzwang” (752), „wehret dem Bösen” (755), „Michael kämpfe für die Ehre Gottes, Engel des Friedens, banne Krieg und Unheil, schütze die Kirche, schütze die Erlösten vor allem Bösen” (757). Hier wird zugleich das Motiv der Bewahrung (vgl. Lk 10, 1.Mos 16, 2.Mos 23, Tob 12, Mt 18, Apg 12 u.a.) deutlich: „Christus, König, gib in Güte uns zum Hüter diesen Held, seine Kraft soll uns beschützen, bis dein großer Tag erscheint.” (752) Engel des Herrn „lagern sich um die her, die ihn fürchten” (748), „sollen dich behüten auf all deinen Wegen” (754), in ihnen ist Gott den Gläubigen „nahe, führt sie durch die Zeiten” (755), durch sie - anschaulich in der Gestalt des Rafael - wird Heilung von Krankheit, Linderung von Schmerzen, „Trost und Hilfe” sowie Begleitung „aus der Erde Dunkel” (757) erfahren. Auch die morgendliche Antiphon - durchaus als Zuspruch für die Wege des begonnenen Tages - bezieht sich indirekt darauf, wenn sie aus dem Fest-Evangelium (Lk 10, 17-20) zitiert: „Freut euch und jubelt; denn eure Namen sind im Himmel geschrieben.” (756). Was wir so und in anderen Perikopen das Jahr über verstreut von Engeln erfahren, wird zu Michaelis noch einmal eigens thematisiert. Dabei gehört zur Gestalt des Erzengels Michael vor allem das Kämpferische, (vgl. Jos 5, Offb 12, 1.Mos 32, Dan 10) „zuerst den Fürst der Engel, der die Streiter führt zum Kampf.- Michael, der einst den Satan mit dem Schwerte niederzwang” (752), „wehret dem Bösen” (755), „Michael kämpfe für die Ehre Gottes, Engel des Friedens, banne Krieg und Unheil, schütze die Kirche, schütze die Erlösten vor allem Bösen” (757). Hier wird zugleich das Motiv der Bewahrung (vgl. Lk 10, 1.Mos 16, 2.Mos 23, Tob 12, Mt 18, Apg 12 u.a.) deutlich: „Christus, König, gib in Güte uns zum Hüter diesen Held, seine Kraft soll uns beschützen, bis dein großer Tag erscheint.” (752) Engel des Herrn „lagern sich um die her, die ihn fürchten” (748), „sollen dich behüten auf all deinen Wegen” (754), in ihnen ist Gott den Gläubigen „nahe, führt sie durch die Zeiten” (755), durch sie - anschaulich in der Gestalt des Rafael - wird Heilung von Krankheit, Linderung von Schmerzen, „Trost und Hilfe” sowie Begleitung „aus der Erde Dunkel” (757) erfahren. Auch die morgendliche Antiphon - durchaus als Zuspruch für die Wege des begonnenen Tages - bezieht sich indirekt darauf, wenn sie aus dem Fest-Evangelium (Lk 10, 17-20) zitiert: „Freut euch und jubelt; denn eure Namen sind im Himmel geschrieben.” (756).
 Zudem klingt hier ein weiteres Motiv an, das mit den Engeln verbunden ist, nämlich das Lob und die Verehrung Gottes: (vgl. Hes 1 u. a.) Schon der Psalm ruft umfassend auf: „Lobt den Herrn vom Himmel her” (748) und speziell -„Lobet den Herrn, all seine Engel” (751), deren „Lobpreis, ihren Liedern schließen wir uns jubelnd an,” (752), „dir gilt der Lobpreis, den die Schöpfung darbringt ... Vor deiner Größe neigen sich in Ehrfurcht Chöre der Engel ... Und deine Kirche jubelt heut mit ihnen . - - ” (755). Zudem sind Engel --wie ihr Name sagt - verkündigende Boten Gottes, „starke Helden, die seine Befehle ausrichten” (Versikel), Gabriel vor allem, der als „Bote des Heiles” „Gottes Plan und Ratschluß” (757) verkündet. Schließlich kommt auch eine eschatologische Dimension im Engelsfest zur Geltung, allein schon wegen der zentralen Lesung aus Offenbarung 12, verbunden mit dem Evangelium aus Lukas 10, (vgl. auch Offb 14, Offb 22). Entsprechend bittet der Hymnus in der abendlichen, auf das Kommende ausgerichteten Vesper, „daß wir wachend dich erwarten, wenn du mit den Engeln kommst” und die Antiphon zum Magnificat unterstreicht es: „Der Menschensohn wird kommen mit all seinen Engeln und er wird sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit.” (753) Zudem klingt hier ein weiteres Motiv an, das mit den Engeln verbunden ist, nämlich das Lob und die Verehrung Gottes: (vgl. Hes 1 u. a.) Schon der Psalm ruft umfassend auf: „Lobt den Herrn vom Himmel her” (748) und speziell -„Lobet den Herrn, all seine Engel” (751), deren „Lobpreis, ihren Liedern schließen wir uns jubelnd an,” (752), „dir gilt der Lobpreis, den die Schöpfung darbringt ... Vor deiner Größe neigen sich in Ehrfurcht Chöre der Engel ... Und deine Kirche jubelt heut mit ihnen . - - ” (755). Zudem sind Engel --wie ihr Name sagt - verkündigende Boten Gottes, „starke Helden, die seine Befehle ausrichten” (Versikel), Gabriel vor allem, der als „Bote des Heiles” „Gottes Plan und Ratschluß” (757) verkündet. Schließlich kommt auch eine eschatologische Dimension im Engelsfest zur Geltung, allein schon wegen der zentralen Lesung aus Offenbarung 12, verbunden mit dem Evangelium aus Lukas 10, (vgl. auch Offb 14, Offb 22). Entsprechend bittet der Hymnus in der abendlichen, auf das Kommende ausgerichteten Vesper, „daß wir wachend dich erwarten, wenn du mit den Engeln kommst” und die Antiphon zum Magnificat unterstreicht es: „Der Menschensohn wird kommen mit all seinen Engeln und er wird sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit.” (753)
 Unter einfachen Verhältnissen mag man sich damit begnügen, zur Michaeliswoche eben den Wochenpsalm 148 (748) zu singen und die vorgesehenen Lesungen (84) und Gebete (185.1; 294) zu verwenden. Darüber hinaus schlägt das Tagzeitenbuch neben den oben genannten Propriumstücken (751-757) einen besonderen Auftakt vor. Da das Michaelisfest datumsgebunden ist und somit auf keinen festen Wochentag fällt, sollte als Tagespsalm 98 gesungen werden, durch den sich eine Beziehung zum österlichen Lob (Wochenpsalm von Kantate - 611) ergibt. Am Vorabend, der durch ein Luzernar (245) mit der oben erwähnten Benediktion (189.16) festlich eingeleitet werden kann, wird durch den erwartungsvollen Psalm 121 und die Antiphon „Er hat seinen Engeln befohlen” (903) die behütende Macht Gottes in den Engeln betont, während die Lesung (Hes 1,4-6.10-14) die Engel als verkündigende und anbetende Diener zeigt. Am Morgen, dem die Hauptlesungen (Jos 5,13-15 - Offb 12,7 - Lk 10,17-20) zugeordnet sind, soll mit Psalm 145 A und dem „Heilig, heilig, heilig” (660) das himmlische Lob ihres „Herrn der Heerscharen” durch eben die Engel anklingen, wie es Jesaja im Tempel (Jes 6,3) vernommen hat. Unter einfachen Verhältnissen mag man sich damit begnügen, zur Michaeliswoche eben den Wochenpsalm 148 (748) zu singen und die vorgesehenen Lesungen (84) und Gebete (185.1; 294) zu verwenden. Darüber hinaus schlägt das Tagzeitenbuch neben den oben genannten Propriumstücken (751-757) einen besonderen Auftakt vor. Da das Michaelisfest datumsgebunden ist und somit auf keinen festen Wochentag fällt, sollte als Tagespsalm 98 gesungen werden, durch den sich eine Beziehung zum österlichen Lob (Wochenpsalm von Kantate - 611) ergibt. Am Vorabend, der durch ein Luzernar (245) mit der oben erwähnten Benediktion (189.16) festlich eingeleitet werden kann, wird durch den erwartungsvollen Psalm 121 und die Antiphon „Er hat seinen Engeln befohlen” (903) die behütende Macht Gottes in den Engeln betont, während die Lesung (Hes 1,4-6.10-14) die Engel als verkündigende und anbetende Diener zeigt. Am Morgen, dem die Hauptlesungen (Jos 5,13-15 - Offb 12,7 - Lk 10,17-20) zugeordnet sind, soll mit Psalm 145 A und dem „Heilig, heilig, heilig” (660) das himmlische Lob ihres „Herrn der Heerscharen” durch eben die Engel anklingen, wie es Jesaja im Tempel (Jes 6,3) vernommen hat.
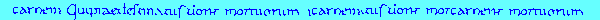
 Und am Abend, wenn mit dem spöttischen Triumphlied (Jes 14,317) auf den sich selbst erhebenden „Fürsten dieser Welt” und „altbösen Feind” (EG 362), den „schönen Morgenstern” und seinen Sturz, Motive der morgendlichen Lesungen (Sturz des Satans) noch einmal aufgenommen werden, so führt Psalm 33 B und seine Antiphon „Dem König aller Könige” (769) genau darauf hin: Es wird gleichsam auf die Michaelisfrage „Wer ist wie Gott” geantwortet, daß nur Gott, „der allein Unsterblichkeit hat, Ehre und ewige Macht” gebührt und er allein die schützende Macht für sein Volk, „unser Schild und unsre Hilfe” darstellt. (Dies alles ist auch bei der alternativen Lesung aus 2.Kön 6,8-17 passend.) Für die weiteren Tage ergeben sich die Tagespsalmen aus der Einordnung der Michaeliswoche in den Block Trinitatis 111 (735-757), wobei die Psalmen bzw. ihre Antiphonen häufig „michaelische” Motive enthalten, die so auch die umgebenden Wochen zwischen dem 13. und 18. Sonntag nach Trinitatis mitprägen: „Der Herr der Heerscharen ist mit uns” (735) - „Dir gebührt Lobpreis” (736) - er wird „bewahren, uns behüten” (737), - daß man „deine Gerechtigkeit rühme” (738) denn: „Ich vertraue auf Gott ... Was können Menschen mir antun?” (740), „Gott erlöst meine Seele, er entreißt mich der Gewalt des Todes” (741) Und am Abend, wenn mit dem spöttischen Triumphlied (Jes 14,317) auf den sich selbst erhebenden „Fürsten dieser Welt” und „altbösen Feind” (EG 362), den „schönen Morgenstern” und seinen Sturz, Motive der morgendlichen Lesungen (Sturz des Satans) noch einmal aufgenommen werden, so führt Psalm 33 B und seine Antiphon „Dem König aller Könige” (769) genau darauf hin: Es wird gleichsam auf die Michaelisfrage „Wer ist wie Gott” geantwortet, daß nur Gott, „der allein Unsterblichkeit hat, Ehre und ewige Macht” gebührt und er allein die schützende Macht für sein Volk, „unser Schild und unsre Hilfe” darstellt. (Dies alles ist auch bei der alternativen Lesung aus 2.Kön 6,8-17 passend.) Für die weiteren Tage ergeben sich die Tagespsalmen aus der Einordnung der Michaeliswoche in den Block Trinitatis 111 (735-757), wobei die Psalmen bzw. ihre Antiphonen häufig „michaelische” Motive enthalten, die so auch die umgebenden Wochen zwischen dem 13. und 18. Sonntag nach Trinitatis mitprägen: „Der Herr der Heerscharen ist mit uns” (735) - „Dir gebührt Lobpreis” (736) - er wird „bewahren, uns behüten” (737), - daß man „deine Gerechtigkeit rühme” (738) denn: „Ich vertraue auf Gott ... Was können Menschen mir antun?” (740), „Gott erlöst meine Seele, er entreißt mich der Gewalt des Todes” (741)
 Wie schon erwähnt, finden sich im Mittagsgebet, so wie es sich im Umkreis der Michaelsbruderschaft entwickelt hat, deutliche, wenngleich verhaltene Bezüge zur Engelsthematik. In dieser Hore zu der Tageszeit, in der Abraham in Mamre Gott in Gestalt der drei Boten erscheint („als der Tag am heißesten war”- 1.Mos 18,1) und ihm mit Sara einen Sohn verheißt, (das Vorbild für die Dreifaltigkeitsikone der Ostkirche), heißt es im gewöhnlichen Responsorium: „Im Angesicht deiner Engel will ich dir lobsingen.” (237) Schon seit dem Gebet der Tageszeiten (1924) wird mit dem „Heilig, heilig, heilig” das mittägliche Gebet der Anbetung abgeschlossen, ursprünglich in der Fassung des Gesangs der Serafim nach Jes 6,3, später in der Fassung des Lobpreises der vier Gestalten (nach Hes 1) aus Offb 4,8. Wird durch diesen Lobgesang der Engel die Heiligkeit Gottes als des ganz Anderen (Tremendum im Sinn Rudolf Ottos) betont, stellt der folgende, (später hinzugefügte) Angelus: „Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft...” die Nähe Gottes in Christus heraus, läßt gleichsam das Fascinosum in seiner Menschwerdung aufleuchten, die durch den Engel verkündet wird. Wie schon erwähnt, finden sich im Mittagsgebet, so wie es sich im Umkreis der Michaelsbruderschaft entwickelt hat, deutliche, wenngleich verhaltene Bezüge zur Engelsthematik. In dieser Hore zu der Tageszeit, in der Abraham in Mamre Gott in Gestalt der drei Boten erscheint („als der Tag am heißesten war”- 1.Mos 18,1) und ihm mit Sara einen Sohn verheißt, (das Vorbild für die Dreifaltigkeitsikone der Ostkirche), heißt es im gewöhnlichen Responsorium: „Im Angesicht deiner Engel will ich dir lobsingen.” (237) Schon seit dem Gebet der Tageszeiten (1924) wird mit dem „Heilig, heilig, heilig” das mittägliche Gebet der Anbetung abgeschlossen, ursprünglich in der Fassung des Gesangs der Serafim nach Jes 6,3, später in der Fassung des Lobpreises der vier Gestalten (nach Hes 1) aus Offb 4,8. Wird durch diesen Lobgesang der Engel die Heiligkeit Gottes als des ganz Anderen (Tremendum im Sinn Rudolf Ottos) betont, stellt der folgende, (später hinzugefügte) Angelus: „Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft...” die Nähe Gottes in Christus heraus, läßt gleichsam das Fascinosum in seiner Menschwerdung aufleuchten, die durch den Engel verkündet wird.
 Und da nach liturgischen Gestaltungsprinzipien in der Regel das Bedeutsamere am Schluß steht, mag auch diese Form zeigen, wie Engel an Gott bzw. Christus verweisen und wir aus ihrer Botschaft vernehmen sollen, daß wir „durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen.” (234) So versteht sich auch, daß die Engel ihre Botschaft oft mit dem „Fürchte dich nicht” einleiten (müssen), sind sie doch zunächst Zeugen der überwältigenden und aufschreckenden Macht und Hoheit Gottes, die den Menschen ihre Ferne, ja ihr Getrenntsein von Gott erfahren lassen (2.Mos 3; Jes 6; Dan 10). Dann aber werden sie zu Boten der Nähe Gottes, indem sich durch ihr Wort der Zusage die Situation verwandelt in eine Einladung zu Vertrauen und Glaube. Diese charakteristische Bewegung, zu der uns Engelsbegegnungen letztlich führen wollen, findet sich ja auch in Luthers Erklärungen zu allen Geboten, wenn er beides nebeneinander nennt: „Wir sollen Gott fürchten und lieben...” Und da nach liturgischen Gestaltungsprinzipien in der Regel das Bedeutsamere am Schluß steht, mag auch diese Form zeigen, wie Engel an Gott bzw. Christus verweisen und wir aus ihrer Botschaft vernehmen sollen, daß wir „durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen.” (234) So versteht sich auch, daß die Engel ihre Botschaft oft mit dem „Fürchte dich nicht” einleiten (müssen), sind sie doch zunächst Zeugen der überwältigenden und aufschreckenden Macht und Hoheit Gottes, die den Menschen ihre Ferne, ja ihr Getrenntsein von Gott erfahren lassen (2.Mos 3; Jes 6; Dan 10). Dann aber werden sie zu Boten der Nähe Gottes, indem sich durch ihr Wort der Zusage die Situation verwandelt in eine Einladung zu Vertrauen und Glaube. Diese charakteristische Bewegung, zu der uns Engelsbegegnungen letztlich führen wollen, findet sich ja auch in Luthers Erklärungen zu allen Geboten, wenn er beides nebeneinander nennt: „Wir sollen Gott fürchten und lieben...”
Quatember 2000, S. 184-189
© Reinhard Brandhorst, Stuttgart
|