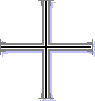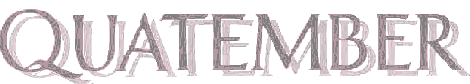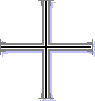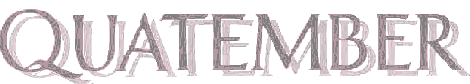Ein Kennzeichen der modernen Welt und gegenwärtigen Zeit, der „Neuzeit” also, die seit Martin Luther und dem Ende des abendländisch-christlichen Mittelalters datiert, mag in dem Nebeneinanderbestehen christlich denkender und glaubender Menschen und Nicht-Christen erblickt werden. Beide, Christen und Nicht-Christen, Nicht-mehr-Christen, beide stehen unausweichlich in einem reziproken Verhältnis zueinander. Der Zahl, der Quantität nach befinden sich die Christen äußerlich in der Mehrzahl, innerlich aber in, wenn man menschlich sprechen darf, erschreckender Minderheit. Das bedingt, daß sich der wahrhaft Christgläubige welcher Konfession und inneren Substanz auch immer ausgesetzt weiß ständigen Begegnungen und Konfrontierungen mit Mitmenschen, die seinesgleichen sind etwa dem Stande, dem Berufe, der Volkszugehörigkeit, also der Sprache nach, und die dennoch eine andere Sprache sprechen, eine andere Gesinnung und Denkart zeigen. Wie verhält sich der Christgläubige sui generis vielfach diesen andersgläubigen, diesen nicht-christlichen Menschen gegenüber? Und wie sollte er - christlich und menschlich gesehen - sich ihnen gegenüber verhalten? Ein Kennzeichen der modernen Welt und gegenwärtigen Zeit, der „Neuzeit” also, die seit Martin Luther und dem Ende des abendländisch-christlichen Mittelalters datiert, mag in dem Nebeneinanderbestehen christlich denkender und glaubender Menschen und Nicht-Christen erblickt werden. Beide, Christen und Nicht-Christen, Nicht-mehr-Christen, beide stehen unausweichlich in einem reziproken Verhältnis zueinander. Der Zahl, der Quantität nach befinden sich die Christen äußerlich in der Mehrzahl, innerlich aber in, wenn man menschlich sprechen darf, erschreckender Minderheit. Das bedingt, daß sich der wahrhaft Christgläubige welcher Konfession und inneren Substanz auch immer ausgesetzt weiß ständigen Begegnungen und Konfrontierungen mit Mitmenschen, die seinesgleichen sind etwa dem Stande, dem Berufe, der Volkszugehörigkeit, also der Sprache nach, und die dennoch eine andere Sprache sprechen, eine andere Gesinnung und Denkart zeigen. Wie verhält sich der Christgläubige sui generis vielfach diesen andersgläubigen, diesen nicht-christlichen Menschen gegenüber? Und wie sollte er - christlich und menschlich gesehen - sich ihnen gegenüber verhalten?
 Es gibt, um das an sich komplexe Phänomen auf einfache und einleuchtende Normen zurückzuführen, zwei Grundhaltungen oder Grundverhaltungsweisen, die hier zu beobachten sind. Eine jede trägt ihre Gefahr, aber auch ihre Wahrheit in sich. Zunächst kann der Christ den Begegnungen mit Nicht-Christen grundsätzlich auszuweichen versuchen. Die theologische Frage der „Welt”, und des für den Christen gültigen Wortes vom Nicht-in-der-Welt-Sein wird hier angerührt. Die Kirche als die Ekklesia, die aus der Welt-Bindung herausgelöste Gottesgemeinschaft, ist der eigentliche „Ort”, der Heimatort des eben in der Welt nicht beheimateten Christen, des homo viator. Welche Gefahren mit dieser scheinbaren oder wirklichen Weltflucht gegeben sind, möge hier nicht näher ausgeführt werden. dem Nicht-Christen und seiner Ärgernis oder Versuchung erregenden, bedrückenden oder gefährlichen Begegnung entzieht sich der Christ, doch auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Es gibt, um das an sich komplexe Phänomen auf einfache und einleuchtende Normen zurückzuführen, zwei Grundhaltungen oder Grundverhaltungsweisen, die hier zu beobachten sind. Eine jede trägt ihre Gefahr, aber auch ihre Wahrheit in sich. Zunächst kann der Christ den Begegnungen mit Nicht-Christen grundsätzlich auszuweichen versuchen. Die theologische Frage der „Welt”, und des für den Christen gültigen Wortes vom Nicht-in-der-Welt-Sein wird hier angerührt. Die Kirche als die Ekklesia, die aus der Welt-Bindung herausgelöste Gottesgemeinschaft, ist der eigentliche „Ort”, der Heimatort des eben in der Welt nicht beheimateten Christen, des homo viator. Welche Gefahren mit dieser scheinbaren oder wirklichen Weltflucht gegeben sind, möge hier nicht näher ausgeführt werden. dem Nicht-Christen und seiner Ärgernis oder Versuchung erregenden, bedrückenden oder gefährlichen Begegnung entzieht sich der Christ, doch auch nur bis zu einer gewissen Grenze.
 Denn dadurch, daß er sagen wir als echter Mönch in seiner Zelle betend von der Welt abgeschieden in der Gemeinschaft christlicher Mitbrüder Gott zu dienen versucht, wirkt er beispielhaft und in einem gleichsam ungesprochenen, aber sehr eindringlichen Gespräch mit denen, die dieses Dasein als lächerlich, als verfehlt, als widersinnig, als „Ärgernis” empfinden, auch auf die nicht-christliche Welt. Sobald aber das Sichabschließen den Charakter konventikelhafter Engigkeit und Überheblichkeit annimmt, sobald die kleine oder größere Schar der „Gläubigen”, die sich subjektiv als echte Christen fühlen, auf die außerhalb ihrer Gemeinschaft stehenden Nicht-Christen in welcher Form auch immer herabsieht, wird die echte Begegnung von Christ zu Nicht-Christ empfindlich gestört, ja oft für immer zunichte gemacht. Denn dadurch, daß er sagen wir als echter Mönch in seiner Zelle betend von der Welt abgeschieden in der Gemeinschaft christlicher Mitbrüder Gott zu dienen versucht, wirkt er beispielhaft und in einem gleichsam ungesprochenen, aber sehr eindringlichen Gespräch mit denen, die dieses Dasein als lächerlich, als verfehlt, als widersinnig, als „Ärgernis” empfinden, auch auf die nicht-christliche Welt. Sobald aber das Sichabschließen den Charakter konventikelhafter Engigkeit und Überheblichkeit annimmt, sobald die kleine oder größere Schar der „Gläubigen”, die sich subjektiv als echte Christen fühlen, auf die außerhalb ihrer Gemeinschaft stehenden Nicht-Christen in welcher Form auch immer herabsieht, wird die echte Begegnung von Christ zu Nicht-Christ empfindlich gestört, ja oft für immer zunichte gemacht.

 Aber wenden wir uns der zweiten Grundhaltung zu, die anscheinend positiverer Art ist: die einer vielleicht nicht gewollten, aber auch nicht gescheuten Begegnung und Konfrontation. Sie vollzieht sich im Raum der Welt und des Weltlichen, also in der konkreten Wirklichkeit, ja der oft erschreckenden Nüchternheit, Härte und Grausamkeit des Alltäglichen. Sie vollzieht sich in den verschiedensten Formen und endet meist, vom bloß Menschlichen aus gesehen, als Niederlage. Ihr gilt es, vom Gewissen des an Christus gläubig gebundenen, darum sich Christ nennenden Menschen her, auf den Grund zu gehen. Vielleicht darf als Erstes dazu gesagt werden, was wir schon andeuteten: daß diese Begegnungen weniger gesucht, gewollt sind, aber auch - wenn sie erfolgen - nicht gescheut werden. Gesucht müßten sie werden, wenn es dem Christen m jeder Weise auf Missionierung, auf Bekehrung ankäme. Aber wenden wir uns der zweiten Grundhaltung zu, die anscheinend positiverer Art ist: die einer vielleicht nicht gewollten, aber auch nicht gescheuten Begegnung und Konfrontation. Sie vollzieht sich im Raum der Welt und des Weltlichen, also in der konkreten Wirklichkeit, ja der oft erschreckenden Nüchternheit, Härte und Grausamkeit des Alltäglichen. Sie vollzieht sich in den verschiedensten Formen und endet meist, vom bloß Menschlichen aus gesehen, als Niederlage. Ihr gilt es, vom Gewissen des an Christus gläubig gebundenen, darum sich Christ nennenden Menschen her, auf den Grund zu gehen. Vielleicht darf als Erstes dazu gesagt werden, was wir schon andeuteten: daß diese Begegnungen weniger gesucht, gewollt sind, aber auch - wenn sie erfolgen - nicht gescheut werden. Gesucht müßten sie werden, wenn es dem Christen m jeder Weise auf Missionierung, auf Bekehrung ankäme.
 Aber gilt der Tauf- und Missionsbefehl, den der Herr zu seiner Zeit den Jüngern gab, auch für uns Christen des 20. Jahrhunderts unseren Nicht-mehr-Christenbrüdern gegenüber? Die neuartige Situation für den Christen unserer Zeit liegt ja auch darin, daß er nicht mehr im echten Sinne „Heiden” gegenübersteht, sondern „Abtrünnigen” oder Menschen, suchenden Menschen, die von der Gnade noch nicht ergriffen vor den Toren der Kirche stehen, wie man gesagt hat, die gleichsam im Schatten des Christus leben, der der Herr auch ihrer Welt wie „unserer” Kirche ist. Auf die Komplexität dieser Schichten und Schichtungen außerhalb des christlichen Glaubens mag in diesem Zusammenhang nur verwiesen werden. Zahllose „Mischformen” begegnen uns hier, von der Tatsache ganz zu schweigen, daß innerhalb der Christenheit selbst, oder konkreter gesprochen innerhalb dessen, was wir Evangelische Kirche und christliche Gemeinschaft nenen, also der praktizierenden Christen auch keine wirkliche Einheitlichkeit gegeben ist. Schon das Wort jenes Mannes aus dem Volke, des Vaters seines fallsüchtigen Kindes: „Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (Mark. 9, 24) zeigt, daß der Riß mitten durch unser „christliches” Herz geht, daß der Christ und der Nicht-Christ, der Glaubende und der Zweifelnde, sich ständig in unserer eigenen Brust gegenüberstehen, einander bedrängen, versuchen, „heimsuchen”. Aber gilt der Tauf- und Missionsbefehl, den der Herr zu seiner Zeit den Jüngern gab, auch für uns Christen des 20. Jahrhunderts unseren Nicht-mehr-Christenbrüdern gegenüber? Die neuartige Situation für den Christen unserer Zeit liegt ja auch darin, daß er nicht mehr im echten Sinne „Heiden” gegenübersteht, sondern „Abtrünnigen” oder Menschen, suchenden Menschen, die von der Gnade noch nicht ergriffen vor den Toren der Kirche stehen, wie man gesagt hat, die gleichsam im Schatten des Christus leben, der der Herr auch ihrer Welt wie „unserer” Kirche ist. Auf die Komplexität dieser Schichten und Schichtungen außerhalb des christlichen Glaubens mag in diesem Zusammenhang nur verwiesen werden. Zahllose „Mischformen” begegnen uns hier, von der Tatsache ganz zu schweigen, daß innerhalb der Christenheit selbst, oder konkreter gesprochen innerhalb dessen, was wir Evangelische Kirche und christliche Gemeinschaft nenen, also der praktizierenden Christen auch keine wirkliche Einheitlichkeit gegeben ist. Schon das Wort jenes Mannes aus dem Volke, des Vaters seines fallsüchtigen Kindes: „Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (Mark. 9, 24) zeigt, daß der Riß mitten durch unser „christliches” Herz geht, daß der Christ und der Nicht-Christ, der Glaubende und der Zweifelnde, sich ständig in unserer eigenen Brust gegenüberstehen, einander bedrängen, versuchen, „heimsuchen”.
 Auf welche Weise und in welcher Situation auch immer der Christ dem Nicht-Christen begegnet, so kommt es auf das echte Verhalten und „Antworten” an, soll es nicht zu einem sinnlosen, ja mehr noch schuldhaften - für den christlichen Partner schuld haften - Verfehlen dieser gegebenen, ihm auferlegten Begegnung kommen. Die größte Gefahr, die hier ständig dem Christen lauert, scheint mir ein wenn auch noch so sublimierter „geistlicher” Hochmut zu sein. Wir berühren damit das heikle Kapitel des gut oder schlecht gemeinten „Missionierens”, des Bekehrenwollens andersdenkender, anders- oder nichtgläubiger (im Sinne des Christentums) Mitmenschen, die menschlich und geistig auf gleicher Stufe stehen. Es ist erschreckend, wie sehr hier an sich echte christlich gläubige Menschen in guter Absicht Seelen verletzt und zurückgestoßen haben, weil sie in seltsamer Verblendung die Rolle des „Gebenden”, des Sichherablassenden einnahmen und nicht im Stande waren, durch ein wartendes, betendes Schweigen hindurch jene zaghaften und scheubaren Entfaltungen der Seele des Anderen gleichsam von selbst, in Wirklichkeit kraft der Gnade Gottes sich vollziehen zu lassen. Die Ungläubigkeit der Welt beruht zu einem großen Teil auf der falschen, das brüderliche Du des anderen Menschen verfehlenden Ubergläubigkeit solcher Christen, mögen sie Laien oder Theologen, sogenannte „Seelsorger” sein. Auf welche Weise und in welcher Situation auch immer der Christ dem Nicht-Christen begegnet, so kommt es auf das echte Verhalten und „Antworten” an, soll es nicht zu einem sinnlosen, ja mehr noch schuldhaften - für den christlichen Partner schuld haften - Verfehlen dieser gegebenen, ihm auferlegten Begegnung kommen. Die größte Gefahr, die hier ständig dem Christen lauert, scheint mir ein wenn auch noch so sublimierter „geistlicher” Hochmut zu sein. Wir berühren damit das heikle Kapitel des gut oder schlecht gemeinten „Missionierens”, des Bekehrenwollens andersdenkender, anders- oder nichtgläubiger (im Sinne des Christentums) Mitmenschen, die menschlich und geistig auf gleicher Stufe stehen. Es ist erschreckend, wie sehr hier an sich echte christlich gläubige Menschen in guter Absicht Seelen verletzt und zurückgestoßen haben, weil sie in seltsamer Verblendung die Rolle des „Gebenden”, des Sichherablassenden einnahmen und nicht im Stande waren, durch ein wartendes, betendes Schweigen hindurch jene zaghaften und scheubaren Entfaltungen der Seele des Anderen gleichsam von selbst, in Wirklichkeit kraft der Gnade Gottes sich vollziehen zu lassen. Die Ungläubigkeit der Welt beruht zu einem großen Teil auf der falschen, das brüderliche Du des anderen Menschen verfehlenden Ubergläubigkeit solcher Christen, mögen sie Laien oder Theologen, sogenannte „Seelsorger” sein.

 Der französische Philosoph und Dichter Gabriel Marcel hat hierüber in einem Vortrag „Die Gefährdung der ethischen Werte” (veröffentlicht in dem auch deutsch erschienenen Buch „Homo viator. Philosophie der Hoffnung”, Bastion-Verlag, Düsseldorf) zu beherzigende Worte gesagt, die ich kurz zitieren möchte: Er fragt, ob der Christ, „um diesem Begriff seinen Sinn und seinen Wert zu erhalten, das Recht oder die Pflicht einer Bevormundung des Nicht-Christen beanspruchen dürfe?” Ob er „einem geistigen Patemalismus huldigen dürfe, der zugleich die Last und der Gewinn des Christlichen wäre?”, und antwortet: „Ich bin überzeugt, daß das eine in jeder Hinsicht unhaltbare Position wäre. Auf der einen Seite hätte sie für den Christen fast unausweichlich das Gefühl einer pharisäischen Überlegenheit zur Folge, und auf der anderen Seite würde sie ebenso zwangsläufig beim Ungläubigen eine Art Erbitterung erzeugen: jene invidia, die wahrscheinlich die Wurzel der antireligiösen Leidenschaft ist. Der Christ kann sich also auf keine Weise als mit einer Macht oder mit einer Gabe ausgestattet betrachten, die dem Ungläubigen verweigert wäre; und hier liegt einer der paradoxesten Aspekte seiner Situation, denn in einem anderen Sinn muß man sehr wohl zugeben, daß ihm eine Gnade zugeteilt ist. Aber das bleibt nur unter der Bedingung wahr, daß diese Gnade in ihm nicht nur Strahlung, sondern auch Demut ist; in dem Augenblick, da er auf sie wie auf einen Besitz zu pochen beginnt, verändert sie ihr Wesen; fast möchte ich sagen: sie wird ein Fluch.” Der französische Philosoph und Dichter Gabriel Marcel hat hierüber in einem Vortrag „Die Gefährdung der ethischen Werte” (veröffentlicht in dem auch deutsch erschienenen Buch „Homo viator. Philosophie der Hoffnung”, Bastion-Verlag, Düsseldorf) zu beherzigende Worte gesagt, die ich kurz zitieren möchte: Er fragt, ob der Christ, „um diesem Begriff seinen Sinn und seinen Wert zu erhalten, das Recht oder die Pflicht einer Bevormundung des Nicht-Christen beanspruchen dürfe?” Ob er „einem geistigen Patemalismus huldigen dürfe, der zugleich die Last und der Gewinn des Christlichen wäre?”, und antwortet: „Ich bin überzeugt, daß das eine in jeder Hinsicht unhaltbare Position wäre. Auf der einen Seite hätte sie für den Christen fast unausweichlich das Gefühl einer pharisäischen Überlegenheit zur Folge, und auf der anderen Seite würde sie ebenso zwangsläufig beim Ungläubigen eine Art Erbitterung erzeugen: jene invidia, die wahrscheinlich die Wurzel der antireligiösen Leidenschaft ist. Der Christ kann sich also auf keine Weise als mit einer Macht oder mit einer Gabe ausgestattet betrachten, die dem Ungläubigen verweigert wäre; und hier liegt einer der paradoxesten Aspekte seiner Situation, denn in einem anderen Sinn muß man sehr wohl zugeben, daß ihm eine Gnade zugeteilt ist. Aber das bleibt nur unter der Bedingung wahr, daß diese Gnade in ihm nicht nur Strahlung, sondern auch Demut ist; in dem Augenblick, da er auf sie wie auf einen Besitz zu pochen beginnt, verändert sie ihr Wesen; fast möchte ich sagen: sie wird ein Fluch.”
 Marcel fährt fort: „Und eben im Namen dieser Demut, um deren Wesen die Philosophen (wie auch die Theologen, möchte ich Marcel ergänzen) sich im allgemeinen so wenig bemüht haben, muß der Christ beständig gegen die patemalistische Versuchung aus der Hut sein. An der Wurzel dieser Demut liegt eine Gewißheit oder, wie ich gerne sagen möchte, ein Wissen: das Wissen nämlich, daß er als Christ weder auf eigene Rechnung handelt noch vermöge einer Kraft, die ihm gehörte oder die auch nur, nachdem sie ihm ursprünglich eingeflößt, sein echter Besitz geworden wäre. Unter diesen Voraussetzungen kann er auf keine Weise den Anspruch erheben, mehr wert zu sein als sein enterbter Bruder, an den er sich zu wenden hat. Selbst das wäre schon von seiner Seite eine unerlaubte Anmaßung, wenn er sich rühmte, einen guten Herrn oder einen guten Meister zu haben, während der Ungläubige niemand habe; denn damit würde er sich wieder auf die Ebene des Habens stellen, auf die Ebene, auf der man auf das pocht, was man besitzt.” Marcel fährt fort: „Und eben im Namen dieser Demut, um deren Wesen die Philosophen (wie auch die Theologen, möchte ich Marcel ergänzen) sich im allgemeinen so wenig bemüht haben, muß der Christ beständig gegen die patemalistische Versuchung aus der Hut sein. An der Wurzel dieser Demut liegt eine Gewißheit oder, wie ich gerne sagen möchte, ein Wissen: das Wissen nämlich, daß er als Christ weder auf eigene Rechnung handelt noch vermöge einer Kraft, die ihm gehörte oder die auch nur, nachdem sie ihm ursprünglich eingeflößt, sein echter Besitz geworden wäre. Unter diesen Voraussetzungen kann er auf keine Weise den Anspruch erheben, mehr wert zu sein als sein enterbter Bruder, an den er sich zu wenden hat. Selbst das wäre schon von seiner Seite eine unerlaubte Anmaßung, wenn er sich rühmte, einen guten Herrn oder einen guten Meister zu haben, während der Ungläubige niemand habe; denn damit würde er sich wieder auf die Ebene des Habens stellen, auf die Ebene, auf der man auf das pocht, was man besitzt.”
 Das Kernproblem des „richtigen” Verhaltens des Christen dem Nicht-Christen gegenüber liegt also in der paradoxen Demut eines Sichbegnadetwissens, eines „Heils”, das dennoch in keiner Weise verfügbar, übertragbar, lehrbar ist, einer Macht also, die zugleich Ohnmacht in sich schließt. Der Christ kann dem Nicht-Christen m keiner Weise etwas zubringen, was diesem fehlt: . „eine solche Anmaßung würde tatsächlich stets das Gut, das es zu vermitteln gilt, unfruchtbar machen, ja zerstören”, sagt hierzu mit Recht Marcel. Was können wir also als Christen in der Begegnung mit dem Nicht-Christen, im zufälligen oder gewollten Gespräch mit dem Ungläubigen wahrhaft tun, ohne zu verletzen oder gar zu zerstören? Was dürfen, ja müssen aber auch wir in gerechter Verteidigung sagen oder tun, wenn umgekehrt der Nicht-Christ, meist ist es der von innerer Unruhe und einer Art schlechten Gewissens getriebene Nichtmehr-Christ, aggressiv und überheblich von seiner Position aus uns mitleidig belächelnd angeht, wie man nur einen Gegner angeht, nicht aber einen Menschenbruder? Das Kernproblem des „richtigen” Verhaltens des Christen dem Nicht-Christen gegenüber liegt also in der paradoxen Demut eines Sichbegnadetwissens, eines „Heils”, das dennoch in keiner Weise verfügbar, übertragbar, lehrbar ist, einer Macht also, die zugleich Ohnmacht in sich schließt. Der Christ kann dem Nicht-Christen m keiner Weise etwas zubringen, was diesem fehlt: . „eine solche Anmaßung würde tatsächlich stets das Gut, das es zu vermitteln gilt, unfruchtbar machen, ja zerstören”, sagt hierzu mit Recht Marcel. Was können wir also als Christen in der Begegnung mit dem Nicht-Christen, im zufälligen oder gewollten Gespräch mit dem Ungläubigen wahrhaft tun, ohne zu verletzen oder gar zu zerstören? Was dürfen, ja müssen aber auch wir in gerechter Verteidigung sagen oder tun, wenn umgekehrt der Nicht-Christ, meist ist es der von innerer Unruhe und einer Art schlechten Gewissens getriebene Nichtmehr-Christ, aggressiv und überheblich von seiner Position aus uns mitleidig belächelnd angeht, wie man nur einen Gegner angeht, nicht aber einen Menschenbruder?

 Beantworten wir kurz zunächst die letzte Frage. Welcher Christ hat noch nicht in dieser Situation gestanden, da ihm in welcher schonenden oder schonungslosen Form auch immer von „oben herab” die Inferiorität und überholte „Weltanschauung” seines nun durch zweitausend Jahre als Bankrott erwiesenen Christusglaubens vorgehalten wurde? Da hier nach seinem Bekenntnis gefragt wird, darf er, immer in der echten, paradoxen Demut des Habend-Nichthabenden, nicht scheuen, Zeugnis abzulegen für seinen „Herrn und Meister”, und sei es in der lächelnden Weise, wie Thornton Wilder es einmal aussprach, als er einem solchen etwas hochmütigen Befrager die „Ergebnislosigkeit” der nunmehr zweitaufendjährigen christlichen Vergangenheit zugab, aber hinzufügte, daß diese kurze Zeitspanne zu einem endgültigen Urteil wohl nicht genüge und man getrost die nächsten zweitausend Jahre abwarten möge. Zu einer wirklichen Verständigung wird es bei einer derartigen aggressiven Befragung zwischen dem Christen und dem Nicht-Christen kaum kommen. Je stärker aber der gegnerische Partner spürt, daß es bei solchen Kontroversen dem Christen in keiner Weise aus eine Art Rechthaben ankommt, sondern nur auf die schlichte, demütig-gläubige Bekundung seiner Gegründetheit innerhalb wie außerhalb dieser sichtbaren Welt „in Gott”, dem Dreieinigen, und seiner Offenbarung, je stärker er die echte, standhaltende Substanz dieser irrationalen Aussage als Bekenntnis der ganzen menschlichen Existenz dieses seines Gegenübers spürt, um so eher wird er, wenn auch nicht „bekehrt”, so doch angerührt sein von der Kraft und Macht, die sich auch, ja gerade in der wirklichen wie scheinbaren Schwachheit des „nur” Glaubenden verbirgt. Beantworten wir kurz zunächst die letzte Frage. Welcher Christ hat noch nicht in dieser Situation gestanden, da ihm in welcher schonenden oder schonungslosen Form auch immer von „oben herab” die Inferiorität und überholte „Weltanschauung” seines nun durch zweitausend Jahre als Bankrott erwiesenen Christusglaubens vorgehalten wurde? Da hier nach seinem Bekenntnis gefragt wird, darf er, immer in der echten, paradoxen Demut des Habend-Nichthabenden, nicht scheuen, Zeugnis abzulegen für seinen „Herrn und Meister”, und sei es in der lächelnden Weise, wie Thornton Wilder es einmal aussprach, als er einem solchen etwas hochmütigen Befrager die „Ergebnislosigkeit” der nunmehr zweitaufendjährigen christlichen Vergangenheit zugab, aber hinzufügte, daß diese kurze Zeitspanne zu einem endgültigen Urteil wohl nicht genüge und man getrost die nächsten zweitausend Jahre abwarten möge. Zu einer wirklichen Verständigung wird es bei einer derartigen aggressiven Befragung zwischen dem Christen und dem Nicht-Christen kaum kommen. Je stärker aber der gegnerische Partner spürt, daß es bei solchen Kontroversen dem Christen in keiner Weise aus eine Art Rechthaben ankommt, sondern nur auf die schlichte, demütig-gläubige Bekundung seiner Gegründetheit innerhalb wie außerhalb dieser sichtbaren Welt „in Gott”, dem Dreieinigen, und seiner Offenbarung, je stärker er die echte, standhaltende Substanz dieser irrationalen Aussage als Bekenntnis der ganzen menschlichen Existenz dieses seines Gegenübers spürt, um so eher wird er, wenn auch nicht „bekehrt”, so doch angerührt sein von der Kraft und Macht, die sich auch, ja gerade in der wirklichen wie scheinbaren Schwachheit des „nur” Glaubenden verbirgt.
 Gibt es aber auch für den Christen eine Möglichkeit, dem Nicht- oder Andersgläubigen so zu begegnen, daß ein Neues in diesem sich zu regen beginnt, gibt es eine christliche Maieutik, die sich gewiß von der platonischen wesentlich unterscheidet? Wenn wir von den unergründbaren Wegen und Lenkungen Gottes absehen (freilich können wir als Christen ernstlich nie von ihnen absehen), wenn wir diese Frage rein menschlich an den christlich gläubigen Menschen sui generis richten, so kann und muß sie zweifellos bejaht werden. Gabriel Marcel beantwortet sie derart: „Indem ich den andern als Kind Gottes behandle, kann ich in ihm, wie mir scheint, das Bewußtsein seiner Gottes- kindschaft wecken. In Wirklichkeit aber gebe ich ihm nichts, bringe ich ihm nichts zu; ich beschränke mich daraus, diesem Geschöpf, das seine wahre Natur verkennt - sie um so mehr verkennt, je eitler es sich in sich selbst gefällt -, jene Anbetung zuzuwenden, deren einziger Gegenstand der in seinem Leben aufgerufene Gott ist.” Gibt es aber auch für den Christen eine Möglichkeit, dem Nicht- oder Andersgläubigen so zu begegnen, daß ein Neues in diesem sich zu regen beginnt, gibt es eine christliche Maieutik, die sich gewiß von der platonischen wesentlich unterscheidet? Wenn wir von den unergründbaren Wegen und Lenkungen Gottes absehen (freilich können wir als Christen ernstlich nie von ihnen absehen), wenn wir diese Frage rein menschlich an den christlich gläubigen Menschen sui generis richten, so kann und muß sie zweifellos bejaht werden. Gabriel Marcel beantwortet sie derart: „Indem ich den andern als Kind Gottes behandle, kann ich in ihm, wie mir scheint, das Bewußtsein seiner Gottes- kindschaft wecken. In Wirklichkeit aber gebe ich ihm nichts, bringe ich ihm nichts zu; ich beschränke mich daraus, diesem Geschöpf, das seine wahre Natur verkennt - sie um so mehr verkennt, je eitler es sich in sich selbst gefällt -, jene Anbetung zuzuwenden, deren einziger Gegenstand der in seinem Leben aufgerufene Gott ist.”
 Unphilosophischer gesagt, indem ich ihm in der wirklichen und echten Haltung des wirklichen und echten Gebetes begegne. Es gibt kein „Gespräch”, weder zwischen Gläubigen verschiedener christlicher Konfessionen (Gespräche also ökumenischen Charakters) noch zwischen Christen und Nicht-Christen, das nicht vom Gebet getragen und erfüllt ist, anderes es ein wirkliches Sprechen miteinander sein soll.Es kann keine echte Begegnung zwischen Christ und Nicht-Christ geschehen, in der nicht wenigstens von dem christlichen Partner aus der „andere” ganz ernst, ganz „ebenbürtig”, im gleichen Sinne, wenn auch verdeckter als Ebenbild Gottes genommen wird. Freilich bedarf es der „Unterscheidung der Geister”, eine Gabe und Gnade, der wir als Christen noch immer allzusehr ermangeln, um bei solchen Begegnungen unterscheiden zu können zwischen dem Versucher und dem Sucher, dem suchenden Menschen. Nur wenn wir uns als Christen von der Liebe Gottes leiten lassen, werden wir unserem Nächsten gerecht, wo immer auch wir ihm begegnen. Unphilosophischer gesagt, indem ich ihm in der wirklichen und echten Haltung des wirklichen und echten Gebetes begegne. Es gibt kein „Gespräch”, weder zwischen Gläubigen verschiedener christlicher Konfessionen (Gespräche also ökumenischen Charakters) noch zwischen Christen und Nicht-Christen, das nicht vom Gebet getragen und erfüllt ist, anderes es ein wirkliches Sprechen miteinander sein soll.Es kann keine echte Begegnung zwischen Christ und Nicht-Christ geschehen, in der nicht wenigstens von dem christlichen Partner aus der „andere” ganz ernst, ganz „ebenbürtig”, im gleichen Sinne, wenn auch verdeckter als Ebenbild Gottes genommen wird. Freilich bedarf es der „Unterscheidung der Geister”, eine Gabe und Gnade, der wir als Christen noch immer allzusehr ermangeln, um bei solchen Begegnungen unterscheiden zu können zwischen dem Versucher und dem Sucher, dem suchenden Menschen. Nur wenn wir uns als Christen von der Liebe Gottes leiten lassen, werden wir unserem Nächsten gerecht, wo immer auch wir ihm begegnen.
Evangelische Jahresbriefe 1952, S. 148-152
|