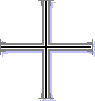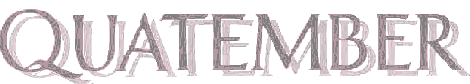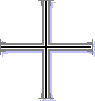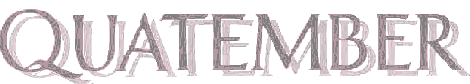Gerhard Kunze hat in der von ihm herausgegebenen Monatsschrift für Pastoral-Theologie (Aprilheft 1953, S. 208) der 3. Auflage meines Buches „Vom Sinn des Leibes” eine ausführliche Besprechung gewidmet. Sie ist so geistreich und interessant wie immer, wenn Kunze ein solches „Gespräch mit Berneuchen” eröffnet, das kein Gespräch, sondern eine kleine literarische Fehde ist. Die zwei Punkte, an denen Kunze seine kritischen Bedenken gegen die Art anmeldet, wie ich in meinem Buch vom Leib gesprochen habe, sind schon wichtig genug, um auch die Aufmerksamkeit eines weiteren Kreises darauf zu lenken. Kunze nimmt Anstoß daran, daß ich die Gleichnishaftigkeit der Kreaturen nicht auf einer einzigen Ebene sehe, sondern behaupte, daß Gold oder Kristall in einem anderen Grad (und in einem anderen Sinn) „Gleichnis” seien als Kiesel oder Kohle, die Rose anders als der Schierling. Er meint, daß man „in einem gefährlichen Grenzgebiet” landen werde, wenn man „diesen ersten Schritt auf der Bahn zur Symbolistik” mitgehe. Ich freue mich, daß Kunze die Tragweite der hier bestehenden Differenz so deutlich erkennt, bei der es nach seinen eigenen Worten nicht um „Terminologie oder theoretische Begriffsbestimmungen, sondern um unmittelbar praktisch werdende Grundhaltungen” geht. Gerhard Kunze hat in der von ihm herausgegebenen Monatsschrift für Pastoral-Theologie (Aprilheft 1953, S. 208) der 3. Auflage meines Buches „Vom Sinn des Leibes” eine ausführliche Besprechung gewidmet. Sie ist so geistreich und interessant wie immer, wenn Kunze ein solches „Gespräch mit Berneuchen” eröffnet, das kein Gespräch, sondern eine kleine literarische Fehde ist. Die zwei Punkte, an denen Kunze seine kritischen Bedenken gegen die Art anmeldet, wie ich in meinem Buch vom Leib gesprochen habe, sind schon wichtig genug, um auch die Aufmerksamkeit eines weiteren Kreises darauf zu lenken. Kunze nimmt Anstoß daran, daß ich die Gleichnishaftigkeit der Kreaturen nicht auf einer einzigen Ebene sehe, sondern behaupte, daß Gold oder Kristall in einem anderen Grad (und in einem anderen Sinn) „Gleichnis” seien als Kiesel oder Kohle, die Rose anders als der Schierling. Er meint, daß man „in einem gefährlichen Grenzgebiet” landen werde, wenn man „diesen ersten Schritt auf der Bahn zur Symbolistik” mitgehe. Ich freue mich, daß Kunze die Tragweite der hier bestehenden Differenz so deutlich erkennt, bei der es nach seinen eigenen Worten nicht um „Terminologie oder theoretische Begriffsbestimmungen, sondern um unmittelbar praktisch werdende Grundhaltungen” geht.
 „Vielleicht sind wir heute fähiger, der Tragik eines grundsätzlichen Geschiedenseins fester ins Auge zu schauen als vor zwei oder drei Jahrzehnten, als wir noch Schleier webten”. Ja, hier wird eine an die Wurzel gehende Verschiedenheit des Denkens sichtbar: Sind alle Erscheinungen der sichtbaren Welt, alle Blumen, alle Tiere, alle Gestalten im gleichen Sinn und im gleichen Maß „Gleichnis” für die unsichtbare und heilserfüllte Weh Gottes, oder bestehen hier Unterschiede, die nicht in einer willkürlichen Setzung, sondern in dem geschaffenen Wesen selber ihre Ursache haben? „Vielleicht sind wir heute fähiger, der Tragik eines grundsätzlichen Geschiedenseins fester ins Auge zu schauen als vor zwei oder drei Jahrzehnten, als wir noch Schleier webten”. Ja, hier wird eine an die Wurzel gehende Verschiedenheit des Denkens sichtbar: Sind alle Erscheinungen der sichtbaren Welt, alle Blumen, alle Tiere, alle Gestalten im gleichen Sinn und im gleichen Maß „Gleichnis” für die unsichtbare und heilserfüllte Weh Gottes, oder bestehen hier Unterschiede, die nicht in einer willkürlichen Setzung, sondern in dem geschaffenen Wesen selber ihre Ursache haben?
 Könnte man beispielsweise die Tiergestalten, unter denen im Alten Testament die Geistesmächte, in der christlichen Symbolik dann die Evangelisten erscheinen, Stier und Löwe und Adler, auch durch andere Tiere wie - Verzeihung, aber ich muß schon deutlich werden - durch Schwein, Kaninchen oder Krähe ersetzen? Es ist schon richtig: hier verstehen wir einander zu gut, um nicht zu sagen: Ich halte das, was du sagst, für radikal falsch. Aber ich empfinde trotzdem nicht das Bedürfnis, von der „Tragik” eines „grundsätzlichen Geschiedenseins” („Geschiedenseins!”) zu sprechen. Könnte man beispielsweise die Tiergestalten, unter denen im Alten Testament die Geistesmächte, in der christlichen Symbolik dann die Evangelisten erscheinen, Stier und Löwe und Adler, auch durch andere Tiere wie - Verzeihung, aber ich muß schon deutlich werden - durch Schwein, Kaninchen oder Krähe ersetzen? Es ist schon richtig: hier verstehen wir einander zu gut, um nicht zu sagen: Ich halte das, was du sagst, für radikal falsch. Aber ich empfinde trotzdem nicht das Bedürfnis, von der „Tragik” eines „grundsätzlichen Geschiedenseins” („Geschiedenseins!”) zu sprechen.
 Das andere Bedenken scheint mir auf einer sehr anderen Ebene zu liegen, ob-schon Kunze beides in einen nicht ganz überzeugenden Zusammenhang rückt. „Was St. als Leib behandelt, ist der Leib der Körperkultur, des Tanzes, der rhythmischen und gymnastischen Systeme bis hin zu den anthroposophischen Sonderformen (von denen ich meines Wissens nicht gesprochen habe); es ist nicht der Leib des Sportes”. Das „nominalistische Gegenbild” (daß der Sport auf die Seite des Nominalismus gehört, ist mir überraschend, aber meinetwegen, falls die Sportler mit dieser philosophiegeschichtlichen Einordnung einverstanden sind!) „wird dann nicht so schön, fein, edel gezeichnet sein dürfen, weil es eben die Gegenseite darstellen muß: das Robuste, Derbe, ja Brutale, aber auch das Naive des Leibhaften.” Das andere Bedenken scheint mir auf einer sehr anderen Ebene zu liegen, ob-schon Kunze beides in einen nicht ganz überzeugenden Zusammenhang rückt. „Was St. als Leib behandelt, ist der Leib der Körperkultur, des Tanzes, der rhythmischen und gymnastischen Systeme bis hin zu den anthroposophischen Sonderformen (von denen ich meines Wissens nicht gesprochen habe); es ist nicht der Leib des Sportes”. Das „nominalistische Gegenbild” (daß der Sport auf die Seite des Nominalismus gehört, ist mir überraschend, aber meinetwegen, falls die Sportler mit dieser philosophiegeschichtlichen Einordnung einverstanden sind!) „wird dann nicht so schön, fein, edel gezeichnet sein dürfen, weil es eben die Gegenseite darstellen muß: das Robuste, Derbe, ja Brutale, aber auch das Naive des Leibhaften.”
 Ich will nicht darüber streiten, ob in meinem Buch von der robusten Selbständigkeit, ja brutalen Eigenwilligkeit des Leibes nicht mit ausreichender Deutlichkeit geredet worden ist. Ich habe nur eine Frage an Kunze als einen der wenigen unter uns Theologen, der sich theologisch wirklich mit dem Sport beschäftigt hat, und diese Frage ist allerdings sehr ernst gemeint: Wenn es wahr ist, daß jede Betrachtung über den Sinn des Leibes sich an dem Verständnis des geschlechtlichen Lebens und der Ehe bewähren muß, gehört dann die körperliche Vereinigung von Mann und Frau mehr auf die Seite des Tanzes oder des Sportes? Vielleicht sollten aber in dieser Frage auch Frauen ihr Wort sagen dürfen. Ich will nicht darüber streiten, ob in meinem Buch von der robusten Selbständigkeit, ja brutalen Eigenwilligkeit des Leibes nicht mit ausreichender Deutlichkeit geredet worden ist. Ich habe nur eine Frage an Kunze als einen der wenigen unter uns Theologen, der sich theologisch wirklich mit dem Sport beschäftigt hat, und diese Frage ist allerdings sehr ernst gemeint: Wenn es wahr ist, daß jede Betrachtung über den Sinn des Leibes sich an dem Verständnis des geschlechtlichen Lebens und der Ehe bewähren muß, gehört dann die körperliche Vereinigung von Mann und Frau mehr auf die Seite des Tanzes oder des Sportes? Vielleicht sollten aber in dieser Frage auch Frauen ihr Wort sagen dürfen.
 Wenn ich in diesem Brief einiges aussprechen darf, was mir am Herzen liegt, worüber ich gern mit einsichtigen Menschen reden würde, dann ist es vielleicht doch nicht ganz verkehrt, diese kleine Fehde, die keinen tragischen Verlauf zu nehmen braucht, in einer gewissen Öffentlichkeit zu führen. Wenn ich in diesem Brief einiges aussprechen darf, was mir am Herzen liegt, worüber ich gern mit einsichtigen Menschen reden würde, dann ist es vielleicht doch nicht ganz verkehrt, diese kleine Fehde, die keinen tragischen Verlauf zu nehmen braucht, in einer gewissen Öffentlichkeit zu führen.
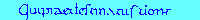
 Eine Leserin unserer Hefte machte mich aufmerksam auf das Buch der großen Pädagogin Maria Montessori „Kinder sind anders” und weist besonders darauf hin, daß in diesem Buch die Erziehung zur Sammlung und Stille eine entscheidende Rolle spielt. Wer im schulmäßigen Unterricht oder auch im Haus die schreckliche Zerfahrenheit der meisten Kinder, ihre Unfähigkeit zur Ruhe, Konzentration und Dauer beachtet und darunter gelitten hat, wird keinen Augenblick bezweifeln, daß hier eine Aufgabe gezeigt wird, deren Wert und Tragweite nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Dabei zeigt Frau Montessori in diesem ihrem Buch sehr eindrucksvoll, daß Kinder nicht nur anders sind als Erwachsene, sondern zumeist auch anders, als die Erwachsenen sich unter der Wirkung irgend eines herrschenden Schemas „das Kind” vorstellen: nämlich viel begieriger und aufgeschlossener für solche Übung der Stille, die die meisten Kinder instinktiv als eine notwendige Hilfe empfinden; sie zeigt freilich auch, welche sehr hohen Anforderungen an den Lehrer gestellt werden müssen, der zunächst an sich selber gelernt und geübt haben muß, was er den ihm anvertrauten Kindern vermitteln will, und wie dabei alle Vorurteile und gedanklichen Verkrampfungen gelöst werden müssen, mit denen die meisten von uns Erwachsenen die von dem Schöpfer uns verordnete Ruhe zerstören und die Stimmen der Stille unhörbar gemacht haben. Eine Leserin unserer Hefte machte mich aufmerksam auf das Buch der großen Pädagogin Maria Montessori „Kinder sind anders” und weist besonders darauf hin, daß in diesem Buch die Erziehung zur Sammlung und Stille eine entscheidende Rolle spielt. Wer im schulmäßigen Unterricht oder auch im Haus die schreckliche Zerfahrenheit der meisten Kinder, ihre Unfähigkeit zur Ruhe, Konzentration und Dauer beachtet und darunter gelitten hat, wird keinen Augenblick bezweifeln, daß hier eine Aufgabe gezeigt wird, deren Wert und Tragweite nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Dabei zeigt Frau Montessori in diesem ihrem Buch sehr eindrucksvoll, daß Kinder nicht nur anders sind als Erwachsene, sondern zumeist auch anders, als die Erwachsenen sich unter der Wirkung irgend eines herrschenden Schemas „das Kind” vorstellen: nämlich viel begieriger und aufgeschlossener für solche Übung der Stille, die die meisten Kinder instinktiv als eine notwendige Hilfe empfinden; sie zeigt freilich auch, welche sehr hohen Anforderungen an den Lehrer gestellt werden müssen, der zunächst an sich selber gelernt und geübt haben muß, was er den ihm anvertrauten Kindern vermitteln will, und wie dabei alle Vorurteile und gedanklichen Verkrampfungen gelöst werden müssen, mit denen die meisten von uns Erwachsenen die von dem Schöpfer uns verordnete Ruhe zerstören und die Stimmen der Stille unhörbar gemacht haben.
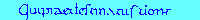
 In einer unserer oberbayerischen Diaspora-Gemeinden hatte ich über den Text Eph. 5, 9-14 gepredigt und hatte von den drei Gegensatzpaaren gesprochen, die diesen Versen zugrunde liegen und deren Gegensätzlichkeit nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dem tiefer Schauenden aber immer bedeutsamer wird: Daß der eigentliche Gegensatz des Lichtes nicht das mütterliche Dunkel, sondern die feindselige Finsternis ist, daß die christliche Existenz wohl wie alles Leben der Verborgenheit bedarf, aber die Heimlichkeit meidet, daß die „Finsternis” wohl Werke von imponierender Größe hervorbringen kann, aber keine Früchte, die den Keim neuen Lebens in sich tragen. Es verlockte mich, nachher an den zum Kindergottesdienst versammelten Kindern zu erproben, ob ich auch ihnen diese Unterschiede deutlich machen könnte, und fragte sie also, ob dunkel und finster wohl das Gleiche wäre. Die meisten meinten, ja, das sei eins und dasselbe; bloß einer der Jungen beharrte darauf, dunkel sei eben dunkel, und finster sei eben finster, womit er ja wohl sagen wollte, daß da eben doch ein wirklicher Unterschied sei. Ich bohrte weiter, ob sie ein Beispiel dafür wüßten, wo man nur von dunkel, aber nicht von finster reden könnte oder umgekehrt, worauf ein Mädchen vergnügt feststellte, ein Schulzimmer müsse man manchmal verdunkeln, aber. . ., da fehlten ihr nun die Worte, aber sie wollte offenbar sagen, daß ein verfinstertes Schulzimmer eine komische und sinnwidrige Vorstellung wäre. Damit hatte das Kind nun wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und in dem Bereich seiner Erfahrung und Vorstellung etwas entscheidend Richtiges erkannt. In einer unserer oberbayerischen Diaspora-Gemeinden hatte ich über den Text Eph. 5, 9-14 gepredigt und hatte von den drei Gegensatzpaaren gesprochen, die diesen Versen zugrunde liegen und deren Gegensätzlichkeit nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dem tiefer Schauenden aber immer bedeutsamer wird: Daß der eigentliche Gegensatz des Lichtes nicht das mütterliche Dunkel, sondern die feindselige Finsternis ist, daß die christliche Existenz wohl wie alles Leben der Verborgenheit bedarf, aber die Heimlichkeit meidet, daß die „Finsternis” wohl Werke von imponierender Größe hervorbringen kann, aber keine Früchte, die den Keim neuen Lebens in sich tragen. Es verlockte mich, nachher an den zum Kindergottesdienst versammelten Kindern zu erproben, ob ich auch ihnen diese Unterschiede deutlich machen könnte, und fragte sie also, ob dunkel und finster wohl das Gleiche wäre. Die meisten meinten, ja, das sei eins und dasselbe; bloß einer der Jungen beharrte darauf, dunkel sei eben dunkel, und finster sei eben finster, womit er ja wohl sagen wollte, daß da eben doch ein wirklicher Unterschied sei. Ich bohrte weiter, ob sie ein Beispiel dafür wüßten, wo man nur von dunkel, aber nicht von finster reden könnte oder umgekehrt, worauf ein Mädchen vergnügt feststellte, ein Schulzimmer müsse man manchmal verdunkeln, aber. . ., da fehlten ihr nun die Worte, aber sie wollte offenbar sagen, daß ein verfinstertes Schulzimmer eine komische und sinnwidrige Vorstellung wäre. Damit hatte das Kind nun wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und in dem Bereich seiner Erfahrung und Vorstellung etwas entscheidend Richtiges erkannt.
 Denn wenn das Schulzimmer verdunkelt wird, dann dient das künstlich hergestellte Dunkel ja doch gerade dazu, daß bestimmte Bilder deutlich erkennbar sind, die im hellen Tageslicht zu blaß bleiben, als daß sie von unserem Auge richtig wahrgenommen werden könnten. Damit aber ist eine wesentliche Eigenschaft und Funktion des Dunkels beschrieben: Wenn wir nicht immer wieder in das Dunkel der Nacht einkehren dürften, würden wir das Licht des Tages bald nicht mehr ertragen; im Dunkel wachen Bilder auf, die sich an ein inneres Auge wenden und die von dem hellen Licht des Tages und erst recht von den künstlichen Lichtern, mit denen wir das Dunkel vertreiben, nur allzu leicht überblendet werden. Die Finsternis aber ist jeder Art von Bild und Sehen feind; in der Finsternis sehen wir höchstens Gespenster, die unsere Seele mit Trugbildern erschrecken; und es steht nach dem Wort des Evangeliums (Joh. 11, 9f) so, daß keine äußere Finsternis unsere Sehkraft so sehr herabsetzen, ja auslöschen kann, wie die Finsternis eines verfinsterten Herzens und Denkens. Denn wenn das Schulzimmer verdunkelt wird, dann dient das künstlich hergestellte Dunkel ja doch gerade dazu, daß bestimmte Bilder deutlich erkennbar sind, die im hellen Tageslicht zu blaß bleiben, als daß sie von unserem Auge richtig wahrgenommen werden könnten. Damit aber ist eine wesentliche Eigenschaft und Funktion des Dunkels beschrieben: Wenn wir nicht immer wieder in das Dunkel der Nacht einkehren dürften, würden wir das Licht des Tages bald nicht mehr ertragen; im Dunkel wachen Bilder auf, die sich an ein inneres Auge wenden und die von dem hellen Licht des Tages und erst recht von den künstlichen Lichtern, mit denen wir das Dunkel vertreiben, nur allzu leicht überblendet werden. Die Finsternis aber ist jeder Art von Bild und Sehen feind; in der Finsternis sehen wir höchstens Gespenster, die unsere Seele mit Trugbildern erschrecken; und es steht nach dem Wort des Evangeliums (Joh. 11, 9f) so, daß keine äußere Finsternis unsere Sehkraft so sehr herabsetzen, ja auslöschen kann, wie die Finsternis eines verfinsterten Herzens und Denkens.
 Ein verfinstertes Schulzimmer: Das wäre also eine Schulstube - es kann natürlich auch ein akademischer Hörsaal sein -, in der die Kraft und Fähigkeit, die Wahrheit zu sehen und zu erkennen, die Freude am Schauen und Betrachten künstlich gehemmt und geschädigt wird, daß schließlich nur noch die Begriffsgespenster übrigbleiben, die sich wie ein trüber Schleier zwischen den blindgewordenen Menschen und die Wirklichkeit schieben. Ob es wirklich nur verdunkelte und nicht auch verfinsterte Schulzimmer gibt, das freilich wäre eine Frage, die man nicht mit Kindern besprechen könnte, um so mehr aber mit Erwachsenen erwägen müßte. Ein verfinstertes Schulzimmer: Das wäre also eine Schulstube - es kann natürlich auch ein akademischer Hörsaal sein -, in der die Kraft und Fähigkeit, die Wahrheit zu sehen und zu erkennen, die Freude am Schauen und Betrachten künstlich gehemmt und geschädigt wird, daß schließlich nur noch die Begriffsgespenster übrigbleiben, die sich wie ein trüber Schleier zwischen den blindgewordenen Menschen und die Wirklichkeit schieben. Ob es wirklich nur verdunkelte und nicht auch verfinsterte Schulzimmer gibt, das freilich wäre eine Frage, die man nicht mit Kindern besprechen könnte, um so mehr aber mit Erwachsenen erwägen müßte.
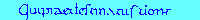
 In Griechenland ist man auf eine originelle Idee gekommen, um der auch dort unheimlichen Zunahme der Ehescheidungen entgegenzuwirken. Eine angesehene Monatsschrift regt an, daß die Berichterstatter und Presse-Korrespondenten, die berufsmäßig verpflichtet sind, nach Neuigkeiten Ausschau zu halten, einmal eine Durchschnittszahl geschiedener Männer oder Frauen darüber befragen möchten, wie viele nun eigentlich mit ihrem Leben jetzt zufrieden sind; vielleicht könnten sie auch ermitteln , wie die Kinder getrennter Eltern über die Scheidung denken. - Übrigens: Wenn Eheleute, die einander zur Last geworden sind, dennoch um der Kinder willen beieinander bleiben, so ist das gewiß kein schlechter oder ehefremder Grund, sondern es wird in dieser Rücksicht auf die Kinder deutlich, daß es in der Ehe eben nicht - jedenfalls nicht nur -um das persönliche Glück der beiden Ehegatten, sondern um eine gemeinsame Aufgabe, nämlich die Begründung und Erhaltung einer Familie geht; und es ist ganz in Ordnung, wenn diese gemeinsame Aufgabe auch solche Ehegatten noch beieinander hält, die meinen, aneinander keine Aufgabe mehr zu haben. In Griechenland ist man auf eine originelle Idee gekommen, um der auch dort unheimlichen Zunahme der Ehescheidungen entgegenzuwirken. Eine angesehene Monatsschrift regt an, daß die Berichterstatter und Presse-Korrespondenten, die berufsmäßig verpflichtet sind, nach Neuigkeiten Ausschau zu halten, einmal eine Durchschnittszahl geschiedener Männer oder Frauen darüber befragen möchten, wie viele nun eigentlich mit ihrem Leben jetzt zufrieden sind; vielleicht könnten sie auch ermitteln , wie die Kinder getrennter Eltern über die Scheidung denken. - Übrigens: Wenn Eheleute, die einander zur Last geworden sind, dennoch um der Kinder willen beieinander bleiben, so ist das gewiß kein schlechter oder ehefremder Grund, sondern es wird in dieser Rücksicht auf die Kinder deutlich, daß es in der Ehe eben nicht - jedenfalls nicht nur -um das persönliche Glück der beiden Ehegatten, sondern um eine gemeinsame Aufgabe, nämlich die Begründung und Erhaltung einer Familie geht; und es ist ganz in Ordnung, wenn diese gemeinsame Aufgabe auch solche Ehegatten noch beieinander hält, die meinen, aneinander keine Aufgabe mehr zu haben.
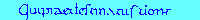
 Ein Leser unserer Zeitschrift teilt mir die folgende Stelle aus dem Buch von Jürgen Rausch „In einer Stunde wie dieser” (Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart) S. 303 mit: Ein Leser unserer Zeitschrift teilt mir die folgende Stelle aus dem Buch von Jürgen Rausch „In einer Stunde wie dieser” (Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart) S. 303 mit:
 „Beton hat etwas Unterirdisches. Noch im vierten Stock lebt man wie im Keller. Ich hasse dieses Material und ich frage mich oft, ob man in Beton wirklich bauen und nicht bloß konstruieren kann. Der Eisenbeton hat technische Möglichkeiten geöffnet, die jenen zündenden Widerstand ausschließen, mit dem die harte Eindeutigkeit des Materials den Gedanken herausfordert. Die Weiten, die man heute überspannen hat, sind enorm. Aber sind es gestaltete, nicht nur errechnete Räume, die so zustande kommen? Beton ist das ideale Material eines Masse-Zeitalters, dessen Bauten immer fort von Zerstörungen bedroht sind. Erstaunlich ist nur, in welchem Umfang das Gefühl für die Hierarchie des Materials verloren gegangen ist. Natürlich ist in der Welt chemischer Formeln Marmor nicht edler als Beton, und dennoch lebt in mir ein Rest, der sich empört, wenn man eine Kirche aus Beton baut. Übrigens ist diese Empörung ziemlich abstrakt, denn ich gehe ja nicht in die Kirche. Ich glaube nur deutlich zu sehen, daß Beton außerhalb ihres Wesens liegt. Dieses Material ist nur für architektonische Eingeweide geeignet. Wenn es hervortritt, wird es gemein, und als Ruine gleicht es Schrott.” „Beton hat etwas Unterirdisches. Noch im vierten Stock lebt man wie im Keller. Ich hasse dieses Material und ich frage mich oft, ob man in Beton wirklich bauen und nicht bloß konstruieren kann. Der Eisenbeton hat technische Möglichkeiten geöffnet, die jenen zündenden Widerstand ausschließen, mit dem die harte Eindeutigkeit des Materials den Gedanken herausfordert. Die Weiten, die man heute überspannen hat, sind enorm. Aber sind es gestaltete, nicht nur errechnete Räume, die so zustande kommen? Beton ist das ideale Material eines Masse-Zeitalters, dessen Bauten immer fort von Zerstörungen bedroht sind. Erstaunlich ist nur, in welchem Umfang das Gefühl für die Hierarchie des Materials verloren gegangen ist. Natürlich ist in der Welt chemischer Formeln Marmor nicht edler als Beton, und dennoch lebt in mir ein Rest, der sich empört, wenn man eine Kirche aus Beton baut. Übrigens ist diese Empörung ziemlich abstrakt, denn ich gehe ja nicht in die Kirche. Ich glaube nur deutlich zu sehen, daß Beton außerhalb ihres Wesens liegt. Dieses Material ist nur für architektonische Eingeweide geeignet. Wenn es hervortritt, wird es gemein, und als Ruine gleicht es Schrott.”
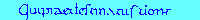
 „Zufällig” kommt auf meinen Tisch ein Kalenderblatt aus dem Abreißkalender eines lutherischen Verlags in Amerika, den eine sehr angesehene offizielle kirchliche Stelle in Deutschland an evangelische Gemeinden im Ausland verschickt hat. Darin wird das Wort des Herrn „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben” in einer sehr anschaulichen Weise ausgelegt. „Bei uns in Amerika herrschen soeben schreckliche Fluten und Überschwemmungen .... Wir mußten durch die Fluten hindurch, dreihundert Meilen weit, um zu predigen. Überall Wasser, aber die Autobahn hält! Wir kamen an unseren Predigtort und zurück. Denn da war ein Weg. Und nun ist Jesus ein Weg zum Himmel. Er ist die Autobahn hin zu den himmlischen Wohnungen im Vaterhaus. Und der Glaube ist der Wagen, der uns dorthin bringt. Wie wichtig ist uns doch Jesus...” Ich will nicht weiter zitieren. Wie sagte doch jener Amerikaner in Stockholm vor 28 Jahren? Es ist die Aufgabe der Kirche, die Straße zum Himmel so breit, glatt und hell erleuchtet zu machen, wie es nur möglich ist! „Zufällig” kommt auf meinen Tisch ein Kalenderblatt aus dem Abreißkalender eines lutherischen Verlags in Amerika, den eine sehr angesehene offizielle kirchliche Stelle in Deutschland an evangelische Gemeinden im Ausland verschickt hat. Darin wird das Wort des Herrn „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben” in einer sehr anschaulichen Weise ausgelegt. „Bei uns in Amerika herrschen soeben schreckliche Fluten und Überschwemmungen .... Wir mußten durch die Fluten hindurch, dreihundert Meilen weit, um zu predigen. Überall Wasser, aber die Autobahn hält! Wir kamen an unseren Predigtort und zurück. Denn da war ein Weg. Und nun ist Jesus ein Weg zum Himmel. Er ist die Autobahn hin zu den himmlischen Wohnungen im Vaterhaus. Und der Glaube ist der Wagen, der uns dorthin bringt. Wie wichtig ist uns doch Jesus...” Ich will nicht weiter zitieren. Wie sagte doch jener Amerikaner in Stockholm vor 28 Jahren? Es ist die Aufgabe der Kirche, die Straße zum Himmel so breit, glatt und hell erleuchtet zu machen, wie es nur möglich ist!
 Aber vielleicht passieren auch auf dieser Autobahn erhebliche Verkehrsunfälle, vielleicht weil das Model! des Autos (lies „Glaube”) den veränderten Verkehrsverhältnissen nicht angepaßt ist. Aber es gehört zu den unzweifelhaften Vorteilen der Autobahn, daß man zwar überholen und überholt werden kann, aber niemandem begegnet; natürlich ja, es pressiert ja auch niemand, auf dem umgekehrten Weg vom Himmel zur Erde (oder zur Hölle) schnell voranzukommen. Man sieht, man kann einen guten Vergleich in der nützlichsten Weise ausspinnen. Aber vielleicht passieren auch auf dieser Autobahn erhebliche Verkehrsunfälle, vielleicht weil das Model! des Autos (lies „Glaube”) den veränderten Verkehrsverhältnissen nicht angepaßt ist. Aber es gehört zu den unzweifelhaften Vorteilen der Autobahn, daß man zwar überholen und überholt werden kann, aber niemandem begegnet; natürlich ja, es pressiert ja auch niemand, auf dem umgekehrten Weg vom Himmel zur Erde (oder zur Hölle) schnell voranzukommen. Man sieht, man kann einen guten Vergleich in der nützlichsten Weise ausspinnen.
Quatember 1953, S. 248-251
|