 Wenn wir nicht ein leises Widerstreben dagegen empfänden, den zu einer Plakatierung gewordenen Namen Berneuchen zu oft zu verwenden, müßte dieser Aufsatz Ritters eigentlich unter dem Titel „Tillich und Berneuchen” stehen. Daß dieses „und” nicht nur für weit zurückliegende Vergangenheit, für die Zeit vor einem Menschenalter gilt, dafür kann der Schriftleiter mit einer spontanen und ganz unwillkürlichen Äußerung des großen Theologen in einem vor wenigen Jahren in New York mit Ihm geführten Gespräch Zeugnis geben. Als er sich mit Paul Tillich über den starken Eindruck unterhielt, den ein New Yorker Gottesdienst der Episcopalian Church auf ihn gemacht hatte, antwortete Tillich dem soviel jüngeren Michaelsbruder, für „uns Berneuchener” habe die anglikanische Kirche ja viele uns verwandt anmutende Züge. Noch nach fast dreißig Jahren also sprach er im „Wir” vom Berneuchener Bemühen und bekannte sich ohne Vorbehalt zu ihm. Wenn wir nicht ein leises Widerstreben dagegen empfänden, den zu einer Plakatierung gewordenen Namen Berneuchen zu oft zu verwenden, müßte dieser Aufsatz Ritters eigentlich unter dem Titel „Tillich und Berneuchen” stehen. Daß dieses „und” nicht nur für weit zurückliegende Vergangenheit, für die Zeit vor einem Menschenalter gilt, dafür kann der Schriftleiter mit einer spontanen und ganz unwillkürlichen Äußerung des großen Theologen in einem vor wenigen Jahren in New York mit Ihm geführten Gespräch Zeugnis geben. Als er sich mit Paul Tillich über den starken Eindruck unterhielt, den ein New Yorker Gottesdienst der Episcopalian Church auf ihn gemacht hatte, antwortete Tillich dem soviel jüngeren Michaelsbruder, für „uns Berneuchener” habe die anglikanische Kirche ja viele uns verwandt anmutende Züge. Noch nach fast dreißig Jahren also sprach er im „Wir” vom Berneuchener Bemühen und bekannte sich ohne Vorbehalt zu ihm.
 Es war, wenn ich mich recht entsinne, im September 1925, daß Paul Tillich zum ersten Mal mit uns am runden Tisch in Berneuchen Platz genommen hat. Es ging damals um eine letzte Überprüfung der Vorarbeiten zu unserer Denkschrift „Das Berneuchener Buch”. Tillich griff sofort mit einer sehr kritischen Fragestellung in unser Gespräch ein. „Was ist Euer Ziel? Arbeitet Ihr für die Evangelisch-lutherische Kirche oder für das Volk, die Menschen unserer Tage, so wie sie sind, in der geistigen Lage, in der sie sind? Ich glaube nicht, daß es möglich ist, durch Korrektur der innerkirchlichen Form dem Gesamtleben wirksam zu helfen, zumal der Protestantismus die sakramentale Wirklichkeit der Hierarchie zerstört hat und also selbst dem Staat und der Gesellschaft und ihrer Entwicklung verfallen ist. Wie sollte er also in sich selbst zu einer Neugestaltung kommen?” Wir mußten uns der Wucht solcher Fragestellung und Forderung gegenüber auf den sehr viel bescheideneren Ursprung unserer Arbeit besinnen, auf das, wozu wir Berufung verspürt hatten, nämlich der Evangelischen Kirche in Deutschland von der jungen Generation aus zu sagen, was uns an ihr Not bereitete. Mußten wir es nicht dem Gang der Geschichte überlassen, ob die Kirche, wenn sie sich aus ihrer Erstarrung lösen und reinigen ließe, auch für andere an ihren Grenzen und außerhalb ihres Bereichs da sein würde oder nicht? Es war, wenn ich mich recht entsinne, im September 1925, daß Paul Tillich zum ersten Mal mit uns am runden Tisch in Berneuchen Platz genommen hat. Es ging damals um eine letzte Überprüfung der Vorarbeiten zu unserer Denkschrift „Das Berneuchener Buch”. Tillich griff sofort mit einer sehr kritischen Fragestellung in unser Gespräch ein. „Was ist Euer Ziel? Arbeitet Ihr für die Evangelisch-lutherische Kirche oder für das Volk, die Menschen unserer Tage, so wie sie sind, in der geistigen Lage, in der sie sind? Ich glaube nicht, daß es möglich ist, durch Korrektur der innerkirchlichen Form dem Gesamtleben wirksam zu helfen, zumal der Protestantismus die sakramentale Wirklichkeit der Hierarchie zerstört hat und also selbst dem Staat und der Gesellschaft und ihrer Entwicklung verfallen ist. Wie sollte er also in sich selbst zu einer Neugestaltung kommen?” Wir mußten uns der Wucht solcher Fragestellung und Forderung gegenüber auf den sehr viel bescheideneren Ursprung unserer Arbeit besinnen, auf das, wozu wir Berufung verspürt hatten, nämlich der Evangelischen Kirche in Deutschland von der jungen Generation aus zu sagen, was uns an ihr Not bereitete. Mußten wir es nicht dem Gang der Geschichte überlassen, ob die Kirche, wenn sie sich aus ihrer Erstarrung lösen und reinigen ließe, auch für andere an ihren Grenzen und außerhalb ihres Bereichs da sein würde oder nicht?
 Wir hatten jetzt eine vielleicht sehr beschränkte Aufgabe; durften wir sie liegen lassen, weil uns die Krisis zu groß erschien, als daß wir sie zu bewältigen vermöchten? Aber die kritische, jedoch durchaus positiv gemeinte Mitarbeit Tillichs hat uns freilich in den nächsten Jahren immer aufs neue gezwungen, bei allen unseren Überlegungen bis in die Einzelheiten unserer liturgischen Arbeit hinein den Blick auf die Gesamtlage nicht zu vergessen und etwa bei den Bemühungen um die der Gegenwart gemäße liturgische Sprache zu prüfen, ob wir nicht doch in Gefahr wären, von der Überlieferung der Kirche zu abhängig zu bleiben. Keiner, der damals dabei war, wird vergessen haben, wie wir noch während der Rückreise von Berneuchen nach Berlin im Zuge und auf dem Bahnhof in Küstrin eifrig mit der Redaktion des „Gebets der Tageszeiten” beschäftigt waren und wie befriedigt Tillich über den Satz war, der das Morgengebet einleitete: „Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen”. Diese einfache Aussage schien ihm vorbildlich zu sein für eine Sprache, die den Zeitgenossen unmittelbar an jene Grenze führe, an der durch die irdische Wirklichkeit die transzendente Wirklichkeit aufleuchtet. Wir hatten jetzt eine vielleicht sehr beschränkte Aufgabe; durften wir sie liegen lassen, weil uns die Krisis zu groß erschien, als daß wir sie zu bewältigen vermöchten? Aber die kritische, jedoch durchaus positiv gemeinte Mitarbeit Tillichs hat uns freilich in den nächsten Jahren immer aufs neue gezwungen, bei allen unseren Überlegungen bis in die Einzelheiten unserer liturgischen Arbeit hinein den Blick auf die Gesamtlage nicht zu vergessen und etwa bei den Bemühungen um die der Gegenwart gemäße liturgische Sprache zu prüfen, ob wir nicht doch in Gefahr wären, von der Überlieferung der Kirche zu abhängig zu bleiben. Keiner, der damals dabei war, wird vergessen haben, wie wir noch während der Rückreise von Berneuchen nach Berlin im Zuge und auf dem Bahnhof in Küstrin eifrig mit der Redaktion des „Gebets der Tageszeiten” beschäftigt waren und wie befriedigt Tillich über den Satz war, der das Morgengebet einleitete: „Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen”. Diese einfache Aussage schien ihm vorbildlich zu sein für eine Sprache, die den Zeitgenossen unmittelbar an jene Grenze führe, an der durch die irdische Wirklichkeit die transzendente Wirklichkeit aufleuchtet.

 Um eben diese Grenze, an der sich Ergriffenheit des Menschen und Offenbarungswirklichkeit Gottes begegnen, ging es immer aufs neue, insbesondere dann bei unserer Konferenz 1928 im Gutshaus unseres Freundes Hans von Wedemeyer in Pätzig, in der Paul Tillich in einem großangelegten Referat seine realistische Deutung des sakramentalen Lebens vortrug. Noch ist mir deutlich in Erinnerung, wie er damit ein leidenschaftlich bewegtes, durch Tage hindurch währendes Gespräch auslöste, an dem sich besonders dankbar auch die „Laien” beteiligten. Um eben diese Grenze, an der sich Ergriffenheit des Menschen und Offenbarungswirklichkeit Gottes begegnen, ging es immer aufs neue, insbesondere dann bei unserer Konferenz 1928 im Gutshaus unseres Freundes Hans von Wedemeyer in Pätzig, in der Paul Tillich in einem großangelegten Referat seine realistische Deutung des sakramentalen Lebens vortrug. Noch ist mir deutlich in Erinnerung, wie er damit ein leidenschaftlich bewegtes, durch Tage hindurch währendes Gespräch auslöste, an dem sich besonders dankbar auch die „Laien” beteiligten.
 Im Jahre darauf stand, wieder in Pätzig, im Mittelpunkt unserer Verhandlungen ein Vortrag von Tillich über „Die Kirche und die humanistische Gesellschaft”. Hatte in den vorhergehenden Jahren die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden Größen in unseren Gesprächen immer wieder eine bedeutsame Rolle gespielt, so durften wir nun eine höchst eindringliche Analyse der Situation hören, durch die uns die tiefe Gebrochenheit dieses Verhältnisses, die Unmöglichkeit einer einfachen Grenzziehung, aber auch die positiven Möglichkeiten, die in dieser Situation sichtbar werden, vor Augen gestellt wurden. Wir kamen schließlich dazu, von einer Doppelgestalt der Kirche zu sprechen, einer in der humanistischen Gesellschaft „latent” vorhandenen Kirche, die sich nicht als Gruppe weiß und keine soziologische gegenständliche Fixierung hat und von der „manifesten” Kirche, die sich gegenseitig in ihrer Geltung begrenzen und beschränken. Im Jahre darauf stand, wieder in Pätzig, im Mittelpunkt unserer Verhandlungen ein Vortrag von Tillich über „Die Kirche und die humanistische Gesellschaft”. Hatte in den vorhergehenden Jahren die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden Größen in unseren Gesprächen immer wieder eine bedeutsame Rolle gespielt, so durften wir nun eine höchst eindringliche Analyse der Situation hören, durch die uns die tiefe Gebrochenheit dieses Verhältnisses, die Unmöglichkeit einer einfachen Grenzziehung, aber auch die positiven Möglichkeiten, die in dieser Situation sichtbar werden, vor Augen gestellt wurden. Wir kamen schließlich dazu, von einer Doppelgestalt der Kirche zu sprechen, einer in der humanistischen Gesellschaft „latent” vorhandenen Kirche, die sich nicht als Gruppe weiß und keine soziologische gegenständliche Fixierung hat und von der „manifesten” Kirche, die sich gegenseitig in ihrer Geltung begrenzen und beschränken.
 „Wenn ihr hier um Gestaltwerdung in der manifesten Kirche ringt” - so sagte er uns - „so bleibt euch doch dessen bewußt, daß ihr damit nicht den einzig möglichen Weg einschlagt, daß ihr vielmehr ständig damit rechnen müßt, daß in der latenten Kirche Gestaltungen zum Durchbruch kommen, die genau so ein Zeugnis von der Wirklichkeit und Wahrheit des Christus sind, wie das, was in der manifesten Kirche zur Erscheinung kommt. Freilich, ein solcher Zustand schreit nach Überwindung. Es geht nicht an, diese Situation zu dogmatisieren. Aber noch stehen wir ganz in dieser Lage und wollen auch das Wort „Übergang” nicht zu schnell gebrauchen, weil dadurch die Gegenwart nicht ernst genommen wird. Ist schließlich „Übergang” nicht eine Kategorie des Geschichtlichen überhaupt? Wir haben diese Doppelgestalt der Kirche. Infolgedessen müssen wir, ein jeder an seinem Ort, so handeln, daß wir die Beziehung zu der anderen Gestalt nicht verlieren. Die höchste Leistung, die sich in unserer Lage denken läßt, wäre die, daß alle Gestalten der manifesten Kirche von ihren Voraussetzungen aus so geprägt würden, daß das Ja zur latenten Kirche darin enthalten wäre und umgekehrt, daß die latente Kirche auf diese Weise die Möglichkeit bekäme, ein deutlicheres, nicht bloß ein duldendes Ja zu sagen zur manifesten Kirche. Vielleicht käme, langsam, auf diese Weise eine echte Konvergenz zustande, in der die Entwicklungsform des Christentums, die wir christlichen Humanismus genannt haben, und die Entwicklungsformen des Christentums, die in der Kirche vorhanden sind, zu einer anderen Einheit als bisher zusammenwachsen würden? Nur so nehmen wir die Lage, in der wir uns vorfinden, ernst.” „Wenn ihr hier um Gestaltwerdung in der manifesten Kirche ringt” - so sagte er uns - „so bleibt euch doch dessen bewußt, daß ihr damit nicht den einzig möglichen Weg einschlagt, daß ihr vielmehr ständig damit rechnen müßt, daß in der latenten Kirche Gestaltungen zum Durchbruch kommen, die genau so ein Zeugnis von der Wirklichkeit und Wahrheit des Christus sind, wie das, was in der manifesten Kirche zur Erscheinung kommt. Freilich, ein solcher Zustand schreit nach Überwindung. Es geht nicht an, diese Situation zu dogmatisieren. Aber noch stehen wir ganz in dieser Lage und wollen auch das Wort „Übergang” nicht zu schnell gebrauchen, weil dadurch die Gegenwart nicht ernst genommen wird. Ist schließlich „Übergang” nicht eine Kategorie des Geschichtlichen überhaupt? Wir haben diese Doppelgestalt der Kirche. Infolgedessen müssen wir, ein jeder an seinem Ort, so handeln, daß wir die Beziehung zu der anderen Gestalt nicht verlieren. Die höchste Leistung, die sich in unserer Lage denken läßt, wäre die, daß alle Gestalten der manifesten Kirche von ihren Voraussetzungen aus so geprägt würden, daß das Ja zur latenten Kirche darin enthalten wäre und umgekehrt, daß die latente Kirche auf diese Weise die Möglichkeit bekäme, ein deutlicheres, nicht bloß ein duldendes Ja zu sagen zur manifesten Kirche. Vielleicht käme, langsam, auf diese Weise eine echte Konvergenz zustande, in der die Entwicklungsform des Christentums, die wir christlichen Humanismus genannt haben, und die Entwicklungsformen des Christentums, die in der Kirche vorhanden sind, zu einer anderen Einheit als bisher zusammenwachsen würden? Nur so nehmen wir die Lage, in der wir uns vorfinden, ernst.”
 Es bedarf keiner Ausführungen, um sichtbar zu machen, wie sehr in solchen Sätzen Tillichs das innerste Anliegen unseres Arbeitskreises in einer sehr grundsätzlichen Weise zum Ausdruck kam. Die Referate, die auf unseren Konferenzen in jenen Jahren gehalten worden sind, sind denn auch alle mehr oder weniger von dieser grundlegenden Beurteilung der Lage mit bestimmt. Es bedarf keiner Ausführungen, um sichtbar zu machen, wie sehr in solchen Sätzen Tillichs das innerste Anliegen unseres Arbeitskreises in einer sehr grundsätzlichen Weise zum Ausdruck kam. Die Referate, die auf unseren Konferenzen in jenen Jahren gehalten worden sind, sind denn auch alle mehr oder weniger von dieser grundlegenden Beurteilung der Lage mit bestimmt.

 Zu einer Begegnung von Paul Tillich mit dem großen Kreis der Freunde unserer Arbeit draußen im Lande kam es bei der unvergeßlichen Tagung Ende September 1929 in Schulpforta. Sie war ein erster Versuch, vor diesem Kreis ein Bild von unseren theoretischen und praktischen Bemühungen am runden Tisch in Berneuchen zu entwerfen. Wer die Protokolle, die aus diesen Tagen erhalten sind, heute durchblättert, wird ergriffen werden von dem leidenschaftlichen Ernst eines lebendigen Ringens um Klarheit für unseren Weg, zugleich aber auch von dem Eindruck, wie sehr die dort versammelten Männer und Frauen fast erdrückt wurden durch die weitausgreifende Fülle der Fragen, vor die sie sich durch die Wirklichkeit des Protestantismus, an der sie ja alle, ein jeder auf seine Weise, leidend Anteil hatten, gestellt sahen. Zu einer Begegnung von Paul Tillich mit dem großen Kreis der Freunde unserer Arbeit draußen im Lande kam es bei der unvergeßlichen Tagung Ende September 1929 in Schulpforta. Sie war ein erster Versuch, vor diesem Kreis ein Bild von unseren theoretischen und praktischen Bemühungen am runden Tisch in Berneuchen zu entwerfen. Wer die Protokolle, die aus diesen Tagen erhalten sind, heute durchblättert, wird ergriffen werden von dem leidenschaftlichen Ernst eines lebendigen Ringens um Klarheit für unseren Weg, zugleich aber auch von dem Eindruck, wie sehr die dort versammelten Männer und Frauen fast erdrückt wurden durch die weitausgreifende Fülle der Fragen, vor die sie sich durch die Wirklichkeit des Protestantismus, an der sie ja alle, ein jeder auf seine Weise, leidend Anteil hatten, gestellt sahen.
 Im Mittelpunkt der Debatte stand der Symbolbegriff, der uns den Dienst tun sollte, den Ort zu bezeichnen, an dem gottesdienstliches Handeln und also Leben in der Kirche möglich wird. Wieder trug Tillich durch seine Fähigkeit zu unerbittlicher begrifflicher Analyse wesentlich zur Klärung bei. Er sprach es offen aus: „Der Symbolbegriff hat etwas Unheimliches nicht nur für die, die dagegen opponieren, sondern auch für die, die ihn gebrauchen. Ist nicht das Aufsuchen der Symbolsphäre Flucht aus der Wirklichkeit? Besteht nicht die Gefahr, daß das Symbol als Erkennungszeichen in Wahrheit gar nicht zu erkennen gibt, was erkannt werden soll? Erweckt der Symbolbegriff nicht die Angst vor dem Nicht-die-Wirklichkeit-treffen? Und doch müssen wir vom Symbol sprechen, weil wir uns vor der Meinung schützen müssen, als ob wir die transzendente Wirklichkeit irgendwie direkt greifen könnten. Der Symbolbegriff ist die Opposition gegen den Zugriff auf das „Ding im Jenseits”. Daß wir vom Symbol reden müssen, deckt den Tatbestand auf, daß wir in einer wesenswidrigen Wirklichkeit stehen. Die Tatsache des Symbols ist ein Zeichen der Wesenswidrigkeit unseres Daseins”. Aber so wurde es dann wagend und vorwärtstastend ausgesprochen: Könnte das echte Symbol nicht auch als eine Vorwegnahme des Eschatons verstanden werden? Im Mittelpunkt der Debatte stand der Symbolbegriff, der uns den Dienst tun sollte, den Ort zu bezeichnen, an dem gottesdienstliches Handeln und also Leben in der Kirche möglich wird. Wieder trug Tillich durch seine Fähigkeit zu unerbittlicher begrifflicher Analyse wesentlich zur Klärung bei. Er sprach es offen aus: „Der Symbolbegriff hat etwas Unheimliches nicht nur für die, die dagegen opponieren, sondern auch für die, die ihn gebrauchen. Ist nicht das Aufsuchen der Symbolsphäre Flucht aus der Wirklichkeit? Besteht nicht die Gefahr, daß das Symbol als Erkennungszeichen in Wahrheit gar nicht zu erkennen gibt, was erkannt werden soll? Erweckt der Symbolbegriff nicht die Angst vor dem Nicht-die-Wirklichkeit-treffen? Und doch müssen wir vom Symbol sprechen, weil wir uns vor der Meinung schützen müssen, als ob wir die transzendente Wirklichkeit irgendwie direkt greifen könnten. Der Symbolbegriff ist die Opposition gegen den Zugriff auf das „Ding im Jenseits”. Daß wir vom Symbol reden müssen, deckt den Tatbestand auf, daß wir in einer wesenswidrigen Wirklichkeit stehen. Die Tatsache des Symbols ist ein Zeichen der Wesenswidrigkeit unseres Daseins”. Aber so wurde es dann wagend und vorwärtstastend ausgesprochen: Könnte das echte Symbol nicht auch als eine Vorwegnahme des Eschatons verstanden werden?
 Es kamen die Jahre, in denen wir alle - jeder auf seine Weise und im Zusammenhang seines persönlichen Schicksals - um die Freiheit des Bekenntnisses, um die Freiheit der Kirche zu kämpfen und zu leiden hatten, die Jahre, in denen uns die Evangelische Michaelsbruderschaft zum unentbehrlichen Rückhalt für diesen Kampf, zur Gemeinschaft des Trostes wurde und uns vor der Gefahr bewahren mußte, uns selbst im leidenschaftlichen Nein gegen die böse herrschende Macht an den Geist dieser Macht zu verlieren und Schaden zu nehmen an unserer Seele. Paul Tillich mußte Deutschland verlassen und den schweren Weg der Emigration wählen. Es kamen die Jahre, in denen wir alle - jeder auf seine Weise und im Zusammenhang seines persönlichen Schicksals - um die Freiheit des Bekenntnisses, um die Freiheit der Kirche zu kämpfen und zu leiden hatten, die Jahre, in denen uns die Evangelische Michaelsbruderschaft zum unentbehrlichen Rückhalt für diesen Kampf, zur Gemeinschaft des Trostes wurde und uns vor der Gefahr bewahren mußte, uns selbst im leidenschaftlichen Nein gegen die böse herrschende Macht an den Geist dieser Macht zu verlieren und Schaden zu nehmen an unserer Seele. Paul Tillich mußte Deutschland verlassen und den schweren Weg der Emigration wählen.
 Es konnte nicht ausbleiben, daß die Verbindung zu ihm schon aus äußeren Gründen für lange Jahre unterbrochen wurde. Um so dankbarer sind wir dafür, daß seit dem Zusammenbruch und Neubeginn in unserem Vaterlande nicht nur die Begegnung mit seinem so beglückend ausgereiften und abgeklärten Lebenswerk, wie es insbesondere in seiner „Systematischen Theologie” vorliegt, sondern auch mit ihm persönlich wieder möglich wurde, mit ihm, dem gütigen, liebevollen Freund, der sich nun freilich auf einem sehr anderen und viel weiteren Feld bewähren mußte, der aber - dessen sind wir gewiß - uns ebenso wie damals in stärkster sachlicher und menschlicher Anteilnahme verbunden bleibt. Und nichts Besseres vermöchte ich am Schluß dieser sehr unzulänglichen Skizze seiner Mitarbeit in unserem Kreise auszusprechen als den Wunsch, daß immer noch und wieder von neuem unser Kreis und die, die nach uns kommen, mit dem Pfund wuchern möchten, das uns durch seine Mitarbeit anvertraut wurde. Es konnte nicht ausbleiben, daß die Verbindung zu ihm schon aus äußeren Gründen für lange Jahre unterbrochen wurde. Um so dankbarer sind wir dafür, daß seit dem Zusammenbruch und Neubeginn in unserem Vaterlande nicht nur die Begegnung mit seinem so beglückend ausgereiften und abgeklärten Lebenswerk, wie es insbesondere in seiner „Systematischen Theologie” vorliegt, sondern auch mit ihm persönlich wieder möglich wurde, mit ihm, dem gütigen, liebevollen Freund, der sich nun freilich auf einem sehr anderen und viel weiteren Feld bewähren mußte, der aber - dessen sind wir gewiß - uns ebenso wie damals in stärkster sachlicher und menschlicher Anteilnahme verbunden bleibt. Und nichts Besseres vermöchte ich am Schluß dieser sehr unzulänglichen Skizze seiner Mitarbeit in unserem Kreise auszusprechen als den Wunsch, daß immer noch und wieder von neuem unser Kreis und die, die nach uns kommen, mit dem Pfund wuchern möchten, das uns durch seine Mitarbeit anvertraut wurde.
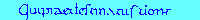
 Paul Tillich wurde am 20. August 1886 als Abkömmling einer Pastoren- und Gelehrtenfamilie in Starzeddel, Kreis Guben, nahe der heutigen Oder-Neiße-Linie geboren. (Der Große Herder nennt neben ihm den Pädagogen und Philanthropen Ernst Tillich, 1780-1 867, aus Groß-Breesen bei Guben.) Paul Tillich wurde am 20. August 1886 als Abkömmling einer Pastoren- und Gelehrtenfamilie in Starzeddel, Kreis Guben, nahe der heutigen Oder-Neiße-Linie geboren. (Der Große Herder nennt neben ihm den Pädagogen und Philanthropen Ernst Tillich, 1780-1 867, aus Groß-Breesen bei Guben.)
 Tillich begann seine Lehrtätigkeit nach dem Ersten Weltkrieg als Privatdozent der Berliner Universität, wurde 1924 Professor in Marburg, erhielt 1925 eine Professur für Religionsphilosophie an der Technischen Hochschule Dresden und wurde 1929 nach Frankfurt am Main berufen. 1933 wanderte er nach den Vereinigten Staaten aus und übernahm eine Professur am Union Theological Seminary in New York. Im vergangenen Jahr hat er einen besonders ehrenvollen Ruf an die Harvard-Universität - bei Boston in New-England - erhalten. Tillich begann seine Lehrtätigkeit nach dem Ersten Weltkrieg als Privatdozent der Berliner Universität, wurde 1924 Professor in Marburg, erhielt 1925 eine Professur für Religionsphilosophie an der Technischen Hochschule Dresden und wurde 1929 nach Frankfurt am Main berufen. 1933 wanderte er nach den Vereinigten Staaten aus und übernahm eine Professur am Union Theological Seminary in New York. Im vergangenen Jahr hat er einen besonders ehrenvollen Ruf an die Harvard-Universität - bei Boston in New-England - erhalten.
Quatember 1956, S. 219-221
|