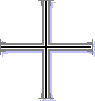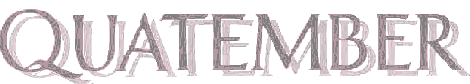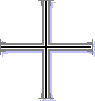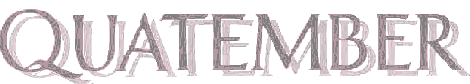Im Jahre 1923 erschien im Taschenbuchformat mit 32 Seiten Umfang ein kleines Heft unter dem Titel „Der Deutsche Dom, liturgische Ordnung für Beichte und Feier des Heiligen Abendmahls, Tages- und Abendgebet”. Der Titel wurde vom Herausgeber gewählt, weil die Neue Kirche, an der er in Berlin Pfarrer war, an den sogenannten Deutschen Dom auf dem Gendarmenmarkt angebaut war, der zusammen mit dem Französischen Dom das staatliche Schauspielhaus flankierte. Die in diesem Heft zusammengestellten Ordnungen stellen für unser heutiges Urteil ein etwas sonderbares Gemisch von lutherischer Restauration und modernen Inventionen dar. Choralverse werden als Gebetsstücke verwandt, die Litanei nach der Fassung, die ihr Luther gegeben hat, auf doppelten Umfang erweitert durch eine neu geschaffene Bußlitanei, in der Ordnung der Abendmahlsfeier wird mit der Struktur der überlieferten abendländischen Ordnung der Messe sehr frei umgegangen. Im Jahre 1923 erschien im Taschenbuchformat mit 32 Seiten Umfang ein kleines Heft unter dem Titel „Der Deutsche Dom, liturgische Ordnung für Beichte und Feier des Heiligen Abendmahls, Tages- und Abendgebet”. Der Titel wurde vom Herausgeber gewählt, weil die Neue Kirche, an der er in Berlin Pfarrer war, an den sogenannten Deutschen Dom auf dem Gendarmenmarkt angebaut war, der zusammen mit dem Französischen Dom das staatliche Schauspielhaus flankierte. Die in diesem Heft zusammengestellten Ordnungen stellen für unser heutiges Urteil ein etwas sonderbares Gemisch von lutherischer Restauration und modernen Inventionen dar. Choralverse werden als Gebetsstücke verwandt, die Litanei nach der Fassung, die ihr Luther gegeben hat, auf doppelten Umfang erweitert durch eine neu geschaffene Bußlitanei, in der Ordnung der Abendmahlsfeier wird mit der Struktur der überlieferten abendländischen Ordnung der Messe sehr frei umgegangen.
 Als drei Jahre später, im Jahre 1926, die Hefte einer kleinen Sammlung „Der Deutsche Dom” herauskamen, schrieb der Herausgeber im Vorwort zu dieser „zweiten Auflage” die Sätze: „Als zum erstenmal die liturgischen Ordnungen für Tages- und Abendgebet veröffentlicht wurden, geschah es nicht, um das liturgische Schrifttum um einen Beitrag zu vermehren und diese Ordnungen der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen, sondern zur Befriedigung eines unmittelbaren Bedürfnisses. Wir brauchten ein Hilfsmittel, um unseren Gemeinden die Ordnungen unserer täglichen Früh- und Abendandachten vertraut zu machen”, wir, das heißt Graf Lüttichau, Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche, und der Herausgeber. Als drei Jahre später, im Jahre 1926, die Hefte einer kleinen Sammlung „Der Deutsche Dom” herauskamen, schrieb der Herausgeber im Vorwort zu dieser „zweiten Auflage” die Sätze: „Als zum erstenmal die liturgischen Ordnungen für Tages- und Abendgebet veröffentlicht wurden, geschah es nicht, um das liturgische Schrifttum um einen Beitrag zu vermehren und diese Ordnungen der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen, sondern zur Befriedigung eines unmittelbaren Bedürfnisses. Wir brauchten ein Hilfsmittel, um unseren Gemeinden die Ordnungen unserer täglichen Früh- und Abendandachten vertraut zu machen”, wir, das heißt Graf Lüttichau, Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche, und der Herausgeber.
 Wir waren in wiederholten Gesprächen übereingekommen, daß es unerträglich sei, unsere im Zentrum der großen Stadt gelegenen Kirchen nur am Sonntag zum Gottesdienst aufzuschließen, während in der Woche jeden Morgen und jeden Abend Hunderttausende an den verschlossenen Kirchentüren vorbeifluteten. Wenn wir aber diese Türen auch am Werktag offenhielten, dann müßte in den Kirchen auch etwas geschehen. So entschlossen wir uns, einen Anfang zu machen. Graf Lüttichau hielt eine Seitenkapelle der Dreifaltigkeitskirche offen, ich selbst richtete im Pfarrhaus in der Kronenstraße eine Hauskapelle ein, für die Otto Bartning den Entwurf eines sehr eigenwilligen, kühn erfundenen Gestühls, und der Generaldirektor der preußischen Museen, Bode, aus den magazinierten Schätzen des Kaiser-Friedrich-Museums ein Altarbild, die Beweinung Christi, beisteuerten. Wir waren in wiederholten Gesprächen übereingekommen, daß es unerträglich sei, unsere im Zentrum der großen Stadt gelegenen Kirchen nur am Sonntag zum Gottesdienst aufzuschließen, während in der Woche jeden Morgen und jeden Abend Hunderttausende an den verschlossenen Kirchentüren vorbeifluteten. Wenn wir aber diese Türen auch am Werktag offenhielten, dann müßte in den Kirchen auch etwas geschehen. So entschlossen wir uns, einen Anfang zu machen. Graf Lüttichau hielt eine Seitenkapelle der Dreifaltigkeitskirche offen, ich selbst richtete im Pfarrhaus in der Kronenstraße eine Hauskapelle ein, für die Otto Bartning den Entwurf eines sehr eigenwilligen, kühn erfundenen Gestühls, und der Generaldirektor der preußischen Museen, Bode, aus den magazinierten Schätzen des Kaiser-Friedrich-Museums ein Altarbild, die Beweinung Christi, beisteuerten.
 Ich kann nicht sagen, daß unser Versuch sehr ermutigend ausfiel. Die Massen strömten nach wie vor an den Kirchtüren vorbei, ohne darauf zu achten, daß sie jetzt nicht mehr gänzlich verschlossen waren. Immerhin konnte ich in jenem schon erwähnten Vorwort zur zweiten Auflage schreiben: „Inzwischen sind die Ordnungen nach mehr als zwei Jahren im täglichen Gebrauch der Feuerprobe ständiger Wiederholung unterworfen gewesen. Sie sind den Kreisen, die sich in ihnen zu täglichem Gebet zusammenfanden, nur immer lieber geworden, je mehr sie uns in Fleisch und Blut übergingen.” Daß sie über den Kreis der Gemeinden hinaus, für die sie zunächst bestimmt waren, erstaunlicherweise Beachtung fanden, zeigt die Kritik, die uns zuteil wurde. Ich kann nicht sagen, daß unser Versuch sehr ermutigend ausfiel. Die Massen strömten nach wie vor an den Kirchtüren vorbei, ohne darauf zu achten, daß sie jetzt nicht mehr gänzlich verschlossen waren. Immerhin konnte ich in jenem schon erwähnten Vorwort zur zweiten Auflage schreiben: „Inzwischen sind die Ordnungen nach mehr als zwei Jahren im täglichen Gebrauch der Feuerprobe ständiger Wiederholung unterworfen gewesen. Sie sind den Kreisen, die sich in ihnen zu täglichem Gebet zusammenfanden, nur immer lieber geworden, je mehr sie uns in Fleisch und Blut übergingen.” Daß sie über den Kreis der Gemeinden hinaus, für die sie zunächst bestimmt waren, erstaunlicherweise Beachtung fanden, zeigt die Kritik, die uns zuteil wurde.

 Man warf uns „katholisierende Tendenzen” vor. Unsere Antwort: „Abgesehen davon, daß unsere evangelische Kirche in früheren Zeiten solche Ordnungen sehr wohl kannte, bekennen wir uns freilich zu der einen heiligen, allgemeinen (und das heißt: katholischen) christlichen Kirche und sind der Meinung, daß die evangelische Kirche eine mindestens ebenso berechtigte Erbin der geistlichen Erfahrung und Bildung der alten Kirche sei wie die römische Kirche.” Einen Vorwurf sehr anderer Art machte uns ein Kritiker aus den Reihen der Christengemeinschaft. Er sah in unseren Versuchen einen „erneuten Beweis für die liturgische Unfruchtbarkeit und Auftragslosigkeit des Protestantismus”. Ihm fehle das Wissen darum, „daß die kultischen Formen mitgewoben sind von den Zeitgeistern”. Dieses Urteil wäre wohl nicht so gefällt worden, wenn man wirklich wahrgenommen hätte, was damals in der Neuen Kirche geschah. Man warf uns „katholisierende Tendenzen” vor. Unsere Antwort: „Abgesehen davon, daß unsere evangelische Kirche in früheren Zeiten solche Ordnungen sehr wohl kannte, bekennen wir uns freilich zu der einen heiligen, allgemeinen (und das heißt: katholischen) christlichen Kirche und sind der Meinung, daß die evangelische Kirche eine mindestens ebenso berechtigte Erbin der geistlichen Erfahrung und Bildung der alten Kirche sei wie die römische Kirche.” Einen Vorwurf sehr anderer Art machte uns ein Kritiker aus den Reihen der Christengemeinschaft. Er sah in unseren Versuchen einen „erneuten Beweis für die liturgische Unfruchtbarkeit und Auftragslosigkeit des Protestantismus”. Ihm fehle das Wissen darum, „daß die kultischen Formen mitgewoben sind von den Zeitgeistern”. Dieses Urteil wäre wohl nicht so gefällt worden, wenn man wirklich wahrgenommen hätte, was damals in der Neuen Kirche geschah.
 Um das verständlich zu machen, muß ich freilich etwas weiter ausholen. In jenen Jahren fand sich in meinem Hause regelmäßig unter dem Namen „Fichtehochschulgemeinde” eine sehr aktive Gruppe von Studenten und Studentinnen der Berliner Hochschulen zusammen, die ihr Gepräge aus der Jugendbewegung empfangen hatten. Nicht selten gingen wir am Wochenende gemeinsam auf Fahrt in die Mark Brandenburg. Ganz von selbst stellte sich das Bedürfnis heraus, bei solchen Gelegenheiten eine Sonntag-Morgenfeier zu gestalten. Wer den Geist und die Art der Jugendbewegung jener Zeit kennt, wird ohne weiteres verstehen, daß wir uns dabei über Lied und Dichtung, über Worte der großen Denker bis zur Lesung aus der Heiligen Schrift, über die freie Ansprache bis zum Gebet einen Weg bahnen mußten. Es war uns selbst erstaunlich, daß dann auch auf großen Tagungen, bei denen bis zu tausend „Wandervögel” zusammenkamen, von dieser Jugend die Bitte um einen Gottesdienst ausgesprochen wurde. Um das verständlich zu machen, muß ich freilich etwas weiter ausholen. In jenen Jahren fand sich in meinem Hause regelmäßig unter dem Namen „Fichtehochschulgemeinde” eine sehr aktive Gruppe von Studenten und Studentinnen der Berliner Hochschulen zusammen, die ihr Gepräge aus der Jugendbewegung empfangen hatten. Nicht selten gingen wir am Wochenende gemeinsam auf Fahrt in die Mark Brandenburg. Ganz von selbst stellte sich das Bedürfnis heraus, bei solchen Gelegenheiten eine Sonntag-Morgenfeier zu gestalten. Wer den Geist und die Art der Jugendbewegung jener Zeit kennt, wird ohne weiteres verstehen, daß wir uns dabei über Lied und Dichtung, über Worte der großen Denker bis zur Lesung aus der Heiligen Schrift, über die freie Ansprache bis zum Gebet einen Weg bahnen mußten. Es war uns selbst erstaunlich, daß dann auch auf großen Tagungen, bei denen bis zu tausend „Wandervögel” zusammenkamen, von dieser Jugend die Bitte um einen Gottesdienst ausgesprochen wurde.
 Diese Jugend drängte zu aktiver Beteiligung in der gottesdienstlichen Feier, in denkbar größtem Gegensatz zu der bürgerlichen Predigt- und Hörergemeinde. Was Liturgie eigentlich ist, das haben wir auf diesem Wege neu entdecken müssen, so merkwürdig uns das heute dünken mag, und so unmöglich uns heute die Experimente erscheinen, die vor Sprechchören, Einzelstimmen, die in der Gemeinde aufstanden und Dichtung auch sehr weltlicher Dichter rezitierten, ja selbst vor einen aus kühner und freier Phantasie geborenen Symbolik der Gebärde nicht zurückscheuten. Diese Jugend drängte zu aktiver Beteiligung in der gottesdienstlichen Feier, in denkbar größtem Gegensatz zu der bürgerlichen Predigt- und Hörergemeinde. Was Liturgie eigentlich ist, das haben wir auf diesem Wege neu entdecken müssen, so merkwürdig uns das heute dünken mag, und so unmöglich uns heute die Experimente erscheinen, die vor Sprechchören, Einzelstimmen, die in der Gemeinde aufstanden und Dichtung auch sehr weltlicher Dichter rezitierten, ja selbst vor einen aus kühner und freier Phantasie geborenen Symbolik der Gebärde nicht zurückscheuten.
 Ganz ähnliche Erfahrungen brachte wohl die Mehrzahl der Freunde mit, die sich damals zu Beginn des dritten Jahrzehnts unseres Säkulums in Berneuchen zusammenfanden, insbesondere wohl Wilhelm Stählin aus seiner großen und so verheißungsvollen Arbeit im Bund deutscher Jugendvereine, und Wilhelm Thomas aus der Singbewegung. Doch blieb die Bemühung um liturgische Gestaltung zunächst ganz am Rande unserer Arbeit in Berneuchen. Wir fanden Zeit für sie wiederholt erst auf der gemeinsamen Bahnfahrt von Berneuchen zurück nach Berlin. Daß wir uns überhaupt auf sie einließen, hatte wieder einen ganz praktischen Grund. Ganz ähnliche Erfahrungen brachte wohl die Mehrzahl der Freunde mit, die sich damals zu Beginn des dritten Jahrzehnts unseres Säkulums in Berneuchen zusammenfanden, insbesondere wohl Wilhelm Stählin aus seiner großen und so verheißungsvollen Arbeit im Bund deutscher Jugendvereine, und Wilhelm Thomas aus der Singbewegung. Doch blieb die Bemühung um liturgische Gestaltung zunächst ganz am Rande unserer Arbeit in Berneuchen. Wir fanden Zeit für sie wiederholt erst auf der gemeinsamen Bahnfahrt von Berneuchen zurück nach Berlin. Daß wir uns überhaupt auf sie einließen, hatte wieder einen ganz praktischen Grund.

 In Berneuchen war, wie in allen von der Tradition getragenen Gutshäusern des Ostens, die gemeinsame Morgenandacht der Hausbewohner mitsamt dem zahlreichen Gesinde des Hauses feste Sitte. Ebenso selbstverständlich war, daß der Gutsherr uns Pastoren bat, diese Morgenandachten zu übernehmen. Dabei empfanden wir sehr bald, wie schwierig es für jeden von uns war. ohne eine feste Ordnung diese durch unsere Anwesenheit ja sehr bunt zusammengesetzte Gemeinde zu wirklicher Andacht anzuleiten. Wenn wir den ganzen Tag miteinander um theologische Erkenntnis gerungen hatten, erschien es uns fast unmöglich, den unbefangenen Schritt zu tun, der die uns aufwühlenden Fragen dahinten ließ und zu dem gemeinsamen Gebet zusammenführte. In Berneuchen war, wie in allen von der Tradition getragenen Gutshäusern des Ostens, die gemeinsame Morgenandacht der Hausbewohner mitsamt dem zahlreichen Gesinde des Hauses feste Sitte. Ebenso selbstverständlich war, daß der Gutsherr uns Pastoren bat, diese Morgenandachten zu übernehmen. Dabei empfanden wir sehr bald, wie schwierig es für jeden von uns war. ohne eine feste Ordnung diese durch unsere Anwesenheit ja sehr bunt zusammengesetzte Gemeinde zu wirklicher Andacht anzuleiten. Wenn wir den ganzen Tag miteinander um theologische Erkenntnis gerungen hatten, erschien es uns fast unmöglich, den unbefangenen Schritt zu tun, der die uns aufwühlenden Fragen dahinten ließ und zu dem gemeinsamen Gebet zusammenführte.
 Zunächst baten wir darum, den Speisesaal des Hauses verlassen und in dem nahen schönen Dorfkirchlein die Andacht halten zu dürfen. Aber nun erhob sich erst recht das Verlangen nach einer feststehenden, der Kritik entzogenen, überzeugenden Ordnung solcher Andacht. Bald stellte sich auch das Verlangen heraus, zum Abschluß der Arbeitstage das Heilige Mahl miteinander zu feiern. Ein ganz praktisches, konkretes Bedürfnis zwang uns also zu einer grundsätzlichen Besinnung auf die sachgemäße Gestalt des christlichen Gottesdienstes. Welche Fragen uns dabei von der Jugendbewegung her mitgegeben waren, das hat Wilhelm Thomas in den Einführungen zu den Sammlungen „Das Morgenlied” und „Das Abendlied” ausgeführt, die er mit Konrad Ameln herausgab. Zunächst baten wir darum, den Speisesaal des Hauses verlassen und in dem nahen schönen Dorfkirchlein die Andacht halten zu dürfen. Aber nun erhob sich erst recht das Verlangen nach einer feststehenden, der Kritik entzogenen, überzeugenden Ordnung solcher Andacht. Bald stellte sich auch das Verlangen heraus, zum Abschluß der Arbeitstage das Heilige Mahl miteinander zu feiern. Ein ganz praktisches, konkretes Bedürfnis zwang uns also zu einer grundsätzlichen Besinnung auf die sachgemäße Gestalt des christlichen Gottesdienstes. Welche Fragen uns dabei von der Jugendbewegung her mitgegeben waren, das hat Wilhelm Thomas in den Einführungen zu den Sammlungen „Das Morgenlied” und „Das Abendlied” ausgeführt, die er mit Konrad Ameln herausgab.
 Die Frage, von der wir ausgingen, lautete: Was soll und muß in diesem konkreten Gottesdienste innerlich geschehen, welches ist die notwendige, sinngemäße Handlung der betreffenden Stunden? Aus dieser Fragestellung mußten sich nach unserer Meinung die Ordnungen von selbst und sachgemäß ergeben. Ob bei ihrer Erfüllung mehr oder weniger aus dem Gute der Tradition geschöpft wurde, das war eine Frage zweiten Ranges, sofern es nur gelang, die liturgische Handlung in klare und zwingende Formen zu fassen. Die Frage, von der wir ausgingen, lautete: Was soll und muß in diesem konkreten Gottesdienste innerlich geschehen, welches ist die notwendige, sinngemäße Handlung der betreffenden Stunden? Aus dieser Fragestellung mußten sich nach unserer Meinung die Ordnungen von selbst und sachgemäß ergeben. Ob bei ihrer Erfüllung mehr oder weniger aus dem Gute der Tradition geschöpft wurde, das war eine Frage zweiten Ranges, sofern es nur gelang, die liturgische Handlung in klare und zwingende Formen zu fassen.
 Die wiederholt erwähnte zweite Auflage des „Deutschen Domes” mußte unter der Auswirkung solcher Besinnung zu einer grundlegenden Neugestaltung werden. Eine weitgehende Vereinfachung fand statt „im Gedanken an die unzähligen Glieder unserer Gemeinden, denen die reiche und verschlungene Tradition, die in der ersten Auflage in großem Umfange zu Worte kam, ein verwirrendes Vielerlei bedeutet”. Größte Durchsichtigkeit des Aufbaues, einfachste und doch strenge sprachliche Gestaltung waren die Forderungen, die wir uns selbst stellten. Wegweisend für die Arbeit wurden zudem Gedanken, wie sie in den Jahrgängen des „Gottesjahres” niedergelegt waren, die sich 1924 mit dem Kirchenjahr, 1925 mit der Ordnung des Tages, und 1926 mit der Wochenordnung, befaßten. Die wiederholt erwähnte zweite Auflage des „Deutschen Domes” mußte unter der Auswirkung solcher Besinnung zu einer grundlegenden Neugestaltung werden. Eine weitgehende Vereinfachung fand statt „im Gedanken an die unzähligen Glieder unserer Gemeinden, denen die reiche und verschlungene Tradition, die in der ersten Auflage in großem Umfange zu Worte kam, ein verwirrendes Vielerlei bedeutet”. Größte Durchsichtigkeit des Aufbaues, einfachste und doch strenge sprachliche Gestaltung waren die Forderungen, die wir uns selbst stellten. Wegweisend für die Arbeit wurden zudem Gedanken, wie sie in den Jahrgängen des „Gottesjahres” niedergelegt waren, die sich 1924 mit dem Kirchenjahr, 1925 mit der Ordnung des Tages, und 1926 mit der Wochenordnung, befaßten.
 Der Berichterstatter kann nicht leugnen, daß ihn eine gewisse Wehmut überfällt, wenn er die Zeugnisse aus der Arbeit jener Jahre des Anfangs überprüft. Die Frage drängt sich ihm auf, ob wir uns nicht auf dem weiteren Wege allzusehr von einer für die lebendige und schöpferische Arbeit unerläßlichen Unmittelbarkeit zur Sache durch die Fülle geschichtlicher Erkenntnisse und den freilich überwältigenden Reichtum der gesamtkirchlichen Tradition haben abdrängen lassen. Der Berichterstatter kann nicht leugnen, daß ihn eine gewisse Wehmut überfällt, wenn er die Zeugnisse aus der Arbeit jener Jahre des Anfangs überprüft. Die Frage drängt sich ihm auf, ob wir uns nicht auf dem weiteren Wege allzusehr von einer für die lebendige und schöpferische Arbeit unerläßlichen Unmittelbarkeit zur Sache durch die Fülle geschichtlicher Erkenntnisse und den freilich überwältigenden Reichtum der gesamtkirchlichen Tradition haben abdrängen lassen.
Quatember 1958, S. 157-159
|