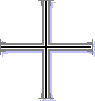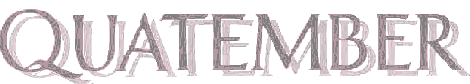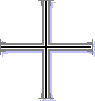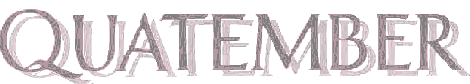An erster Stelle dieses Briefes möchte ich zweier Menschen gedenken, die in diesen Monaten ihren Erdenweg vollendet haben, und die in aller Verschiedenheit ihrer menschlichen und geistigen Art etwas Wesentliches für meinen und vieler meiner Freunde Weg bedeutet haben: An erster Stelle dieses Briefes möchte ich zweier Menschen gedenken, die in diesen Monaten ihren Erdenweg vollendet haben, und die in aller Verschiedenheit ihrer menschlichen und geistigen Art etwas Wesentliches für meinen und vieler meiner Freunde Weg bedeutet haben:
 Der Tod Gertrud Bäumers weckt nicht nur dankbare Erinnerungen an Bilder und Zusammenhänge, die ihre Bücher lebendig gemacht haben, sondern vor allem auch an eine unvergeßliche persönliche Begegnung. Gelegentlich einer Tagung unseres Berneuchener Kreises in Gießmannsdorf in Schlesien waren ein paar von uns zu einer überaus lebhaften Plauderstunde in ihrem schönen Heim, das sie damals dort bewohnte, zu Gast, und am Abend hielt sie uns einen Vortrag über die Michaelsgestalt in der deutschen Kaisergeschichte; ich entsinne mich nicht genau ihres Themas, aber dieses war jedenfalls die „Sache”, die sie uns in plastischen Bildern vor Augen stellte. Danach fragten wir sie, warum sie eigentlich, die sie doch allen gegenwärtigen Bewegungen die Bahn brechen wollte, in ihren Büchern uns immer wieder den Menschen des Mittelalters zu schildern unternommen habe. Ihre Antwort hat sich wohl allen, die Zeugen jenes Gesprächs waren, unauslöschlich eingeprägt. In zwei Dingen, sagte sie dem Sinn nach, sei der mittelalterliche Mensch ein notwendiges und heilsames Korrektiv des heute unter uns herrschenden Typus. Die Menschen des Mittelalters seien die Menschen „des großen Pendelausschlages” gewesen: maßlos in ihrem Lieben und ihrem Hassen, in ihrem Streiten und Morden, in allen Leidenschaften, seien sie auch fähig und willig gewesen, mit gleicher Intensität zu büßen, zu beten und zu opfern; danach sei der Mensch „des kleinen Pendelausschlages” herrschend geworden, der nach keiner Seite, weder zum Bösen noch zum Guten, die Kraft echter glühender Leidenschaft in sich trage, der nur noch ordentlich oder unordentlich sein könne, und Kant habe seinen großen Anteil daran, daß der Protestantismus so überwiegend eine Religion oder vielmehr eine Pflichtethik der bürgerlichen Bravheit geworden sei, und ferner - sie sprach vor allem von Parzival - habe der Mensch des Mittelalters unermüdlich darum gerungen, die Weite der Welt und die Liebe zu ihr mit dem Dienst Gottes zu einer tiefen Einheit zu verbinden, während von der Renaissance her beides auseinandergebrochen sei, der Gott liebende Mensch immer nur mit schlechtem Gewissen die Welt lieb habe, und die übermächtige Liebe zur Welt die Liebe zu den Geheimnissen Gottes habe erkalten lassen. So etwa beschrieb sie uns den mittelalterlichen Menschen, dem ein so großer Teil ihrer literarischen Arbeit gewidmet war: das fast tragisch zu nennende Zeugnis einer doppelten ungestillten Sehnsucht, die ein mit starken Verstandeskräften begabter Mensch der Gegenwart nach einer anderen Zeit der großen Einheit und Intensität des Lebens mit Gott und mit der Welt empfand. Der Tod Gertrud Bäumers weckt nicht nur dankbare Erinnerungen an Bilder und Zusammenhänge, die ihre Bücher lebendig gemacht haben, sondern vor allem auch an eine unvergeßliche persönliche Begegnung. Gelegentlich einer Tagung unseres Berneuchener Kreises in Gießmannsdorf in Schlesien waren ein paar von uns zu einer überaus lebhaften Plauderstunde in ihrem schönen Heim, das sie damals dort bewohnte, zu Gast, und am Abend hielt sie uns einen Vortrag über die Michaelsgestalt in der deutschen Kaisergeschichte; ich entsinne mich nicht genau ihres Themas, aber dieses war jedenfalls die „Sache”, die sie uns in plastischen Bildern vor Augen stellte. Danach fragten wir sie, warum sie eigentlich, die sie doch allen gegenwärtigen Bewegungen die Bahn brechen wollte, in ihren Büchern uns immer wieder den Menschen des Mittelalters zu schildern unternommen habe. Ihre Antwort hat sich wohl allen, die Zeugen jenes Gesprächs waren, unauslöschlich eingeprägt. In zwei Dingen, sagte sie dem Sinn nach, sei der mittelalterliche Mensch ein notwendiges und heilsames Korrektiv des heute unter uns herrschenden Typus. Die Menschen des Mittelalters seien die Menschen „des großen Pendelausschlages” gewesen: maßlos in ihrem Lieben und ihrem Hassen, in ihrem Streiten und Morden, in allen Leidenschaften, seien sie auch fähig und willig gewesen, mit gleicher Intensität zu büßen, zu beten und zu opfern; danach sei der Mensch „des kleinen Pendelausschlages” herrschend geworden, der nach keiner Seite, weder zum Bösen noch zum Guten, die Kraft echter glühender Leidenschaft in sich trage, der nur noch ordentlich oder unordentlich sein könne, und Kant habe seinen großen Anteil daran, daß der Protestantismus so überwiegend eine Religion oder vielmehr eine Pflichtethik der bürgerlichen Bravheit geworden sei, und ferner - sie sprach vor allem von Parzival - habe der Mensch des Mittelalters unermüdlich darum gerungen, die Weite der Welt und die Liebe zu ihr mit dem Dienst Gottes zu einer tiefen Einheit zu verbinden, während von der Renaissance her beides auseinandergebrochen sei, der Gott liebende Mensch immer nur mit schlechtem Gewissen die Welt lieb habe, und die übermächtige Liebe zur Welt die Liebe zu den Geheimnissen Gottes habe erkalten lassen. So etwa beschrieb sie uns den mittelalterlichen Menschen, dem ein so großer Teil ihrer literarischen Arbeit gewidmet war: das fast tragisch zu nennende Zeugnis einer doppelten ungestillten Sehnsucht, die ein mit starken Verstandeskräften begabter Mensch der Gegenwart nach einer anderen Zeit der großen Einheit und Intensität des Lebens mit Gott und mit der Welt empfand.

 Am l. Juni dieses Jahres ist Wilhelm Stapel, der mir im Lebensalter ein Jahr voraus gewesen ist, gestorben. Er gehörte mit Karl Bernhard Ritter und mir zu den Männern, die im August 1919 auf Burg Lauenstein den „Jungdeutschen Bund” begründeten. Beim erstenmal in Berneuchen Mai 1923 war Wilhelm Stapel dabei, aber er fühlte sich anderen Aufgaben stärker verpflichtet; doch gewannen seine Bücher, „Die volksbürgerliche Erziehung”, „Der christliche Staatsmann” u.a. und vor allem seine Zeitschrift „Deutsches Volkstum”, die er 20 Jahre hindurch herausgab und mit seinem Geist erfüllte, eine große Bedeutung für uns. Ich werde persönlich Wilhelm Stapel immer dafür dankbar bleiben, daß er uns gelehrt hat, auf die deutsche Sprache und auf ihre Geheimnisse zu achten. Durch Wilhelm Stapel wurde ich auf Wolframs Parzival-Dichtung, durch seine Sammlung „Aus alten Bücherschränken” auf den Ludus de Antichristo aufmerksam; kurz vor seinem Tod erschien seine Übersetzung des Heliand, parallel seiner frühen Prosa-Nachdichtung des Parzival; ein Aufsatz über den Ludus de Antichristo erschien, 14 Tage nach seinem Tode, im Deutschen Pfarrerblatt. Am l. Juni dieses Jahres ist Wilhelm Stapel, der mir im Lebensalter ein Jahr voraus gewesen ist, gestorben. Er gehörte mit Karl Bernhard Ritter und mir zu den Männern, die im August 1919 auf Burg Lauenstein den „Jungdeutschen Bund” begründeten. Beim erstenmal in Berneuchen Mai 1923 war Wilhelm Stapel dabei, aber er fühlte sich anderen Aufgaben stärker verpflichtet; doch gewannen seine Bücher, „Die volksbürgerliche Erziehung”, „Der christliche Staatsmann” u.a. und vor allem seine Zeitschrift „Deutsches Volkstum”, die er 20 Jahre hindurch herausgab und mit seinem Geist erfüllte, eine große Bedeutung für uns. Ich werde persönlich Wilhelm Stapel immer dafür dankbar bleiben, daß er uns gelehrt hat, auf die deutsche Sprache und auf ihre Geheimnisse zu achten. Durch Wilhelm Stapel wurde ich auf Wolframs Parzival-Dichtung, durch seine Sammlung „Aus alten Bücherschränken” auf den Ludus de Antichristo aufmerksam; kurz vor seinem Tod erschien seine Übersetzung des Heliand, parallel seiner frühen Prosa-Nachdichtung des Parzival; ein Aufsatz über den Ludus de Antichristo erschien, 14 Tage nach seinem Tode, im Deutschen Pfarrerblatt.
 Ich habe mir, als ich von seinem Tod erfuhr, sein heute ganz vergessenes „Büchlein Thaumasia” hervorgeholt, das 1924 - gleichzeitig mit meinem ersten „Gottesjahr”-Band - gleichfalls im Greifen-Verlag zu Rudolstadt erschienen ist: „Das sind dreißig Andachten vor den Wundern des Lebens, denen, die gern starren in die heimliche Tiefe hinter den Dingen, und deren Ohr gelüstet nach den Tönen, die durch die Welt wehen, wenn alles ganz still ist bei den einsamen Gedanken zu Mitten der Nacht, da das Herz der lichten Sonne gedenkt, zu trösten die Seele, die sonder Willen in die Welt ist verschlagen worden”. Ich blättere darin und finde wieder alles, was mich vor dreißig Jahren als eine neue Entdeckung beglückte. „Aus Tod und Leben webt sich das geheimnisvolle Widerspiel, das wir Deutschen mit dem tiefsinnigen Wörtlein „Werden” bezeichnen. Dieses Wörtchen bedeutet nicht nur ein Tätigsein, ein Aktiv, auch nicht nur ein Erleiden, ein Passiv, sondern beides, Aktiv und Passiv zugleich; es ist ein Mittleres zwischen beidem, ein „Medium”. Es drückt ein Handeln aus, das sich selbst zum Gegenstand hat, es enthält in sich selbst zugleich Subjekt und Objekt: das, was wirket, ist das Subjekt, das, zu dem es wird, ist das Objekt. Ich werde ein anderes Ich, das doch dasselbe Ich ist. Die romanischen Sprachen haben dieses Wort nicht, sie müssen es äußerlich umschreiben.” Ich habe mir, als ich von seinem Tod erfuhr, sein heute ganz vergessenes „Büchlein Thaumasia” hervorgeholt, das 1924 - gleichzeitig mit meinem ersten „Gottesjahr”-Band - gleichfalls im Greifen-Verlag zu Rudolstadt erschienen ist: „Das sind dreißig Andachten vor den Wundern des Lebens, denen, die gern starren in die heimliche Tiefe hinter den Dingen, und deren Ohr gelüstet nach den Tönen, die durch die Welt wehen, wenn alles ganz still ist bei den einsamen Gedanken zu Mitten der Nacht, da das Herz der lichten Sonne gedenkt, zu trösten die Seele, die sonder Willen in die Welt ist verschlagen worden”. Ich blättere darin und finde wieder alles, was mich vor dreißig Jahren als eine neue Entdeckung beglückte. „Aus Tod und Leben webt sich das geheimnisvolle Widerspiel, das wir Deutschen mit dem tiefsinnigen Wörtlein „Werden” bezeichnen. Dieses Wörtchen bedeutet nicht nur ein Tätigsein, ein Aktiv, auch nicht nur ein Erleiden, ein Passiv, sondern beides, Aktiv und Passiv zugleich; es ist ein Mittleres zwischen beidem, ein „Medium”. Es drückt ein Handeln aus, das sich selbst zum Gegenstand hat, es enthält in sich selbst zugleich Subjekt und Objekt: das, was wirket, ist das Subjekt, das, zu dem es wird, ist das Objekt. Ich werde ein anderes Ich, das doch dasselbe Ich ist. Die romanischen Sprachen haben dieses Wort nicht, sie müssen es äußerlich umschreiben.”
 Im Frühjahr 1933 schrieb Wilhelm Stapel - wer außer ihm schrieb das damals? - wir hätten nun einen neuen Reichskanzler, aber im Unterschied von den Kanzlern der letzten Zeit würden wir Mühe haben, ihn wieder los zu werden. Das hinderte Stapel, den konservativen Altmärker, nicht, im Nationalsozialismus auch manche Weiterführung seiner eigenen „völkischen” Ideen und Ideale zu sehen, und führte ihn eine Zeitlang auch in enge Nachbarschaft mit den „deutschen Christen”. Die scharfe und bisweilen bissige Kritik seiner journalistischen Randbemerkungen richtete sich nun nicht nur gegen eine dekadente Großstadtliteratur, sondern verschonte auch Männer und Kreise nicht, denen wir uns dankbar verbunden wußten. So verloren wir allmählich die enge Verbindung früherer Jahre. Aber nach dem Krieg schrieb mir Wilhelm Stapel, er sei wohl auch eine Zeitlang der Verführung des bösen Feindes erlegen; aber seit er ihm „in sein böses Auge gesehen” habe, werde ihn keine Macht der Welt mehr von dem Bekenntnis zu Jesus Christus als unserem Herrn und Erlöser entfernen. Dieses sein ernsthaftes Bekenntnis zu Jesus Christus war freilich verbunden mit einer radikalen Ablehnung der heutigen evangelischen Kirche. Als ich mich aus meinem Bischofsamt löste, begründete er seinen Glückwünsch mit persönlichen Erfahrungen in einer Schärfe des Ausdrucks, die ich nicht wiedergeben kann; und es war für ihn bezeichnend, daß auch dabei das schlechte Deutsch mancher berühmter Kirchenmänner seinen besonderen Zorn und ein tiefes Mißtrauen erweckt hatte. Im Frühjahr 1933 schrieb Wilhelm Stapel - wer außer ihm schrieb das damals? - wir hätten nun einen neuen Reichskanzler, aber im Unterschied von den Kanzlern der letzten Zeit würden wir Mühe haben, ihn wieder los zu werden. Das hinderte Stapel, den konservativen Altmärker, nicht, im Nationalsozialismus auch manche Weiterführung seiner eigenen „völkischen” Ideen und Ideale zu sehen, und führte ihn eine Zeitlang auch in enge Nachbarschaft mit den „deutschen Christen”. Die scharfe und bisweilen bissige Kritik seiner journalistischen Randbemerkungen richtete sich nun nicht nur gegen eine dekadente Großstadtliteratur, sondern verschonte auch Männer und Kreise nicht, denen wir uns dankbar verbunden wußten. So verloren wir allmählich die enge Verbindung früherer Jahre. Aber nach dem Krieg schrieb mir Wilhelm Stapel, er sei wohl auch eine Zeitlang der Verführung des bösen Feindes erlegen; aber seit er ihm „in sein böses Auge gesehen” habe, werde ihn keine Macht der Welt mehr von dem Bekenntnis zu Jesus Christus als unserem Herrn und Erlöser entfernen. Dieses sein ernsthaftes Bekenntnis zu Jesus Christus war freilich verbunden mit einer radikalen Ablehnung der heutigen evangelischen Kirche. Als ich mich aus meinem Bischofsamt löste, begründete er seinen Glückwünsch mit persönlichen Erfahrungen in einer Schärfe des Ausdrucks, die ich nicht wiedergeben kann; und es war für ihn bezeichnend, daß auch dabei das schlechte Deutsch mancher berühmter Kirchenmänner seinen besonderen Zorn und ein tiefes Mißtrauen erweckt hatte.
 Kurz nach seinem 70. Geburtstag zitierte er Klaus Croth: „He mug toletz ni mehr”; und zu meinem 70. Geburtstag schrieb er mir einen bitteren Brief: „Als ich zwölf Jahre alt war, rannte ich in furchtbarem Seelenschmerz mit dem Kopf gegen die Wand und schrie „Ich will sterben”. Ich lebe immer noch. Muß.” „Ich habe noch einmal meine Heimat, die Nordmark Albrechts des Bären, besucht und bin dort glücklich gewesen. Zu dem politischen und kirchlichen West-Betrieb zucke ich die Achseln, zu dem Ost-Betrieb auch. Weder Westen noch Osten bringen uns das irdische Heil, sondern - wir sind nicht dazu da, daß es uns wohl gehe auf Erden.”
Vielleicht habe auch ich ihm zu wenig davon gesagt, wie viel ich ihm danke, und wie sehr ich ihn, auch in seiner unbequemen Art, verehrt und geliebt habe. Kurz nach seinem 70. Geburtstag zitierte er Klaus Croth: „He mug toletz ni mehr”; und zu meinem 70. Geburtstag schrieb er mir einen bitteren Brief: „Als ich zwölf Jahre alt war, rannte ich in furchtbarem Seelenschmerz mit dem Kopf gegen die Wand und schrie „Ich will sterben”. Ich lebe immer noch. Muß.” „Ich habe noch einmal meine Heimat, die Nordmark Albrechts des Bären, besucht und bin dort glücklich gewesen. Zu dem politischen und kirchlichen West-Betrieb zucke ich die Achseln, zu dem Ost-Betrieb auch. Weder Westen noch Osten bringen uns das irdische Heil, sondern - wir sind nicht dazu da, daß es uns wohl gehe auf Erden.”
Vielleicht habe auch ich ihm zu wenig davon gesagt, wie viel ich ihm danke, und wie sehr ich ihn, auch in seiner unbequemen Art, verehrt und geliebt habe.
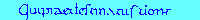
Ein Leser drückt mir seine Unzufriedenheit damit aus, daß ich mit dem „Sprach-und Begriffsscheusal” „Bibelarbeit” noch so glimpflich umgegangen bin und es in gewissem Maß verteidigt habe. „Wir haben uns in unseren Jugendkreisen und im Konvent der Mitarbeiter Gedanken gemacht, wie wir diese mißglückte Modeschöpfung verbannen könnten, ohne uns ein anderes ebenso unglückliches Kleidungsstück beilegen zu müssen. Wir haben daher ein Wort übernommen, das das Wesentliche besser beschreibt: Schriftbetrachtung.” Dieses Wort läßt freilich scheinbar keinen Raum für die manchmal notwendigen Einleitungsworte zum sachlichen Verständnis eines nicht sofort überschaubaren Textes. „Wichtiger aber als dieser Einwand schien uns das andere: ‚Schriftbetrachtung’ mahnt uns an die rechte Haltung beim Lesen, Hören und Verkündigen und bewahrt uns davor, ins geistliche Geschwätz zu geraten. Es erschließt uns auch Tiefen, die nur dem Gebet und dem darin geschärften Auge erschlossen sind.” Ich gebe diese Äußerung zunächst einmal weiter. Es scheint mir kein Zweifel darüber, daß „Bibelarbeit” und „Bibelbetrachtung” nicht nur zwei verschiedene Namen für ein und dieselbe Sache sind, sondern daß damit zwei verschiedene innere Haltungen, zwei grundverschiedene Arten, mit der Bibel umzugehen, bezeichnet werden; leider scheint es mir ebenso unzweifelhaft zu sein, daß in unserer Kirche sehr viel mehr Bibelarbeit als Bibelbetrachtung getrieben wird.
 Inzwischen hat mir noch ein weit entfernt lebender Freund zu dieser Frage geschrieben: „Mir kommt es doch vor, daß das Wort „Arbeit” nicht in dieser Weise mit „Bibel” verbunden werden kann, vielleicht weil eben die Beschäftigung mit der Bibel viel weniger gedankliche Klimmzüge als liebende Versenkung erfordert, und dem widerspricht das Wort Arbeit. Es hat einen Beigeschmack der modernen Betriebsamkeit. Weil man immer arbeitet, meint man, man müsse auch arbeiten, wenn man sich an die Bibel macht. Man kann Handarbeiten, Strickarbeiten, Doktorarbeiten machen, warum nicht auch einmal Bibelarbeit?” Inzwischen hat mir noch ein weit entfernt lebender Freund zu dieser Frage geschrieben: „Mir kommt es doch vor, daß das Wort „Arbeit” nicht in dieser Weise mit „Bibel” verbunden werden kann, vielleicht weil eben die Beschäftigung mit der Bibel viel weniger gedankliche Klimmzüge als liebende Versenkung erfordert, und dem widerspricht das Wort Arbeit. Es hat einen Beigeschmack der modernen Betriebsamkeit. Weil man immer arbeitet, meint man, man müsse auch arbeiten, wenn man sich an die Bibel macht. Man kann Handarbeiten, Strickarbeiten, Doktorarbeiten machen, warum nicht auch einmal Bibelarbeit?”
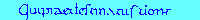
Ein juristischer Leser unserer Blätter schreibt mir mit Bezug auf einige Stellen im „Brief” des vorvorigen Heftes: „Was wäre dringlicher als eine protestantische Lehre von dem, was notwendig ist, ohne heilsnotwendig zu sein? Es gibt Handlungen, ohne deren Inangriffnahme der Glaube nicht konkret und nicht ernst ist, und unter ihnen auch solche, deren Sinn im wesentlichen nur der ist, daß sie Zeichen des Ernstes sind.” - „Ich habe auch Ihren Hinweis auf die Braunschweiger Brüder-Kirche mit großer Anteilnahme gelesen. Absolut treffend ist es, daß alle diese wichtigen Dinge, vom Knieen angefangen, zwar wacker von Generation zu Generation gesungen werden, aber nicht getan werden dürfen. Für einen Juristen können Leistungen so gut wie im Handeln auch im Unterlassen bestehen, und so habe ich keine Schwierigkeit, in den todernsten protestantischen Unterlassungspflichten dieselbe Werkheiligkeit zu erkennen, zu deren Niederhaltung sie von Haus aus eingeschärft wurden.”
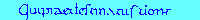
Eva-Brigitte Aschenheim hat mit ihrem kleinen Beitrag „Beunruhigung durch den Test?” den Wunsch erfüllt, daß uns einmal von sachverständiger Seite etwas über das Wesen, den Nutzen und die Gefahren des Testverfahrens gesagt werden möchte. Freilich kann ich nicht finden, daß ihre Mitteilungen geeignet sind, die Bedenken, die ich in meiner kurzen Bemerkung geltend gemacht hatte, zu zerstreuen. Der etymologische Zusammenhang zwischen Test und t e s t i m o n i u m besagt über den heutigen Sprachgebrauch ebenso wenig, wie die Wortbedeutung von p r o t e s t a r i , das ist: sich von Gott als Zeuge gebrauchen lassen, den heutigen Protestantismus kennzeichnet. Es ist wichtig zu erfahren, daß es eine Kontrolle über die am Test-verfahren beteiligten Psychologen gibt; aber das wäre doch nur dann wirklich beruhigend, wenn die Eltern sicher sein könnten, daß die ihre Kinder testenden Fachleute wirklich unter dieser Kontrolle stehen und wenn die Zugehörigkeit zum „BDP” eine Garantie für jene persönlichen Qualitäten geben könnte, die auch nach Frau A. entscheidend sind.
 Ebenso wichtig ist die Einsicht, daß man mit dem Testverfahren „nicht alles über den Menschen erfahren kann”; aber haben nicht solche Teilerkenntnisse und Feststellungen, wie sie im Testverfahren gewonnen werden können, die unheimliche Tendenz, sich an Stelle des Ganzen zu setzen, und wird hier nicht doch versucht, jenes tiefere Verstehen, das nur in lebendigem und liebendem Umgang und in eindringendem Gespräch gewonnen werden kann, durch ein scheinbar objektiveres, mechanisches Verfahren zu ersetzen? Frau A. schreibt, daß die Freiheit der Person nur dann unangetastet bleibt, wenn die Triebkraft zur Testarbeit nicht Wissensdurst und Neugier, sondern der Wille zu helfen ist; aber wer hält jene pseudowissenschaftliche Neugier, die sich in das Geheimnis der Person eindrängt, fern von dem Gebrauch der Test-Methode? Bleibt dieses Geheimnis der Person - auch des Kindes! - wirklich gewahrt, wenn eben der Test sich selber zutraut, „über den gegenwärtigen Stand der Persönlichkeit Verbindliches auszusagen?” Ebenso wichtig ist die Einsicht, daß man mit dem Testverfahren „nicht alles über den Menschen erfahren kann”; aber haben nicht solche Teilerkenntnisse und Feststellungen, wie sie im Testverfahren gewonnen werden können, die unheimliche Tendenz, sich an Stelle des Ganzen zu setzen, und wird hier nicht doch versucht, jenes tiefere Verstehen, das nur in lebendigem und liebendem Umgang und in eindringendem Gespräch gewonnen werden kann, durch ein scheinbar objektiveres, mechanisches Verfahren zu ersetzen? Frau A. schreibt, daß die Freiheit der Person nur dann unangetastet bleibt, wenn die Triebkraft zur Testarbeit nicht Wissensdurst und Neugier, sondern der Wille zu helfen ist; aber wer hält jene pseudowissenschaftliche Neugier, die sich in das Geheimnis der Person eindrängt, fern von dem Gebrauch der Test-Methode? Bleibt dieses Geheimnis der Person - auch des Kindes! - wirklich gewahrt, wenn eben der Test sich selber zutraut, „über den gegenwärtigen Stand der Persönlichkeit Verbindliches auszusagen?”
 Ich fühle mich keineswegs beruhigt, sondern eher in meiner Sorge und in meiner tiefen Abneigung gegen dieses Verfahren bestätigt und bestärkt. Ich fühle mich keineswegs beruhigt, sondern eher in meiner Sorge und in meiner tiefen Abneigung gegen dieses Verfahren bestätigt und bestärkt.
Quatember 1954, S. 250-253
|