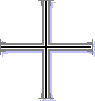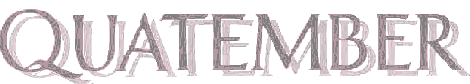Die im letzten Osterheft aufgeworfene Frage nach den Grenzen, die dem Menschen gesetzt sind, ist von den Lesern unserer Zeitschrift, man kann schon sagen, leidenschaftlich aufgegriffen worden. Offenbar sind wir auf ein Zentralproblem gestoßen, das uns alle aufs tiefste bewegt. Die im letzten Osterheft aufgeworfene Frage nach den Grenzen, die dem Menschen gesetzt sind, ist von den Lesern unserer Zeitschrift, man kann schon sagen, leidenschaftlich aufgegriffen worden. Offenbar sind wir auf ein Zentralproblem gestoßen, das uns alle aufs tiefste bewegt.
 Wir bilden uns nicht ein, dieses Problem lösen zu können, das heute der ganzen Menschheit Kopfzerbrechen macht. Es wäre aber schon etwas gewonnen, wenn wir Ansatzpunkte finden könnten, die einen Einstieg ermöglichen. Von den Fragen von Karl Knoch und von den Hinweisen von Günter Howe ausgehend und die Leserzuschriften auswertend hat der Verfasser versucht, diese Arbeit zu leisten. Karl Knoch und Günter Howe haben sich der Mühe unterzogen, sie durchzusehen und einiges zu verbessern und zu ergänzen. Insofern darf sie als das Ergebnis gemeinsamen Nachdenkens bezeichnet werden. Wir bilden uns nicht ein, dieses Problem lösen zu können, das heute der ganzen Menschheit Kopfzerbrechen macht. Es wäre aber schon etwas gewonnen, wenn wir Ansatzpunkte finden könnten, die einen Einstieg ermöglichen. Von den Fragen von Karl Knoch und von den Hinweisen von Günter Howe ausgehend und die Leserzuschriften auswertend hat der Verfasser versucht, diese Arbeit zu leisten. Karl Knoch und Günter Howe haben sich der Mühe unterzogen, sie durchzusehen und einiges zu verbessern und zu ergänzen. Insofern darf sie als das Ergebnis gemeinsamen Nachdenkens bezeichnet werden.
 Versuchen wir zunächst, aus den Zuschriften der Leser herauszuhören, was für die Beantwortung unserer Frage von Bedeutung ist! Es gibt Leser, die es für ein Wesensmerkmal des Menschen halten, daß ihm von Gott Grenzen gesetzt sind, und dabei an den Baum der Erkenntnis erinnern; und es gibt Leser, die es für abwegig halten, den Wissenschaften Grenzen zu setzen - Grenzen, die immer schon überschritten sind, wenn man ihrer inne wird. Es haben sich aber auch Stimmen gemeldet, die Unterschiede machen und etwa die Atom- und Luftraumforschung bejahen, die Versuche, Leben auf künstlichem Wege herzustellen, dagegen unbedingt ablehnen. Andere Leser vertiefen die Frage, indem sie die den Menschen gesetzten Grenzen relativieren: der Mensch sei in ständiger Entwicklung begriffen und trage Kräfte in sich, die den Atomkräften ähnlich seien und ihn zerreißen würden, wenn sie nicht allmählich zur Entfaltung kämen. Gott setze den Menschen von Zeit zu Zeit immer wieder neue Grenzen und mit diesen Grenzen Aufgaben, für die jeweils neue Kräfte des Denkens aufgeboten werden müßten. Versuchen wir zunächst, aus den Zuschriften der Leser herauszuhören, was für die Beantwortung unserer Frage von Bedeutung ist! Es gibt Leser, die es für ein Wesensmerkmal des Menschen halten, daß ihm von Gott Grenzen gesetzt sind, und dabei an den Baum der Erkenntnis erinnern; und es gibt Leser, die es für abwegig halten, den Wissenschaften Grenzen zu setzen - Grenzen, die immer schon überschritten sind, wenn man ihrer inne wird. Es haben sich aber auch Stimmen gemeldet, die Unterschiede machen und etwa die Atom- und Luftraumforschung bejahen, die Versuche, Leben auf künstlichem Wege herzustellen, dagegen unbedingt ablehnen. Andere Leser vertiefen die Frage, indem sie die den Menschen gesetzten Grenzen relativieren: der Mensch sei in ständiger Entwicklung begriffen und trage Kräfte in sich, die den Atomkräften ähnlich seien und ihn zerreißen würden, wenn sie nicht allmählich zur Entfaltung kämen. Gott setze den Menschen von Zeit zu Zeit immer wieder neue Grenzen und mit diesen Grenzen Aufgaben, für die jeweils neue Kräfte des Denkens aufgeboten werden müßten.
 Diese Aufgaben aber beständen darin, daß der Mensch den „Rückschritt” ausschalten soll, der mit jedem „Fortschritt” in der Forschung verbunden ist, so wie der Arzt die Aufgabe hat, die unerwünschten Folgen eines Heilmittels auszuschalten. Wenn wir uns von diesen Aufgaben dispensieren und lieber Zäune aufrichten, um den Fortgang der Geschichte zu bremsen, dann verzichten wir auf die Freiheit innerhalb des uns gegebenen Spielraums, und die Zeit wird über uns hinweggehen. Die Tatsache, daß Gott uns Grenzen setzt, kommt nicht in Normen zum Ausdruck, die ein für allemal festliegen, sondern darin, daß dem Wissen das Gewissen zugeordnet ist. Der äußeren Grenze entspricht eine innere Grenze in uns selber; doch ist auch diese Grenze vorläufig. Indessen ist „das individuelle Gewissen”, wie Günter Howe zu diesem Leserbeitrag bemerkt, „ja weitgehend machtlos, und es geht deshalb darum, daß die Christenheit insgesamt oder stellvertretend durch ihr prophetisches Amt überhaupt den Horizont in Frage stellt, in welchem sich unsere Entscheidungen vollziehen, und das heißt dann wieder, daß wir die geschichtlichen Vorentscheidungen zu überprüfen haben, die zu unserer heutigen Lage geführt haben”. Diese Aufgaben aber beständen darin, daß der Mensch den „Rückschritt” ausschalten soll, der mit jedem „Fortschritt” in der Forschung verbunden ist, so wie der Arzt die Aufgabe hat, die unerwünschten Folgen eines Heilmittels auszuschalten. Wenn wir uns von diesen Aufgaben dispensieren und lieber Zäune aufrichten, um den Fortgang der Geschichte zu bremsen, dann verzichten wir auf die Freiheit innerhalb des uns gegebenen Spielraums, und die Zeit wird über uns hinweggehen. Die Tatsache, daß Gott uns Grenzen setzt, kommt nicht in Normen zum Ausdruck, die ein für allemal festliegen, sondern darin, daß dem Wissen das Gewissen zugeordnet ist. Der äußeren Grenze entspricht eine innere Grenze in uns selber; doch ist auch diese Grenze vorläufig. Indessen ist „das individuelle Gewissen”, wie Günter Howe zu diesem Leserbeitrag bemerkt, „ja weitgehend machtlos, und es geht deshalb darum, daß die Christenheit insgesamt oder stellvertretend durch ihr prophetisches Amt überhaupt den Horizont in Frage stellt, in welchem sich unsere Entscheidungen vollziehen, und das heißt dann wieder, daß wir die geschichtlichen Vorentscheidungen zu überprüfen haben, die zu unserer heutigen Lage geführt haben”.

 Zu beherzigen ist auch die Bemerkung, daß wir die Ohnmacht, die uns angesichts der Entwicklung von Wissenschaften und Technik überkommt, nicht mit der Machtlosigkeit verwechseln dürfen, die wir vor dem Herrn des Kosmos empfinden. Zu beherzigen ist auch die Bemerkung, daß wir die Ohnmacht, die uns angesichts der Entwicklung von Wissenschaften und Technik überkommt, nicht mit der Machtlosigkeit verwechseln dürfen, die wir vor dem Herrn des Kosmos empfinden.
 Was die Wissenschaften anbetrifft, so sind wir Laien in der Verlegenheit, daß wir nicht sachverständig sind und doch mitreden möchten; denn es geht ja um unser Leben. In dieser Verlegenheit verfallen wir leicht in den Fehler, ihnen von uns aus Grenzen zu ziehen und sie womöglich mundtot zu machen. Doch würden wir damit den Spielraum unausgenutzt lassen, den der Herr des Kosmos uns zum Leben zuweist, und uns von vornherein der Möglichkeit begeben, in dem Spiel der Kräfte mitzuwirken und ihm eine gute Wendung zu geben. Was soll aber der Mensch tun, der nicht sachverständig ist und nicht mitreden kann in dem Prozeß, in den er doch selber verwickelt ist? Auf diese Frage haben unsere Leser drei Antworten gefunden: er soll, wo er es für geboten hält - zum Beispiel in der Frage der künstlichen Befruchtung oder der Tötung „lebensunwerten” Lebens - den Mut zu einem persönlich zu verantwortenden, vorläufigen Nein aufbringen, um das Gewissen der Sachverständigen und Spezialisten zu schärfen; er soll ferner seine Verantwortung in dem Bereich wahrnehmen, in dem er selber zuständig und sachverständig ist; und er soll schließlich betend und fürbittend hinter den Spezialisten der Wissenschaft, der Technik, der Politik stehen, die stellvertretend für die ganze Menschheit zu handeln haben. Denn auch auf diesen Gebieten darf, wie in einer anderen Zuschrift betont wird, nur geschehen, was wir Gott zu Lob und Ehre bringen können. Der Schreiber dieser Zeilen fügt ein Gedicht bei, das sich an Simon Dachs Choral (EKG 322) anlehnt und in dem es heißt: Was die Wissenschaften anbetrifft, so sind wir Laien in der Verlegenheit, daß wir nicht sachverständig sind und doch mitreden möchten; denn es geht ja um unser Leben. In dieser Verlegenheit verfallen wir leicht in den Fehler, ihnen von uns aus Grenzen zu ziehen und sie womöglich mundtot zu machen. Doch würden wir damit den Spielraum unausgenutzt lassen, den der Herr des Kosmos uns zum Leben zuweist, und uns von vornherein der Möglichkeit begeben, in dem Spiel der Kräfte mitzuwirken und ihm eine gute Wendung zu geben. Was soll aber der Mensch tun, der nicht sachverständig ist und nicht mitreden kann in dem Prozeß, in den er doch selber verwickelt ist? Auf diese Frage haben unsere Leser drei Antworten gefunden: er soll, wo er es für geboten hält - zum Beispiel in der Frage der künstlichen Befruchtung oder der Tötung „lebensunwerten” Lebens - den Mut zu einem persönlich zu verantwortenden, vorläufigen Nein aufbringen, um das Gewissen der Sachverständigen und Spezialisten zu schärfen; er soll ferner seine Verantwortung in dem Bereich wahrnehmen, in dem er selber zuständig und sachverständig ist; und er soll schließlich betend und fürbittend hinter den Spezialisten der Wissenschaft, der Technik, der Politik stehen, die stellvertretend für die ganze Menschheit zu handeln haben. Denn auch auf diesen Gebieten darf, wie in einer anderen Zuschrift betont wird, nur geschehen, was wir Gott zu Lob und Ehre bringen können. Der Schreiber dieser Zeilen fügt ein Gedicht bei, das sich an Simon Dachs Choral (EKG 322) anlehnt und in dem es heißt:
Könnten wir doch wandern wie die Väter,
heimzukommen früher oder später!
All ihre Plagen
waren mit dem Heimweh leicht zu tragen.
Der Roboter klappert - leere Hüllen!
Nur der Engel kann mit Lob erfüllen
Hebel und Schrauben.
Wir, wir aber können nicht mehr glauben.
 Soweit die Leserstimmen! Was die Verantwortung und Mitarbeit des einzelnen, besonders des Nicht-Spezialisten anbetrifft, so wird sich nicht viel mehr sagen lassen. Es ist, abgesehen vom Gebet, über dessen Kraft und Wirkung sich nicht diskutieren läßt, herzlich wenig. Aber wir werden zugeben müssen, daß wir es auch an diesem Wenigen fehlen lassen. Soweit die Leserstimmen! Was die Verantwortung und Mitarbeit des einzelnen, besonders des Nicht-Spezialisten anbetrifft, so wird sich nicht viel mehr sagen lassen. Es ist, abgesehen vom Gebet, über dessen Kraft und Wirkung sich nicht diskutieren läßt, herzlich wenig. Aber wir werden zugeben müssen, daß wir es auch an diesem Wenigen fehlen lassen.
Mensch und Kosmos
 Wie steht es nun mit der Verantwortung des Spezialisten? Auch seine Möglichkeiten sind gering, und zwar nicht allein, weil ein Spezialist auf den anderen angewiesen ist und weil der Fortgang der Wissenschaften nicht von ihm abhängt. Der Vergleich des Wissenschaftlers mit dem Arzt, zu dessen Kunst es gehört, die schädlichen Nebenwirkungen eines Heilmittels auszuschalten, ist nicht ganz stichhaltig. Es gibt eben Fälle, in denen das Schädliche nicht als Nebenwirkung auftritt, sondern Gegenstand und Ziel der Forschung ist. Schon immer hat der Krieg, dieser Stiefvater aller Dinge, die Entwicklung der Technik gefördert, die dann erst später dem friedlichen Aufbau zugute kann. Wir stellen Gifte her, um Unkraut und Schädlinge zu bekämpfen oder um sie in kleinen Dosen als Medikamente zu verabreichen. Aber einerlei, welche Absichten wir damit verfolgen, das Gift ist da, wenigstens als eine potentielle Gefahr. Wir wissen auch, daß ein falscher, verbrecherischer Gebrauch vorkommt, und wir müssen damit rechnen, daß es unkontrollierbare und unabwendbare Veränderungen herbeiführt. Wie steht es nun mit der Verantwortung des Spezialisten? Auch seine Möglichkeiten sind gering, und zwar nicht allein, weil ein Spezialist auf den anderen angewiesen ist und weil der Fortgang der Wissenschaften nicht von ihm abhängt. Der Vergleich des Wissenschaftlers mit dem Arzt, zu dessen Kunst es gehört, die schädlichen Nebenwirkungen eines Heilmittels auszuschalten, ist nicht ganz stichhaltig. Es gibt eben Fälle, in denen das Schädliche nicht als Nebenwirkung auftritt, sondern Gegenstand und Ziel der Forschung ist. Schon immer hat der Krieg, dieser Stiefvater aller Dinge, die Entwicklung der Technik gefördert, die dann erst später dem friedlichen Aufbau zugute kann. Wir stellen Gifte her, um Unkraut und Schädlinge zu bekämpfen oder um sie in kleinen Dosen als Medikamente zu verabreichen. Aber einerlei, welche Absichten wir damit verfolgen, das Gift ist da, wenigstens als eine potentielle Gefahr. Wir wissen auch, daß ein falscher, verbrecherischer Gebrauch vorkommt, und wir müssen damit rechnen, daß es unkontrollierbare und unabwendbare Veränderungen herbeiführt.
 Nebenbei bemerkt: Was ist eigentlich unrechter Gebrauch und was ist Schädling? Für die Tier- und Pflanzenwelt ist der Mensch der größte Schädling, und in den Augen eines Nihilisten wäre es vermutlich ein gutes und verdienstvolles Werk, wenn man die Menschheit mittels der Atombombe von sich selber erlösen würde; denn: Nebenbei bemerkt: Was ist eigentlich unrechter Gebrauch und was ist Schädling? Für die Tier- und Pflanzenwelt ist der Mensch der größte Schädling, und in den Augen eines Nihilisten wäre es vermutlich ein gutes und verdienstvolles Werk, wenn man die Menschheit mittels der Atombombe von sich selber erlösen würde; denn:
Alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht.
 Schädlich sind jene Nebenwirkungen eben nur im Sinne einer Ethik, die das Leben bejaht. Schädlich sind jene Nebenwirkungen eben nur im Sinne einer Ethik, die das Leben bejaht.
 Wer es aber bejaht, sei es als Gabe Gottes, sei es aus Angst vor dem Tode, sei es auf Grund seiner Vitalität, der muß sich darüber klar sein, daß es nur in einer Lebensgemeinschaft zu haben ist, die ihn nicht allein mit seiner Familie und seinem Volke, nicht allein mit der Menschheit, sondern mit der ganzen Kreatur verbindet. Der ganze Kosmos bildet in seiner räumlichen und zeitlichen Entfaltung einen Zusammenhang, in den wir hineingehören und auf den wir einen sehr bescheidenen, aber wachsenden Einfluß ausüben. Vergegenwärtigen wir uns in aller Kürze, wie sich die Beziehungen des Menschen zum Kosmos verändert haben! Da ist zunächst der Frühmensch, der sich dem Kosmos verbunden fühlt wie seiner Mutter. Er spricht von der Mutter Erde und glaubt an Muttergottheiten. Er nährt sich von dem, was ihm zuwächst. Aber in dem Maße, in dem die Menschen sich vermehren, wird die Nahrung knapper, sie müssen sich ausbreiten, neue Jagdgründe und Weidetriften aufsuchen und schließlich in die Substanz der Erde eingreifen und Ackerbau treiben. Der Nachbar wird zum Rivalen und die Natur zum Ausbeutungsobjekt. Wer es aber bejaht, sei es als Gabe Gottes, sei es aus Angst vor dem Tode, sei es auf Grund seiner Vitalität, der muß sich darüber klar sein, daß es nur in einer Lebensgemeinschaft zu haben ist, die ihn nicht allein mit seiner Familie und seinem Volke, nicht allein mit der Menschheit, sondern mit der ganzen Kreatur verbindet. Der ganze Kosmos bildet in seiner räumlichen und zeitlichen Entfaltung einen Zusammenhang, in den wir hineingehören und auf den wir einen sehr bescheidenen, aber wachsenden Einfluß ausüben. Vergegenwärtigen wir uns in aller Kürze, wie sich die Beziehungen des Menschen zum Kosmos verändert haben! Da ist zunächst der Frühmensch, der sich dem Kosmos verbunden fühlt wie seiner Mutter. Er spricht von der Mutter Erde und glaubt an Muttergottheiten. Er nährt sich von dem, was ihm zuwächst. Aber in dem Maße, in dem die Menschen sich vermehren, wird die Nahrung knapper, sie müssen sich ausbreiten, neue Jagdgründe und Weidetriften aufsuchen und schließlich in die Substanz der Erde eingreifen und Ackerbau treiben. Der Nachbar wird zum Rivalen und die Natur zum Ausbeutungsobjekt.
 Dabei verhält sich der Mensch eigentlich nicht anders als die Pflanze, die andere Pflanzen verdrängt und überwuchert und der Erde ihre Kräfte entzieht. Er vertreibt den Nachbarn, er rottet die Tierwelt aus, er bearbeitet den Boden, bis die Erträge nachlassen, beraubt ihn seiner Schätze und rodet die Waldgebirge, so daß sie verkarsten. Die Erde wird ärmer, und die Bevölkerung wächst. Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts ist die Entwicklung so weit gediehen, daß man auf dieses Mißverhältnis aufmerksam wird. Der englische Pfarrer Robert Malthus stellt düstere Prognosen. Aber die Menschheit überwindet die Grenze, die sich für ihn abzeichnet, indem sie die Gaben der Natur industriell auswertet. Erfindungen und Entdeckungen aller Art werden in der Technik nutzbar gemacht, der Bodenfruchtbarkeit wird durch künstlichen Dünger nachgeholfen, die Warenzufuhr durch Dampfer und Eisenbahn erleichtert, ja, soweit es sich um Massengüter handelt, überhaupt erst ermöglicht. Energiequellen werden erschlossen und Ersatzstoffe hergestellt. Dabei verhält sich der Mensch eigentlich nicht anders als die Pflanze, die andere Pflanzen verdrängt und überwuchert und der Erde ihre Kräfte entzieht. Er vertreibt den Nachbarn, er rottet die Tierwelt aus, er bearbeitet den Boden, bis die Erträge nachlassen, beraubt ihn seiner Schätze und rodet die Waldgebirge, so daß sie verkarsten. Die Erde wird ärmer, und die Bevölkerung wächst. Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts ist die Entwicklung so weit gediehen, daß man auf dieses Mißverhältnis aufmerksam wird. Der englische Pfarrer Robert Malthus stellt düstere Prognosen. Aber die Menschheit überwindet die Grenze, die sich für ihn abzeichnet, indem sie die Gaben der Natur industriell auswertet. Erfindungen und Entdeckungen aller Art werden in der Technik nutzbar gemacht, der Bodenfruchtbarkeit wird durch künstlichen Dünger nachgeholfen, die Warenzufuhr durch Dampfer und Eisenbahn erleichtert, ja, soweit es sich um Massengüter handelt, überhaupt erst ermöglicht. Energiequellen werden erschlossen und Ersatzstoffe hergestellt.

 Im Verlauf dieses Prozesses verwandelt sich das, was wir Natur nennen, allmählich in eine Kulturlandschaft, in ein Nebeneinander von Fabrik- und Parkanlagen, durchkreuzt von Schienensträngen und Hochspannungsleitungen, von Kanälen und Autobahnen. Der Mensch durchdringt die Natur und füllt sie aus, so wie man in einen Anzug hineinwächst, der auf Zuwachs angefertigt wurde. Er begegnet sich selber in diesem neuen Milieu nicht anders, als er sich in seinem Leibe begegnet. Das ist mehr als ein Vergleich. Die Natur, vormals als Mutter verstanden, später als Ausbeutungsobjekt, ist zum erweiterten Leibe der Menschheit geworden, und, wenn dieser sich früher von ihr ernähren ließ oder Raubbau mit ihr trieb, so muß er jetzt etwas für sie tun, damit er seine Lebensgrundlage nicht verliert. Denn sie ist an ihm erkrankt: Abgebaute Gruben, verseuchte Gewässer, verkarstete Gebirge, Degenerationserscheinungen bei Pflanzen und Tieren, Lärm - man denke auch an das Problem des Atommülls! - bedürfen der Therapie, wenn wir selber am Leben bleiben wollen. Im Verlauf dieses Prozesses verwandelt sich das, was wir Natur nennen, allmählich in eine Kulturlandschaft, in ein Nebeneinander von Fabrik- und Parkanlagen, durchkreuzt von Schienensträngen und Hochspannungsleitungen, von Kanälen und Autobahnen. Der Mensch durchdringt die Natur und füllt sie aus, so wie man in einen Anzug hineinwächst, der auf Zuwachs angefertigt wurde. Er begegnet sich selber in diesem neuen Milieu nicht anders, als er sich in seinem Leibe begegnet. Das ist mehr als ein Vergleich. Die Natur, vormals als Mutter verstanden, später als Ausbeutungsobjekt, ist zum erweiterten Leibe der Menschheit geworden, und, wenn dieser sich früher von ihr ernähren ließ oder Raubbau mit ihr trieb, so muß er jetzt etwas für sie tun, damit er seine Lebensgrundlage nicht verliert. Denn sie ist an ihm erkrankt: Abgebaute Gruben, verseuchte Gewässer, verkarstete Gebirge, Degenerationserscheinungen bei Pflanzen und Tieren, Lärm - man denke auch an das Problem des Atommülls! - bedürfen der Therapie, wenn wir selber am Leben bleiben wollen.
 Und zwar ist nicht nur unser physisches, sondern auch unser seelisches und geistiges Leben bedroht; denn unser Geist ist ja leider nicht so autonom, wie man einmal glaubte, sondern ebenfalls auf die Nahrung angewiesen, die ihm die Natur liefert. Diese Nahrung ist nicht ohne Einfluß auf unsere Stimmung. Auch unsere Sprache und Vorstellungswelt lebt von ihr. So verbindet der Ruhrkumpel mit der Vokabel „Luft” eine ganz andere Vorstellung als der Alpenbewohner. Die Vokabel „Straße” wechselt ihre Bedeutung, wenn ich nicht mehr die alte Landstraße vor mir sehe, die den Windungen eines Flusses folgt und die Berge mühsam hinaufklettert, sondern eine Autobahn, die mit allen Geländeschwierigkeiten spielend fertig wird. Indem wir aus der Welt schaffen, was anstrengend und zeitraubend ist, verlieren wir selber die Fähigkeit, uns anzustrengen und uns Zeit zu nehmen. Wir legen uns nicht mehr von der Schöpfung her aus, sondern - wie Günter Howe in seinem einführenden Beitrag ausführte - von der Technik her, das heißt von dem, was wir aus der Natur gemacht haben. Die Kunst liefert dafür gute Beispiele. Ich denke dabei besonders an den französischen Maler Fernand Leger, dessen Menschenbild die Starrheit und die Formen der Maschine in sich aufgenommen hat. Und zwar ist nicht nur unser physisches, sondern auch unser seelisches und geistiges Leben bedroht; denn unser Geist ist ja leider nicht so autonom, wie man einmal glaubte, sondern ebenfalls auf die Nahrung angewiesen, die ihm die Natur liefert. Diese Nahrung ist nicht ohne Einfluß auf unsere Stimmung. Auch unsere Sprache und Vorstellungswelt lebt von ihr. So verbindet der Ruhrkumpel mit der Vokabel „Luft” eine ganz andere Vorstellung als der Alpenbewohner. Die Vokabel „Straße” wechselt ihre Bedeutung, wenn ich nicht mehr die alte Landstraße vor mir sehe, die den Windungen eines Flusses folgt und die Berge mühsam hinaufklettert, sondern eine Autobahn, die mit allen Geländeschwierigkeiten spielend fertig wird. Indem wir aus der Welt schaffen, was anstrengend und zeitraubend ist, verlieren wir selber die Fähigkeit, uns anzustrengen und uns Zeit zu nehmen. Wir legen uns nicht mehr von der Schöpfung her aus, sondern - wie Günter Howe in seinem einführenden Beitrag ausführte - von der Technik her, das heißt von dem, was wir aus der Natur gemacht haben. Die Kunst liefert dafür gute Beispiele. Ich denke dabei besonders an den französischen Maler Fernand Leger, dessen Menschenbild die Starrheit und die Formen der Maschine in sich aufgenommen hat.
 Es gibt also Grenzen, die der Mensch nicht überschreiten kann, ohne sich selber in Frage zu stellen. Er kann sie nicht festlegen oder voraussagen, aber er bekommt es am eigenen Leibe zu spüren, wenn die Natur zum Gegenschlag ausholt und das Gesetz des Handelns an sich reißt. Man denke an die sogenannten Zivilisationskrankheiten, an die Managerkrankheit, an die biologischen Wirkungen der Radioaktivität, man denke auch an die Verkehrsunfälle! Und ist nicht die medizinische Wissenschaft selber an eine Grenze gelangt, wenn ihre Bemühungen um Erhaltung und Verlängerung des Lebens zu dem traurigen Ergebnis führen, daß ein um so größerer Teil der Menschheit nun hungern und verhungern muß? Vielleicht handelt es sich um eine Übergangserscheinung und so sollten wir nicht wie weiland Robert Malthus in einen voreiligen Pessimismus verfallen. Aber das atemberaubende Anwachsen der Weltbevölkerung muß uns doch Kopfzerbrechen machen. Für das Jahr 1650 wurde die Weltbevölkerung auf 545 Millionen geschätzt, für das Jahr 1800 auf 906 Millionen. Heute haben wir drei Milliarden erreicht und im Jahre 2000, das unsere Jugend noch erleben wird, werden es, wenn die Entwickelung so weitergeht, 7 Milliarden sein. Es ist, als legte die Natur dem Menschen die Quittung dafür vor, daß er immer nur an sich selber denkt: Mag er nun auch an sich selber zugrunde gehen! Es gibt also Grenzen, die der Mensch nicht überschreiten kann, ohne sich selber in Frage zu stellen. Er kann sie nicht festlegen oder voraussagen, aber er bekommt es am eigenen Leibe zu spüren, wenn die Natur zum Gegenschlag ausholt und das Gesetz des Handelns an sich reißt. Man denke an die sogenannten Zivilisationskrankheiten, an die Managerkrankheit, an die biologischen Wirkungen der Radioaktivität, man denke auch an die Verkehrsunfälle! Und ist nicht die medizinische Wissenschaft selber an eine Grenze gelangt, wenn ihre Bemühungen um Erhaltung und Verlängerung des Lebens zu dem traurigen Ergebnis führen, daß ein um so größerer Teil der Menschheit nun hungern und verhungern muß? Vielleicht handelt es sich um eine Übergangserscheinung und so sollten wir nicht wie weiland Robert Malthus in einen voreiligen Pessimismus verfallen. Aber das atemberaubende Anwachsen der Weltbevölkerung muß uns doch Kopfzerbrechen machen. Für das Jahr 1650 wurde die Weltbevölkerung auf 545 Millionen geschätzt, für das Jahr 1800 auf 906 Millionen. Heute haben wir drei Milliarden erreicht und im Jahre 2000, das unsere Jugend noch erleben wird, werden es, wenn die Entwickelung so weitergeht, 7 Milliarden sein. Es ist, als legte die Natur dem Menschen die Quittung dafür vor, daß er immer nur an sich selber denkt: Mag er nun auch an sich selber zugrunde gehen!
Christ und Kosmos
 Aber wenn es schon eine Ernährungs- und eine Gesundheitsgrenze, wenn es eine Lebens- oder Todesgrenze gibt, die der Ausbeutung der Natur und der Vermehrung der Menschheit Einhalt gebietet, und wenn diese Grenzen uns schon alarmieren und allen Anlaß geben, den Weg zu überprüfen, den die Menschheit gegangen ist, und andere Wege zu suchen, so schließt das doch nicht aus, daß die Eigengesetzlichkeit der Entwickelung uns über die Grenze hinausdrängen könnte in den Untergang. Wir wollen die Hoffnung, daß es nicht so kommt und daß sich für uns ein Ausweg findet, so wie er sich für das 19. Jahrhundert gefunden hat, nicht aufgeben. Aber sie ist kein Gegenargument, auch dann nicht, wenn sie sich auf den Glauben stützt, daß „Gott im Regimente sitzt”. Gewiß sorgt Gott für seine Kreatur, doch hat er dieser Welt auch ein Ziel gesetzt, „danach aber das Gericht”. Deshalb sollte man niemanden verurteilen oder belächeln, der die Alarmzeichen am Himmel unserer Zeit als ein Memento mori versteht, und erst recht niemanden, der, wie Abraham am Vorabend der Katastrophe von Sodom und Gomorra, Gott mit Fürbitten bestürmt. Aber das wird immer nur die Aufgabe von wenigen sein. Wir anderen sollten, gestützt auf solche Fürbitte, der Frage nachgehen, ob der Mensch nicht doch noch auf jene Eigengesetzlichkeit der Entwicklung Einfluß nehmen kann. Aber wenn es schon eine Ernährungs- und eine Gesundheitsgrenze, wenn es eine Lebens- oder Todesgrenze gibt, die der Ausbeutung der Natur und der Vermehrung der Menschheit Einhalt gebietet, und wenn diese Grenzen uns schon alarmieren und allen Anlaß geben, den Weg zu überprüfen, den die Menschheit gegangen ist, und andere Wege zu suchen, so schließt das doch nicht aus, daß die Eigengesetzlichkeit der Entwickelung uns über die Grenze hinausdrängen könnte in den Untergang. Wir wollen die Hoffnung, daß es nicht so kommt und daß sich für uns ein Ausweg findet, so wie er sich für das 19. Jahrhundert gefunden hat, nicht aufgeben. Aber sie ist kein Gegenargument, auch dann nicht, wenn sie sich auf den Glauben stützt, daß „Gott im Regimente sitzt”. Gewiß sorgt Gott für seine Kreatur, doch hat er dieser Welt auch ein Ziel gesetzt, „danach aber das Gericht”. Deshalb sollte man niemanden verurteilen oder belächeln, der die Alarmzeichen am Himmel unserer Zeit als ein Memento mori versteht, und erst recht niemanden, der, wie Abraham am Vorabend der Katastrophe von Sodom und Gomorra, Gott mit Fürbitten bestürmt. Aber das wird immer nur die Aufgabe von wenigen sein. Wir anderen sollten, gestützt auf solche Fürbitte, der Frage nachgehen, ob der Mensch nicht doch noch auf jene Eigengesetzlichkeit der Entwicklung Einfluß nehmen kann.
 Es ist gewiß nicht gleichgültig, welche Einstellung wir der Natur gegenüber haben, ob wir in ihr Götter am Werke sehen wie die Alten oder nur die Materie oder das Material, das uns zur Befriedigung unserer Bedürfnisse zur Verfügung steht. Man hat mit Recht betont, daß die Vergötterung der Natur der Entwickelung der Technik im Wege stand (Georg Picht, Technik und Überlieferung, Furche-Verlag, Hamburg 1959, S. 10 ff.). Mit der Entthronung der Götter hat das Christentum der Technik den Weg bereitet. Natürlich nicht mit Absicht! Man kann sogar sagen, daß es die Natur aufgewertet hat als die Schöpfung Gottes. Das Lob der Schöpfung ist in der Christenheit nicht verstummt und hat im Sonnengesang des heiligen Franz und in den Chorälen von Paul Gerhardt seinen unüberbietbaren Ausdruck gefunden. Wenn die Kirche auch die Natur entmythologisierte, so hat sie in ihren Gaben doch Gottes Gaben erkannt und sie mit Dank empfangen. Als ein frühes Beispiel dafür sei hier nur ein Opfergebet aus dem zweiten Jahrhundert genannt, das folgenden Wortlaut hat: Es ist gewiß nicht gleichgültig, welche Einstellung wir der Natur gegenüber haben, ob wir in ihr Götter am Werke sehen wie die Alten oder nur die Materie oder das Material, das uns zur Befriedigung unserer Bedürfnisse zur Verfügung steht. Man hat mit Recht betont, daß die Vergötterung der Natur der Entwickelung der Technik im Wege stand (Georg Picht, Technik und Überlieferung, Furche-Verlag, Hamburg 1959, S. 10 ff.). Mit der Entthronung der Götter hat das Christentum der Technik den Weg bereitet. Natürlich nicht mit Absicht! Man kann sogar sagen, daß es die Natur aufgewertet hat als die Schöpfung Gottes. Das Lob der Schöpfung ist in der Christenheit nicht verstummt und hat im Sonnengesang des heiligen Franz und in den Chorälen von Paul Gerhardt seinen unüberbietbaren Ausdruck gefunden. Wenn die Kirche auch die Natur entmythologisierte, so hat sie in ihren Gaben doch Gottes Gaben erkannt und sie mit Dank empfangen. Als ein frühes Beispiel dafür sei hier nur ein Opfergebet aus dem zweiten Jahrhundert genannt, das folgenden Wortlaut hat:
Wir danken Dir Herr und Gott und opfern Dir die Erstlinge der Früchte, welche Du uns gegeben hast, daß wir davon nehmen, nachdem Du sie durch Dein Wort zur Reife gebracht und der Erde befohlen hast, alle Früchte hervorzubringen zum Nutzen, zur Freude und zur Nahrung des Menschengeschlechts und aller erschaffenen Wesen. Wir preisen Dich o Gott wegen dieser und aller anderen Dinge, durch welche Du uns Wohltaten erwiesen hast (Hippolyt).
 Aber das Lob der Schöpfung konnte doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie in den Sündenfall des Menschen hineingezogen war. Sie bedurfte der Heiligung, so wie dieser der Taufe bedurfte, und das Mittelalter hat nicht gezögert, sie in Gestalt von Weihen und Benediktionen von Gott zu erbitten. Erst als der Mensch sich von der übrigen Kreatur distanzierte und sie zum bloßen Gegenstand seines Denkens und Handelns machte, als er glaubte, eigenmächtig über sie verfügen zu können, bekamen jene Weihen den magischen Charakter, den wir ihnen nachsagen, und wurde das Opfergebet dem Mißverständnis ausgesetzt, als könne der Mensch von sich aus Opfer bringen und Genugtuung leisten. Aber das Lob der Schöpfung konnte doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie in den Sündenfall des Menschen hineingezogen war. Sie bedurfte der Heiligung, so wie dieser der Taufe bedurfte, und das Mittelalter hat nicht gezögert, sie in Gestalt von Weihen und Benediktionen von Gott zu erbitten. Erst als der Mensch sich von der übrigen Kreatur distanzierte und sie zum bloßen Gegenstand seines Denkens und Handelns machte, als er glaubte, eigenmächtig über sie verfügen zu können, bekamen jene Weihen den magischen Charakter, den wir ihnen nachsagen, und wurde das Opfergebet dem Mißverständnis ausgesetzt, als könne der Mensch von sich aus Opfer bringen und Genugtuung leisten.

 Diesem Mißverständnis entgegentretend hat nun freilich der Protestantismus und mit ihm der Mensch der Neuzeit die Natur mit ihren Gaben und Kräften vom Gotteslob ausgeschlossen und den Zusammenhang zwischen dem ersten und zweiten Glaubensartikel, zwischen Schöpfung und Erlösung, zwischen zeitlichem und ewigem Leben zerrissen. Die Gaben Gottes wurden nicht mehr mit Danksagung empfangen und durch das Gebet geheiligt (1. Tim. 4, 4), sondern für theologisch belanglos gehalten und zu nützlichen Gegenständen abgewertet. Als die Technik kam und begann, die Natur zu manipulieren, brauchte sie sich nicht mehr mit theologischen Bedenken auseinanderzusetzen. Was nicht Mensch war, war vogelfrei geworden. Das Gefühl der Abhängigkeit von Gott in der Natur schwand dann in dem Maße, in dem sie erforscht und in Dienst genommen wurde. Diesem Mißverständnis entgegentretend hat nun freilich der Protestantismus und mit ihm der Mensch der Neuzeit die Natur mit ihren Gaben und Kräften vom Gotteslob ausgeschlossen und den Zusammenhang zwischen dem ersten und zweiten Glaubensartikel, zwischen Schöpfung und Erlösung, zwischen zeitlichem und ewigem Leben zerrissen. Die Gaben Gottes wurden nicht mehr mit Danksagung empfangen und durch das Gebet geheiligt (1. Tim. 4, 4), sondern für theologisch belanglos gehalten und zu nützlichen Gegenständen abgewertet. Als die Technik kam und begann, die Natur zu manipulieren, brauchte sie sich nicht mehr mit theologischen Bedenken auseinanderzusetzen. Was nicht Mensch war, war vogelfrei geworden. Das Gefühl der Abhängigkeit von Gott in der Natur schwand dann in dem Maße, in dem sie erforscht und in Dienst genommen wurde.
 Das wäre nicht nötig gewesen. Man hätte im Gegenteil erwarten können, daß die Verbundenheit mit der Natur und die Dankbarkeit für ihre Gaben um so mehr wuchs, je mehr sie sich verausgabte, je mehr Menschen sie ernährte, je mehr Fragen sie beantwortete. Daß diese Reaktion ausblieb, läßt sich nur damit erklären, daß die Theologie ihre Zuständigkeit für den Kosmos verkannte, ihn den Wissenschaften überließ und sich in ein Wolkenkuckucksheim reiner Geistigkeit zurückzog (wo sie sich dann als eine Spezialwissenschaft etablierte, die nicht fertig wird, über sich selbst nachzudenken). Das wäre nicht nötig gewesen. Man hätte im Gegenteil erwarten können, daß die Verbundenheit mit der Natur und die Dankbarkeit für ihre Gaben um so mehr wuchs, je mehr sie sich verausgabte, je mehr Menschen sie ernährte, je mehr Fragen sie beantwortete. Daß diese Reaktion ausblieb, läßt sich nur damit erklären, daß die Theologie ihre Zuständigkeit für den Kosmos verkannte, ihn den Wissenschaften überließ und sich in ein Wolkenkuckucksheim reiner Geistigkeit zurückzog (wo sie sich dann als eine Spezialwissenschaft etablierte, die nicht fertig wird, über sich selbst nachzudenken).
 Während der Islam mohammedanische Hochschulen und der Buddhismus buddhistische Universitäten unterhält, ist die christliche Universität vom Kontinent verschwunden. Man treibt Physik, Biologie, Geschichte etsi deus non daretur, als wenn Christus nicht Fleisch geworden und in die Geschichte eingegangen wäre. Die Folge ist eine Erkrankung der Wissenschaften. Von dem Heidelberger Psychosomatiker Kütemeyer stammt die Formulierung, daß wir zwar eine Wissenschaft der Pathologie (Krankheitskunde), aber keine Pathologie der Wissenschaften hätten. Daran fehlt es in der Tat. Vielleicht fehlt es schon am Verständnis dafür. Man sollte aber doch sehen, daß nicht der einzelne Wissenschaftler in die Speichen der Weltgeschichte und der Naturgeschichte greifen kann, auch nicht, wenn er „praktizierender” Christ ist. Die Wissenschaften als solche haben ihr Gefälle, und die Wissenschaften als solche können krank sein, so wie eine Maschine schadhaft sein kann. Die Frage, wie eine solche Pathologie der Wissenschaften aussehen, welche Methoden sie anwenden müßte, kann hier nicht erörtert werden; sie wäre aber des Schweißes der Edlen wert. Während der Islam mohammedanische Hochschulen und der Buddhismus buddhistische Universitäten unterhält, ist die christliche Universität vom Kontinent verschwunden. Man treibt Physik, Biologie, Geschichte etsi deus non daretur, als wenn Christus nicht Fleisch geworden und in die Geschichte eingegangen wäre. Die Folge ist eine Erkrankung der Wissenschaften. Von dem Heidelberger Psychosomatiker Kütemeyer stammt die Formulierung, daß wir zwar eine Wissenschaft der Pathologie (Krankheitskunde), aber keine Pathologie der Wissenschaften hätten. Daran fehlt es in der Tat. Vielleicht fehlt es schon am Verständnis dafür. Man sollte aber doch sehen, daß nicht der einzelne Wissenschaftler in die Speichen der Weltgeschichte und der Naturgeschichte greifen kann, auch nicht, wenn er „praktizierender” Christ ist. Die Wissenschaften als solche haben ihr Gefälle, und die Wissenschaften als solche können krank sein, so wie eine Maschine schadhaft sein kann. Die Frage, wie eine solche Pathologie der Wissenschaften aussehen, welche Methoden sie anwenden müßte, kann hier nicht erörtert werden; sie wäre aber des Schweißes der Edlen wert.
 Schon sind Fachleute der verschiedensten Richtungen zusammengetreten, um zu einer umfassenden Diagnose und wirksamen Therapie zu gelangen. Es wäre aber mit Karl Knoch zu wünschen, daß diese Arbeit auf eine breitere Grundlage gestellt und daß besonders der Theologe daran beteiligt wird; denn, wenn wir recht sehen, hat ja gerade seine Resignation - vorgebildet in dem von Dante gebrandmarkten „feigen Verzicht” Cölestins V. (Hölle, 3. Gesang) - zum Ausbruch der Krankheit geführt. Es scheint auch nicht an Theologen zu fehlen, die hierzu bereit wären. Aber hier ist Vorsicht am Platze. Es gibt nämlich - um einen Ausdruck von Dedo Müller zu gebrauchen - eine Überläufertheologie, die sich von der Welt her versteht. Es gibt Theologen, die sich in der Rolle eines advocatus diaboli gefallen und den Zweifel nicht nur als Methode gelten lassen, sondern zum Prinzip erheben. Eine Pathologie der Wissenschaften aber würde einen Theologen verlangen, der nicht als advocatus diaboli, auch nicht als advocatus mundi, sondern als advocatus dei auftritt. Sie würde einen Theologen verlangen, der christlich denken lehrt. Schon sind Fachleute der verschiedensten Richtungen zusammengetreten, um zu einer umfassenden Diagnose und wirksamen Therapie zu gelangen. Es wäre aber mit Karl Knoch zu wünschen, daß diese Arbeit auf eine breitere Grundlage gestellt und daß besonders der Theologe daran beteiligt wird; denn, wenn wir recht sehen, hat ja gerade seine Resignation - vorgebildet in dem von Dante gebrandmarkten „feigen Verzicht” Cölestins V. (Hölle, 3. Gesang) - zum Ausbruch der Krankheit geführt. Es scheint auch nicht an Theologen zu fehlen, die hierzu bereit wären. Aber hier ist Vorsicht am Platze. Es gibt nämlich - um einen Ausdruck von Dedo Müller zu gebrauchen - eine Überläufertheologie, die sich von der Welt her versteht. Es gibt Theologen, die sich in der Rolle eines advocatus diaboli gefallen und den Zweifel nicht nur als Methode gelten lassen, sondern zum Prinzip erheben. Eine Pathologie der Wissenschaften aber würde einen Theologen verlangen, der nicht als advocatus diaboli, auch nicht als advocatus mundi, sondern als advocatus dei auftritt. Sie würde einen Theologen verlangen, der christlich denken lehrt.
Christlich Denken
 Über das christliche Denken ist in dieser Zeitschrift schon früher von Adolf Köberle Wesentliches gesagt worden (1960/61, Seite 61 ff.). Für unser Problem scheint mir folgendes wichtig: Über das christliche Denken ist in dieser Zeitschrift schon früher von Adolf Köberle Wesentliches gesagt worden (1960/61, Seite 61 ff.). Für unser Problem scheint mir folgendes wichtig:
 Christlich denken heißt, Glauben und Verstand - credere und intelligere - unter einen Hut bringen. Das geschieht dadurch, daß der Verstand am Beten beteiligt wird. Genauer gesagt: wir denken christlich, wenn wir überlegen, was wir dazu beitragen können, daß Gottes Wille geschehe. Die Liturgie der Kirche lenkt den Verstand in diese Richtung. Wer in der Messe das Opfergebet vollzieht und sich dabei vergegenwärtigt, daß die Gaben von Brot und Wein den ganzen Kosmos mitsamt dem Menschen und dem, was er hervorbringt, repräsentieren, und wer dann Gott gegenüber bekennt: „Dein ist alles, was wir sind und haben”, der muß sich darüber klar sein, daß er diese Welt nach bestem Wissen und Gewissen zum Lobe Gottes zu verwalten hat und daß er mit ihr nicht machen kann, was er will. Und wer in der Epiklese bittet, Gott möge Brot und Wein mit dem Heiligen Geist erfüllen, damit Christus in ihnen Fleisch werde, für den sind diese Elemente und die durch sie repräsentierte Natur nicht nur Rohstoffe oder Fabrikate, sondern Gnadengaben, in denen Gott sich uns mitteilt. Gnadengaben aber wird er im Sinne dessen verwenden, der sich in ihnen gegeben hat, und nicht verschwenden oder gar mißbrauchen. Christlich denken heißt, Glauben und Verstand - credere und intelligere - unter einen Hut bringen. Das geschieht dadurch, daß der Verstand am Beten beteiligt wird. Genauer gesagt: wir denken christlich, wenn wir überlegen, was wir dazu beitragen können, daß Gottes Wille geschehe. Die Liturgie der Kirche lenkt den Verstand in diese Richtung. Wer in der Messe das Opfergebet vollzieht und sich dabei vergegenwärtigt, daß die Gaben von Brot und Wein den ganzen Kosmos mitsamt dem Menschen und dem, was er hervorbringt, repräsentieren, und wer dann Gott gegenüber bekennt: „Dein ist alles, was wir sind und haben”, der muß sich darüber klar sein, daß er diese Welt nach bestem Wissen und Gewissen zum Lobe Gottes zu verwalten hat und daß er mit ihr nicht machen kann, was er will. Und wer in der Epiklese bittet, Gott möge Brot und Wein mit dem Heiligen Geist erfüllen, damit Christus in ihnen Fleisch werde, für den sind diese Elemente und die durch sie repräsentierte Natur nicht nur Rohstoffe oder Fabrikate, sondern Gnadengaben, in denen Gott sich uns mitteilt. Gnadengaben aber wird er im Sinne dessen verwenden, der sich in ihnen gegeben hat, und nicht verschwenden oder gar mißbrauchen.
 Unter Hinweis darauf, daß das Brot heute maschinell gefertigt wird, hat Günter Howe in einem unveröffentlichten Referat (Marburg 1961) gesagt: „Gott der Herr ist im Sakrament zur Fabrikware geworden, und seine Kondeszendenz (Selbstentäußerung und Herablassung) in das Sakrament hinein ist tiefer, als sie je zuvor gewesen ist.” Das muß man nun freilich bedenken, und es müßte wohl auch in einer Liturgie für den Menschen des 20. Jahrhunderts ausdrücklich gesagt werden, daß die ganze neue Welt mit ihren Entdeckungen und Erfindungen, mit ihren Maschinen und Kunststoffen, mit all dem, was Gott dem Menschen zufallen und einfallen läßt, damit er davon lebe und Ihn lobe, der Heiligung bedarf. Denn diese neue Welt ist ja genauso gottverlassen wie die Welt der alten Griechen es war, als der Apostel Paulus auf dem Areopag stand, und unsere Industrielandschaft ist genauso von Dämonen bevölkert, wie die antike Landschaft von Göttern bevölkert war. Genauso wie der Apostel die Götter Griechenlands entthronte, müssen wir deshalb auch die Dämonen unserer Zeit im Namen Christi austreiben und unsere Welt zum Tempel Seines Leibes weihen. Unter Hinweis darauf, daß das Brot heute maschinell gefertigt wird, hat Günter Howe in einem unveröffentlichten Referat (Marburg 1961) gesagt: „Gott der Herr ist im Sakrament zur Fabrikware geworden, und seine Kondeszendenz (Selbstentäußerung und Herablassung) in das Sakrament hinein ist tiefer, als sie je zuvor gewesen ist.” Das muß man nun freilich bedenken, und es müßte wohl auch in einer Liturgie für den Menschen des 20. Jahrhunderts ausdrücklich gesagt werden, daß die ganze neue Welt mit ihren Entdeckungen und Erfindungen, mit ihren Maschinen und Kunststoffen, mit all dem, was Gott dem Menschen zufallen und einfallen läßt, damit er davon lebe und Ihn lobe, der Heiligung bedarf. Denn diese neue Welt ist ja genauso gottverlassen wie die Welt der alten Griechen es war, als der Apostel Paulus auf dem Areopag stand, und unsere Industrielandschaft ist genauso von Dämonen bevölkert, wie die antike Landschaft von Göttern bevölkert war. Genauso wie der Apostel die Götter Griechenlands entthronte, müssen wir deshalb auch die Dämonen unserer Zeit im Namen Christi austreiben und unsere Welt zum Tempel Seines Leibes weihen.
 Versuchen wir, dieses an der Liturgie ausgerichtete christliche Denken näher zu beschreiben! Drei Merkmale scheinen ihm eigen zu sein: Versuchen wir, dieses an der Liturgie ausgerichtete christliche Denken näher zu beschreiben! Drei Merkmale scheinen ihm eigen zu sein:
 1. Christlich denken schließt eine Glaubenszuversicht ein, die es davor bewahrt, einer Existenzangst zu verfallen: der Angst vor Krieg und Atombomben, vor der Sinnlosigkeit des Lebens, vor Zukunft und Tod, vor anderen Menschen. Das Denken ist eingebettet in die Glaubenszuversicht, daß der Schöpfer Himmels und der Erde unser Vater ist. Es bleibt ein Denken, es folgt den Gesetzen der Logik, aber es ist kein bloßes Denkvermögen, sondern eine Betätigung des Glaubens. Der Glaube ist an die Stelle der Triebe getreten, die das Denken des natürlichen Menschen in Gang setzen. Weil ich glaube, verstehe ich die Entwicklung der Menschheit und ihres kosmischen Leibes eschatologisch als eine Entwickelung auf Gott hin. Ich verstehe sie als eine Art Läuterungsprozeß, der von der Fleischwerdung Christi ausgeht. Deshalb erblickt christliches Denken in den Gefahren, die es kommen sieht, nicht Klippen oder Untiefen, vor denen das Schiff der Menschheit umkehren müßte, sondern Bojen und Leuchtfeuer, die die Fahrtrinne in den Hafen nach rechts und links abgrenzen und seinen Kurs bestimmen. Und so wie es Leuchtfeuer gibt, die anzeigen, daß ein Kurswechsel vorgenommen werden muß, gibt es auf dem Wege der Menschheit Gefahren, die signalisieren, daß es an der Zeit ist, den Gedanken eine neue Richtung zu geben und umzudenken. 1. Christlich denken schließt eine Glaubenszuversicht ein, die es davor bewahrt, einer Existenzangst zu verfallen: der Angst vor Krieg und Atombomben, vor der Sinnlosigkeit des Lebens, vor Zukunft und Tod, vor anderen Menschen. Das Denken ist eingebettet in die Glaubenszuversicht, daß der Schöpfer Himmels und der Erde unser Vater ist. Es bleibt ein Denken, es folgt den Gesetzen der Logik, aber es ist kein bloßes Denkvermögen, sondern eine Betätigung des Glaubens. Der Glaube ist an die Stelle der Triebe getreten, die das Denken des natürlichen Menschen in Gang setzen. Weil ich glaube, verstehe ich die Entwicklung der Menschheit und ihres kosmischen Leibes eschatologisch als eine Entwickelung auf Gott hin. Ich verstehe sie als eine Art Läuterungsprozeß, der von der Fleischwerdung Christi ausgeht. Deshalb erblickt christliches Denken in den Gefahren, die es kommen sieht, nicht Klippen oder Untiefen, vor denen das Schiff der Menschheit umkehren müßte, sondern Bojen und Leuchtfeuer, die die Fahrtrinne in den Hafen nach rechts und links abgrenzen und seinen Kurs bestimmen. Und so wie es Leuchtfeuer gibt, die anzeigen, daß ein Kurswechsel vorgenommen werden muß, gibt es auf dem Wege der Menschheit Gefahren, die signalisieren, daß es an der Zeit ist, den Gedanken eine neue Richtung zu geben und umzudenken.
 2. Christlich denken heißt in Verbindung mit der Kreatur treten und sich mit ihr einen, sei es nun mit Menschen, auf deren Liebe, mit Tieren, auf deren Zutrauen, oder mit sogenannten toten Gegenständen, auf deren Hilfe wir angewiesen sind. Es ist uns nicht erlaubt, die Natur zu versachlichen und zur bloßen Materie unseres Denkens zu machen. Sogar ein Auto hat Anspruch darauf, daß man sich einfühlt und eins mit ihm wird. Es wird dann anders reagieren als wenn ich es lieblos behandle, das Getriebe quäle, hart schalte, plötzlich bremse und rücksichtslos durch Schlaglöcher fahre. Natürlich hat das Auto keine Seele; aber das ändert nichts daran, daß es sich in meinem Dienste verbraucht. Das Mittelalter hat seiner Verbundenheit mit der Kreatur Ausdruck verliehen, indem es sie personifizierte. Es hat den Wissenschaften, etwa der Logik und der Geometrie, es hat den Tugenden, ja sogar Zuständen wie Frieden und Armut eine menschliche Gestalt gegeben, gewiß nicht in einer poetischen Anwandlung, sondern, weil der Mensch sich als Glied des Kosmos und seine Denktätigkeit als ein Gespräch mit dem Kosmos verstand. Der moderne Wissenschaftler scheint zu dieser Einstellung zurückzukehren, wenn er zum Beispiel sein Experiment als ein „Befragen der Natur” kennzeichnet. Ähnlich der Künstler. Cézanne hat den Ausspruch getan: „Die Landschaft reflektiert sich, humanisiert sich, denkt sich in mir.” Hier ist ein Umdenken im Gange, das unserer Vorstellung von einem christlichen Denken entgegenkommt. Dieses Denken begrenzt sich selber, indem es sich als kreatürliches, mit der Kreatur solidarisches Denken versteht. 2. Christlich denken heißt in Verbindung mit der Kreatur treten und sich mit ihr einen, sei es nun mit Menschen, auf deren Liebe, mit Tieren, auf deren Zutrauen, oder mit sogenannten toten Gegenständen, auf deren Hilfe wir angewiesen sind. Es ist uns nicht erlaubt, die Natur zu versachlichen und zur bloßen Materie unseres Denkens zu machen. Sogar ein Auto hat Anspruch darauf, daß man sich einfühlt und eins mit ihm wird. Es wird dann anders reagieren als wenn ich es lieblos behandle, das Getriebe quäle, hart schalte, plötzlich bremse und rücksichtslos durch Schlaglöcher fahre. Natürlich hat das Auto keine Seele; aber das ändert nichts daran, daß es sich in meinem Dienste verbraucht. Das Mittelalter hat seiner Verbundenheit mit der Kreatur Ausdruck verliehen, indem es sie personifizierte. Es hat den Wissenschaften, etwa der Logik und der Geometrie, es hat den Tugenden, ja sogar Zuständen wie Frieden und Armut eine menschliche Gestalt gegeben, gewiß nicht in einer poetischen Anwandlung, sondern, weil der Mensch sich als Glied des Kosmos und seine Denktätigkeit als ein Gespräch mit dem Kosmos verstand. Der moderne Wissenschaftler scheint zu dieser Einstellung zurückzukehren, wenn er zum Beispiel sein Experiment als ein „Befragen der Natur” kennzeichnet. Ähnlich der Künstler. Cézanne hat den Ausspruch getan: „Die Landschaft reflektiert sich, humanisiert sich, denkt sich in mir.” Hier ist ein Umdenken im Gange, das unserer Vorstellung von einem christlichen Denken entgegenkommt. Dieses Denken begrenzt sich selber, indem es sich als kreatürliches, mit der Kreatur solidarisches Denken versteht.
 3. Christlich denken heißt umsichtig denken. Wir dürfen den Gegenstand des Denkens nicht aus seinem Zusammenhang herausreißen, sondern müssen im Auge behalten, was sonst alles durch unser Denkergebnis mitbetroffen wird. Hierfür zwei Beispiele: Ein nur auf die materielle Wohlfahrt der Menschheit gerichtetes Denken kann zu einer erschreckenden Verflachung und zu einem Verfall des geistigen und seelischen Lebens führen. Ebenso verheerend kann sich einseitiges Denken im Bereich der Natur auswirken: So lassen sich durch Kanalisierung Überschwemmungen verhüten und Wasserwege erschließen, diese Maßnahme kann aber zugleich den Wasserhaushalt der Natur zerstören und eine Versteppung der Landschaft zur Folge haben. In unseren komplizierten Lebensverhältnissen wird ein scheuklappenfreies Denken dem einzelnen freilich kaum mehr möglich sein. Umsichtig denken schließt deshalb ein Miteinander- und Füreinander-Denken ein, so wie ja auch das Beten vor allem ein Miteinander- und Füreinander-Beten ist. Von dem „Wir” der Liturgie her empfängt dieses Denken seinen christlichen Impuls. 3. Christlich denken heißt umsichtig denken. Wir dürfen den Gegenstand des Denkens nicht aus seinem Zusammenhang herausreißen, sondern müssen im Auge behalten, was sonst alles durch unser Denkergebnis mitbetroffen wird. Hierfür zwei Beispiele: Ein nur auf die materielle Wohlfahrt der Menschheit gerichtetes Denken kann zu einer erschreckenden Verflachung und zu einem Verfall des geistigen und seelischen Lebens führen. Ebenso verheerend kann sich einseitiges Denken im Bereich der Natur auswirken: So lassen sich durch Kanalisierung Überschwemmungen verhüten und Wasserwege erschließen, diese Maßnahme kann aber zugleich den Wasserhaushalt der Natur zerstören und eine Versteppung der Landschaft zur Folge haben. In unseren komplizierten Lebensverhältnissen wird ein scheuklappenfreies Denken dem einzelnen freilich kaum mehr möglich sein. Umsichtig denken schließt deshalb ein Miteinander- und Füreinander-Denken ein, so wie ja auch das Beten vor allem ein Miteinander- und Füreinander-Beten ist. Von dem „Wir” der Liturgie her empfängt dieses Denken seinen christlichen Impuls.

 Die fortschreitende Spezialisierung der Wissenschaften macht dieses Miteinander-Denken und die Entwickelung unserer Lebensgemeinschaft zu einer Denkgemeinschaft immer dringlicher. Freilich bietet auch eine Denkgemeinschaft keine Gewähr für die richtige Beantwortung unserer Frage. Man kann in Gemeinschaft auch Böses ausbrüten. Aber die Gemeinschaft, die wir im Auge haben, ist nicht nur eine Gruppe von Fachleuten, sondern, wenn ich so sagen darf, die denkende Kirche selbst, die sich im Vertrauen auf den Heiligen Geist in den Dienst des Erlösungswerkes stellt. Die ecclesia cogitans (denkende Kirche) ist die unserer Zeit angemessene Daseinsweise der ecclesia militans und die notwendige Ergänzung der ecclesia orans. Wir haben dabei keine Bischofskonferenzen oder Synoden im Auge, wir träumen auch noch nicht von einem Weltkonzil, sondern denken zunächst an den stellvertretenden Dienst kleiner Arbeitsgemeinschaften. Auf alle Fälle aber setzt die Lösung unseres Problems die „Einigkeit des Glaubens” voraus, und diese ist für uns nur in der „Mannigfaltigkeit der Zungen” zu haben; wobei wir unter der Mannigfaltigkeit der Zungen nicht nur die Sprachen der Völker dieser Erde verstehen, sondern auch die Sprachen der Wissenschaften und der Konfessionen, und unter der Einigkeit des Glaubens nicht eine Kompromißformel, sondern die gemeinsame Ausrichtung ;auf das eine Ziel, nämlich unsere Einheit in Christus. Die fortschreitende Spezialisierung der Wissenschaften macht dieses Miteinander-Denken und die Entwickelung unserer Lebensgemeinschaft zu einer Denkgemeinschaft immer dringlicher. Freilich bietet auch eine Denkgemeinschaft keine Gewähr für die richtige Beantwortung unserer Frage. Man kann in Gemeinschaft auch Böses ausbrüten. Aber die Gemeinschaft, die wir im Auge haben, ist nicht nur eine Gruppe von Fachleuten, sondern, wenn ich so sagen darf, die denkende Kirche selbst, die sich im Vertrauen auf den Heiligen Geist in den Dienst des Erlösungswerkes stellt. Die ecclesia cogitans (denkende Kirche) ist die unserer Zeit angemessene Daseinsweise der ecclesia militans und die notwendige Ergänzung der ecclesia orans. Wir haben dabei keine Bischofskonferenzen oder Synoden im Auge, wir träumen auch noch nicht von einem Weltkonzil, sondern denken zunächst an den stellvertretenden Dienst kleiner Arbeitsgemeinschaften. Auf alle Fälle aber setzt die Lösung unseres Problems die „Einigkeit des Glaubens” voraus, und diese ist für uns nur in der „Mannigfaltigkeit der Zungen” zu haben; wobei wir unter der Mannigfaltigkeit der Zungen nicht nur die Sprachen der Völker dieser Erde verstehen, sondern auch die Sprachen der Wissenschaften und der Konfessionen, und unter der Einigkeit des Glaubens nicht eine Kompromißformel, sondern die gemeinsame Ausrichtung ;auf das eine Ziel, nämlich unsere Einheit in Christus.
 So läßt sich die Frage nach den Grenzen, die dem Menschen gesetzt sind, unter dem trinitarischen Gesichtspunkt beantworten: So läßt sich die Frage nach den Grenzen, die dem Menschen gesetzt sind, unter dem trinitarischen Gesichtspunkt beantworten:
 Der Glaube an den Schöpfer Himmels und der Erde gibt uns die Gewißheit, daß wir nicht uns selber oder kosmischen Kräften preisgegeben sind, sondern, ,daß menschliche Willkür und Naturgesetze lediglich den Spielraum abgrenzen, in dem wir uns betätigen sollen. Der Glaube an den Schöpfer Himmels und der Erde gibt uns die Gewißheit, daß wir nicht uns selber oder kosmischen Kräften preisgegeben sind, sondern, ,daß menschliche Willkür und Naturgesetze lediglich den Spielraum abgrenzen, in dem wir uns betätigen sollen.
 Die Liebe Christi, der sich uns in der Materie preisgegeben hat, lehrt uns, daß Gott sich zu seinem Erlösungswerk der ganzen Kreatur bedient (Christus ist nicht nur Mensch geworden, sondern Fleisch, Opferfleisch, verfügbarer Gegenstand). Die Dankbarkeit für dieses Opfer verpflichtet uns zum rechten und ehrfürchtigen Gebrauch der in Christus geheiligten Natur und verbietet uns mit ihr leichtfertig, willkürlich, eigensüchtig umzugehen. Die Liebe Christi, der sich uns in der Materie preisgegeben hat, lehrt uns, daß Gott sich zu seinem Erlösungswerk der ganzen Kreatur bedient (Christus ist nicht nur Mensch geworden, sondern Fleisch, Opferfleisch, verfügbarer Gegenstand). Die Dankbarkeit für dieses Opfer verpflichtet uns zum rechten und ehrfürchtigen Gebrauch der in Christus geheiligten Natur und verbietet uns mit ihr leichtfertig, willkürlich, eigensüchtig umzugehen.
 Der Beistand des Heiligen Geistes, den Christus Seiner Kirche verheißen hat, sammelt und erleuchtet uns und hilft uns von Fall zu Fall, Grenzen zu überschreiten, die der einzelne für unüberschreitbar hält, und Grenzen einzuhalten, über die er sich hinwegsetzen möchte. Der Beistand des Heiligen Geistes, den Christus Seiner Kirche verheißen hat, sammelt und erleuchtet uns und hilft uns von Fall zu Fall, Grenzen zu überschreiten, die der einzelne für unüberschreitbar hält, und Grenzen einzuhalten, über die er sich hinwegsetzen möchte.
Quatember 1963, S. 13-22
|