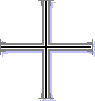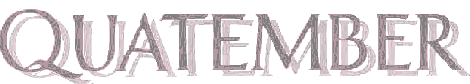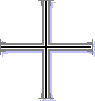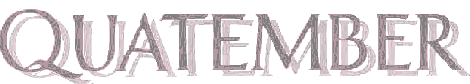Wir waren Gäste in einem Moschav, einer Gemeinschaftssiedlung ähnlich einem Kibbuz, im Norden Israels. Dort konnten wir den Versöhnungstag, den Jom Kippur, miterleben. Zu Beginn des Festes, am Freitagabend, nahmen wir am Gottesdienst in der Synagoge teil. Alle, die dort lebten und arbeiteten und nicht ernstlich verhindert waren, hatten sich eingefunden. Der Geschäftsführer des Moschav (deutscher Herkunft), der uns betreute, gab uns hebräisch-deutsche Gebetbücher in die Hand und setzte sich mit uns, den drei Männern (unsere Frauen waren auf der Empore) in die Mitte der Versammlung. In Berlin hatte ich gelegentlich schon an jüdischen Gottesdiensten teilgenommen. Dieser Gottesdienst im Heiligen Land hatte für mich jedoch etwas Faszinierendes, wie ich es daheim nicht erfahren hatte. Ich hatte den Eindruck: alle waren „dabei”, mit dem Munde und offenbar auch mit dem Herzen, als einzelne unmittelbar zu Gott und als Gemeinschaft vor ihm vereint. Da wurde mir deutlich, was wohl dahinter steckt, wenn von der „Judenschule” gesprochen wird, in der „alle durcheinander reden”. Der eine war mit seinen Gebeten weiter voran, der andere etwas weiter zurück, aber von Zeit zu Zeit vereinten sich doch immer wieder alle und sangen mit einem Munde. Dabei stellte sich bei mir das Bild einer marschierenden singenden Kolonne ein, die auseinanderreißt, auch in ihrem Gesang, um dann immer wieder eins zu werden. Wir waren Gäste in einem Moschav, einer Gemeinschaftssiedlung ähnlich einem Kibbuz, im Norden Israels. Dort konnten wir den Versöhnungstag, den Jom Kippur, miterleben. Zu Beginn des Festes, am Freitagabend, nahmen wir am Gottesdienst in der Synagoge teil. Alle, die dort lebten und arbeiteten und nicht ernstlich verhindert waren, hatten sich eingefunden. Der Geschäftsführer des Moschav (deutscher Herkunft), der uns betreute, gab uns hebräisch-deutsche Gebetbücher in die Hand und setzte sich mit uns, den drei Männern (unsere Frauen waren auf der Empore) in die Mitte der Versammlung. In Berlin hatte ich gelegentlich schon an jüdischen Gottesdiensten teilgenommen. Dieser Gottesdienst im Heiligen Land hatte für mich jedoch etwas Faszinierendes, wie ich es daheim nicht erfahren hatte. Ich hatte den Eindruck: alle waren „dabei”, mit dem Munde und offenbar auch mit dem Herzen, als einzelne unmittelbar zu Gott und als Gemeinschaft vor ihm vereint. Da wurde mir deutlich, was wohl dahinter steckt, wenn von der „Judenschule” gesprochen wird, in der „alle durcheinander reden”. Der eine war mit seinen Gebeten weiter voran, der andere etwas weiter zurück, aber von Zeit zu Zeit vereinten sich doch immer wieder alle und sangen mit einem Munde. Dabei stellte sich bei mir das Bild einer marschierenden singenden Kolonne ein, die auseinanderreißt, auch in ihrem Gesang, um dann immer wieder eins zu werden.
 Ordnung und Freiheit, ein festgeschriebener Ritus und Spontaneität, werden meist als Gegenpole angesehen, aber sie müssen sich nicht gegenseitig ausschließen! Die Gebetbücher, die wir in Nir Etzion, so heißt dieser Moschav, in die Hand bekamen, waren im Jahre 1935 oder 1936 in Frankfurt am Main gedruckt worden. Der Gottesdienst wurde also und wird dort wie vor einem halben Jahrhundert, ja wohl wie seit Jahrhunderten, gehalten. Eine alte Agende m u ß also nicht der Lebendigkeit Abbruch tun. Als ich darüber nachdachte, welcher Form christlichen Gottesdienstes dieser synagogale Gottesdienst am ähnlichsten ist, kam ich nicht etwa auf unseren, sagen wir einmal: protestantischen Gottesdienst, den wir für gewöhnlich in die Nähe des synagogalen rücken. Ordnung und Freiheit, ein festgeschriebener Ritus und Spontaneität, werden meist als Gegenpole angesehen, aber sie müssen sich nicht gegenseitig ausschließen! Die Gebetbücher, die wir in Nir Etzion, so heißt dieser Moschav, in die Hand bekamen, waren im Jahre 1935 oder 1936 in Frankfurt am Main gedruckt worden. Der Gottesdienst wurde also und wird dort wie vor einem halben Jahrhundert, ja wohl wie seit Jahrhunderten, gehalten. Eine alte Agende m u ß also nicht der Lebendigkeit Abbruch tun. Als ich darüber nachdachte, welcher Form christlichen Gottesdienstes dieser synagogale Gottesdienst am ähnlichsten ist, kam ich nicht etwa auf unseren, sagen wir einmal: protestantischen Gottesdienst, den wir für gewöhnlich in die Nähe des synagogalen rücken.
 Obwohl die Gebete und Lesungen meist der hebräischen Bibel entnommen waren und durchaus von uns mitvollzogen werden können, (sehen wir einmal von der Problematik des Versöhnungsfestes - nach Karfreitag - ab), entspricht die Art und Weise dieses Gottesdienstes (etwa zwei Stunden, ohne Predigt!) im christlichen Bereich viel mehr dem Gottesdienst der orthodoxen Kirchen. Auch dort: ein seit Jahrhunderten feststehender Ritus, und durchaus - wie ich es meist, fast immer, erlebt habe - ein lebendiges „Dabeisein” der Gläubigen, auch dort die Einheit von Wort und Ton, Sprache und Musik. Wie der Grieche Thrasybulos Georgios Georgiades feststellt, begegnet uns am Anfang der - vorchristlichen - europäischen Geschichte eine Sprache, die zugleich Musik ist. Die Wurzeln für das Erklingen des einstimmigen liturgischen Gesanges sieht er im Bereich des griechischen und lateinischen Altertums einerseits, des jüdischen Gesanges andererseits (Art. Musik V. 1. 2. in RGG IV, Sp. 1207 f.). Diese Einheit ist heute am ehesten noch in der orthodoxen Christenheit und im jüdischen Kultus orthodoxer - im Unterschied zu liberaler - Observanz zu finden. Die Beobachtung, daß weit voneinander entfernte Religionsgemeinschaften (die orthodoxe Kirche betont nach wie vor am stärksten den Unterschied, ja den Gegensatz zum Judentum) in ihrer gottesdienstlichen Versammlung als verwandt erscheinen, kann für unsere Überlegungen zum Gottesdienst heute durchaus von Bedeutung sein. Obwohl die Gebete und Lesungen meist der hebräischen Bibel entnommen waren und durchaus von uns mitvollzogen werden können, (sehen wir einmal von der Problematik des Versöhnungsfestes - nach Karfreitag - ab), entspricht die Art und Weise dieses Gottesdienstes (etwa zwei Stunden, ohne Predigt!) im christlichen Bereich viel mehr dem Gottesdienst der orthodoxen Kirchen. Auch dort: ein seit Jahrhunderten feststehender Ritus, und durchaus - wie ich es meist, fast immer, erlebt habe - ein lebendiges „Dabeisein” der Gläubigen, auch dort die Einheit von Wort und Ton, Sprache und Musik. Wie der Grieche Thrasybulos Georgios Georgiades feststellt, begegnet uns am Anfang der - vorchristlichen - europäischen Geschichte eine Sprache, die zugleich Musik ist. Die Wurzeln für das Erklingen des einstimmigen liturgischen Gesanges sieht er im Bereich des griechischen und lateinischen Altertums einerseits, des jüdischen Gesanges andererseits (Art. Musik V. 1. 2. in RGG IV, Sp. 1207 f.). Diese Einheit ist heute am ehesten noch in der orthodoxen Christenheit und im jüdischen Kultus orthodoxer - im Unterschied zu liberaler - Observanz zu finden. Die Beobachtung, daß weit voneinander entfernte Religionsgemeinschaften (die orthodoxe Kirche betont nach wie vor am stärksten den Unterschied, ja den Gegensatz zum Judentum) in ihrer gottesdienstlichen Versammlung als verwandt erscheinen, kann für unsere Überlegungen zum Gottesdienst heute durchaus von Bedeutung sein.

 Wer aus einer humanistisch-protestantischen Tradition kommt, überschätzt meist das Gewicht verbaler Änderungen, die etwa in einer Agende vorgenommen werden. Seit Ende der sechziger Jahre häuften sich bei uns die „Gottesdienste in neuer Gestalt”. Das Unbehagen an der Agende in der nachwachsenden Theologengeneration, im Westen wesentlich auch der Umbruch in der Jugend, führten zu vielen neuen Versuchen, die wiederum bei anderen starke Abwehrreaktionen hervorriefen. Im Unterausschuß für Liturgie des Theologischen Ausschusses der Provinzialsynode in Berlin (West) hatten wir damals z. B. ein Gutachten anzufertigen, ob es erlaubt sei, anstelle des Apostolischen oder Nicänischen Glaubensbekenntnisses oder des Glaubensliedes von Martin Luther - diese drei Möglichkeiten sieht die Agende der Evangelischen Kirche der Union vom Jahre 1959 vor - neuformulierte Glaubensbekenntnisse oder auch nur das im Gesangbuch abgedruckte Neue Glaubenslied von Rudolf Alexander Schröder und Christian Lahusen zu verwenden. Das Gutachten war aufgrund der Eingabe eines Superintendenten an das Konsistorium in Auftrag gegeben worden. Damals fiel mir auf, wie das Beharren auf einer engen lutherischen Tradition einerseits („kein Gottesdienst ohne Glaubensbekenntnis!” lautete das Feldgeschrei) und andererseits die Meinung, daß man vor Ort alles und jedes machen könne, wenn nur in einer bestimmten Gruppe etwas erarbeitet und mehrheitlich darüber entschieden worden ist, wie diese beiden Standpunkte sachgemäßen und ökumenisch orientierten Überlegungen entgegenstehen. Wer aus einer humanistisch-protestantischen Tradition kommt, überschätzt meist das Gewicht verbaler Änderungen, die etwa in einer Agende vorgenommen werden. Seit Ende der sechziger Jahre häuften sich bei uns die „Gottesdienste in neuer Gestalt”. Das Unbehagen an der Agende in der nachwachsenden Theologengeneration, im Westen wesentlich auch der Umbruch in der Jugend, führten zu vielen neuen Versuchen, die wiederum bei anderen starke Abwehrreaktionen hervorriefen. Im Unterausschuß für Liturgie des Theologischen Ausschusses der Provinzialsynode in Berlin (West) hatten wir damals z. B. ein Gutachten anzufertigen, ob es erlaubt sei, anstelle des Apostolischen oder Nicänischen Glaubensbekenntnisses oder des Glaubensliedes von Martin Luther - diese drei Möglichkeiten sieht die Agende der Evangelischen Kirche der Union vom Jahre 1959 vor - neuformulierte Glaubensbekenntnisse oder auch nur das im Gesangbuch abgedruckte Neue Glaubenslied von Rudolf Alexander Schröder und Christian Lahusen zu verwenden. Das Gutachten war aufgrund der Eingabe eines Superintendenten an das Konsistorium in Auftrag gegeben worden. Damals fiel mir auf, wie das Beharren auf einer engen lutherischen Tradition einerseits („kein Gottesdienst ohne Glaubensbekenntnis!” lautete das Feldgeschrei) und andererseits die Meinung, daß man vor Ort alles und jedes machen könne, wenn nur in einer bestimmten Gruppe etwas erarbeitet und mehrheitlich darüber entschieden worden ist, wie diese beiden Standpunkte sachgemäßen und ökumenisch orientierten Überlegungen entgegenstehen.
 Um 1970 erhielt ich die Aufgabe, einen „zusammenfassenden Bericht über erprobte neue Formen bei der Gestaltung von Gottesdiensten aufgrund der an das Evangelische Konsistorium gelieferten Einzelberichte” zu erstatten. Wie groß die Variationsbreite der eingegangenen Berichte war, zeigte sich an diesen beiden Extremen: einmal der Forderung, in den Gottesdiensten solle „nichts geändert werden, sondern die Agende für jeden streng verbindlich sein”; dazu als Begründung das Zitat von Jeremias Gotthelf: „Das Volk liebt das Einförmige, Bekannte, Bleibende, und zwar in seinem ganzen Lebenskreis, in Sitten und Spielen, Büchern und Gesängen . . .”; zum anderen ein Gottesdienst mit dem Thema „Wider die Kunst, Anpassung zu üben”, gestaltet von einer Jungen Gemeinde - ohne Gebet! Zu dem Bereich „Gebete” konnte ich feststellen: Um 1970 erhielt ich die Aufgabe, einen „zusammenfassenden Bericht über erprobte neue Formen bei der Gestaltung von Gottesdiensten aufgrund der an das Evangelische Konsistorium gelieferten Einzelberichte” zu erstatten. Wie groß die Variationsbreite der eingegangenen Berichte war, zeigte sich an diesen beiden Extremen: einmal der Forderung, in den Gottesdiensten solle „nichts geändert werden, sondern die Agende für jeden streng verbindlich sein”; dazu als Begründung das Zitat von Jeremias Gotthelf: „Das Volk liebt das Einförmige, Bekannte, Bleibende, und zwar in seinem ganzen Lebenskreis, in Sitten und Spielen, Büchern und Gesängen . . .”; zum anderen ein Gottesdienst mit dem Thema „Wider die Kunst, Anpassung zu üben”, gestaltet von einer Jungen Gemeinde - ohne Gebet! Zu dem Bereich „Gebete” konnte ich feststellen:
 „Von einigen Gemeinden wird betont, daß ‚keine neuen Formulierungen in den Ablauf der Gottesdienste aufgenommen’ werden. Dagegen kann für sehr viele Gemeinden die Feststellung als repräsentativ angesehen werden: ‚Agendarische Gebete sind für den gegenwärtigen gottesdienstlichen Gebrauch fast durchweg ungeeignet.’ Gegenpol zu den in der Agende formulierten Gebeten ist heute wohl weniger das freie Gebet des einzelnen Pfarrers (pietistische Tradition) als das aktualisierte Gebet, das von einem Team vorbereitet wurde. Gebetbücher verschiedener Art (auch Fürbitten- und Kanongebete aus der holländischen katholischen Kirche) werden anstelle unserer agendarischen Gebete häufig benutzt. Die Gebete im Gottesdienst werden nicht selten mit Informationen verbunden.” „Von einigen Gemeinden wird betont, daß ‚keine neuen Formulierungen in den Ablauf der Gottesdienste aufgenommen’ werden. Dagegen kann für sehr viele Gemeinden die Feststellung als repräsentativ angesehen werden: ‚Agendarische Gebete sind für den gegenwärtigen gottesdienstlichen Gebrauch fast durchweg ungeeignet.’ Gegenpol zu den in der Agende formulierten Gebeten ist heute wohl weniger das freie Gebet des einzelnen Pfarrers (pietistische Tradition) als das aktualisierte Gebet, das von einem Team vorbereitet wurde. Gebetbücher verschiedener Art (auch Fürbitten- und Kanongebete aus der holländischen katholischen Kirche) werden anstelle unserer agendarischen Gebete häufig benutzt. Die Gebete im Gottesdienst werden nicht selten mit Informationen verbunden.”

 Auffällig war, daß in keinem der eingegangenen Berichte - von „Konservativen” wie „Progressiven”! - freie Gebete des Pastors oder anderer Gemeindeglieder erwähnt wurden. Das pietistische Element war also nicht neu hervorgetreten, wie man es hätte vermuten können, da doch Versteinerung des Ritus beklagt und Unbehagen an der Agende empfunden wurde. - Wenn eine Gruppe sich zusammensetzt und einen Gottesdienst oder zumindest einzelne Gebete vorbereitet, oder wenn der Pfarrer dies am Schreibtisch tut, mit oder ohne andere Vorlagen, so bedeutet das Aktualisierung aufgrund einer vorgegebenen Ordnung. Auch eine solche Aktualisierung hat ihre Berechtigung, aber sie ist noch nicht Ausdruck von Spontaneität. Auffällig war, daß in keinem der eingegangenen Berichte - von „Konservativen” wie „Progressiven”! - freie Gebete des Pastors oder anderer Gemeindeglieder erwähnt wurden. Das pietistische Element war also nicht neu hervorgetreten, wie man es hätte vermuten können, da doch Versteinerung des Ritus beklagt und Unbehagen an der Agende empfunden wurde. - Wenn eine Gruppe sich zusammensetzt und einen Gottesdienst oder zumindest einzelne Gebete vorbereitet, oder wenn der Pfarrer dies am Schreibtisch tut, mit oder ohne andere Vorlagen, so bedeutet das Aktualisierung aufgrund einer vorgegebenen Ordnung. Auch eine solche Aktualisierung hat ihre Berechtigung, aber sie ist noch nicht Ausdruck von Spontaneität.
 Die meisten „Gottesdienste in neuer Gestalt” in den sechziger, siebziger Jahren blieben doch - trotz aller vordergründigen Gegensätzlichkeit zum Überlieferten - im alten Schema: Mehr rational bestimmt als spontan, wesentlich auf Z w e c k e gerichtet (Themen-Gottesdienst!), als sich entfaltend aus dem S i n n des Gottesdienstes. Die Unterscheidung von Sinn und Zweck des Gottesdienstes hat Romano Guardini 1918 in seiner programmatischen Schrift „Vom Geist der Liturgie” vielen bewußt gemacht. Er hat dabei durchaus die eigene, römisch-katholische Kirche im Auge gehabt, für die ja ebenfalls, wenn auch nicht so ausgeprägt wie im Protestantismus, Rationalität ein bestimmendes Element darstellt. Die meisten „Gottesdienste in neuer Gestalt” in den sechziger, siebziger Jahren blieben doch - trotz aller vordergründigen Gegensätzlichkeit zum Überlieferten - im alten Schema: Mehr rational bestimmt als spontan, wesentlich auf Z w e c k e gerichtet (Themen-Gottesdienst!), als sich entfaltend aus dem S i n n des Gottesdienstes. Die Unterscheidung von Sinn und Zweck des Gottesdienstes hat Romano Guardini 1918 in seiner programmatischen Schrift „Vom Geist der Liturgie” vielen bewußt gemacht. Er hat dabei durchaus die eigene, römisch-katholische Kirche im Auge gehabt, für die ja ebenfalls, wenn auch nicht so ausgeprägt wie im Protestantismus, Rationalität ein bestimmendes Element darstellt.
 Über den Ozean hinweg hat nun seit einem guten Jahrzehnt eine neue „charismatische Bewegung” die „alten” Kirchen ergriffen, ähnlich wie vor dreihundert Jahren in unserem Bereich der Pietismus als Antwort auf den dogmatischen Rationalismus und erstarrte Gottesdienstformen erschien. Mit der „charismatischen Bewegung” ist das freie Gebet bis zum Zungen- (oder Sprachen-) Reden, ist Spontaneität, ist ein spielerisches Element in Gottesdiensten, in Versammlungen verschiedenster Art neu in Erscheinung getreten. Die westliche Rationalität ist durch einen neuen Enthusiasmus in Frage gestellt, der feste Ritus - besonders im katholischen Bereich - durch Spontaneität mit neuem Leben erfüllt worden. Bemerkenswert ist, daß in dieser neuen Geist-Bewegung durchaus die Bereitschaft und Fähigkeit zu Stille und Meditation zu finden ist. Über den Ozean hinweg hat nun seit einem guten Jahrzehnt eine neue „charismatische Bewegung” die „alten” Kirchen ergriffen, ähnlich wie vor dreihundert Jahren in unserem Bereich der Pietismus als Antwort auf den dogmatischen Rationalismus und erstarrte Gottesdienstformen erschien. Mit der „charismatischen Bewegung” ist das freie Gebet bis zum Zungen- (oder Sprachen-) Reden, ist Spontaneität, ist ein spielerisches Element in Gottesdiensten, in Versammlungen verschiedenster Art neu in Erscheinung getreten. Die westliche Rationalität ist durch einen neuen Enthusiasmus in Frage gestellt, der feste Ritus - besonders im katholischen Bereich - durch Spontaneität mit neuem Leben erfüllt worden. Bemerkenswert ist, daß in dieser neuen Geist-Bewegung durchaus die Bereitschaft und Fähigkeit zu Stille und Meditation zu finden ist.
 Der Franziskanerpater Eugen Mederlet berichtet von einer „Begegnung mit katholischen Charismatikern” in Ann Arbor, Michigan, wo sechshundert junge Leute, meist Studenten, in einer Art Gemeinschaft leben. In fünfzig Häusern haben sie Wohnungen gemietet. Dort leben sie in einzelnen Wohnungen. Jeder Haushalt bildet eine Gruppe. Da heißt es: „In unserem Haushalt begann (es war Ferienzeit) der Tag um acht Uhr mit dem Frühstück. Dann wurden Gebetsintentionen ausgetauscht und etwa eine halbe Stunde frei dafür gebetet. Dann gingen wir in den Gebetsraum, wo wenigstens zwei Stunden lang nichts als Lob und Dank und Anbetung waren. Neben einigen Liedern war es zunächst hauptsächlich ein freies Singen und Beten in Sprachen, bei dem wir selbst eine starke Befreiung der inneren Freude und eine Innigkeit des Betens erlebten. Es war ohne jede Exaltiertheit, aber kraftvoll und frei. Der Franziskanerpater Eugen Mederlet berichtet von einer „Begegnung mit katholischen Charismatikern” in Ann Arbor, Michigan, wo sechshundert junge Leute, meist Studenten, in einer Art Gemeinschaft leben. In fünfzig Häusern haben sie Wohnungen gemietet. Dort leben sie in einzelnen Wohnungen. Jeder Haushalt bildet eine Gruppe. Da heißt es: „In unserem Haushalt begann (es war Ferienzeit) der Tag um acht Uhr mit dem Frühstück. Dann wurden Gebetsintentionen ausgetauscht und etwa eine halbe Stunde frei dafür gebetet. Dann gingen wir in den Gebetsraum, wo wenigstens zwei Stunden lang nichts als Lob und Dank und Anbetung waren. Neben einigen Liedern war es zunächst hauptsächlich ein freies Singen und Beten in Sprachen, bei dem wir selbst eine starke Befreiung der inneren Freude und eine Innigkeit des Betens erlebten. Es war ohne jede Exaltiertheit, aber kraftvoll und frei.

 Dieses Erlebnis der Glaubenskraft und Freude an Gott bei so jungen Menschen wurde uns zu einer großen Hoffnung für die Kirche. Das gemeinsame Beten und Singen ging dann langsam über in stilles einzelnes Betrachten der Heiligen Schrift und Besinnlichkeit. Am Abend kamen diese jungen Leute zusammen, um sich den Tag zu erzählen, sich gegenseitig zu korrigieren und neue Weisungen zu geben und zu erhalten. Dieses Erlebnis der Glaubenskraft und Freude an Gott bei so jungen Menschen wurde uns zu einer großen Hoffnung für die Kirche. Das gemeinsame Beten und Singen ging dann langsam über in stilles einzelnes Betrachten der Heiligen Schrift und Besinnlichkeit. Am Abend kamen diese jungen Leute zusammen, um sich den Tag zu erzählen, sich gegenseitig zu korrigieren und neue Weisungen zu geben und zu erhalten.
 An einem Abend war die Hochzeit von zwei jungen Leuten aus der Bewegung. Die ganze große Studentenkirche war gefüllt. Die Feier dauerte zwei volle Stunden. Die Liturgie, von einem älteren Priester gefeiert, ging wieder in aller kirchlichen Ordnung vor sich. Die freien Beiträge entstanden mit Spontaneität und Ordnung zugleich. Die Freude war so groß, daß nach der Feier ganz von selbst ein Reigentanz um den Altar beim Gesang der Loblieder entstand. (, . . . usque ad cornu altaris', ps. 117). Andere als geistliche Lieder haben wir nirgends gehört und auch keine andere Festlichkeit erlebt, als die der Glaubensfreude. Nach der Hochzeitsfeier war noch ein herzlicher Empfang in einem Saal mit einem einfachen kalten Büffet.” An einem Abend war die Hochzeit von zwei jungen Leuten aus der Bewegung. Die ganze große Studentenkirche war gefüllt. Die Feier dauerte zwei volle Stunden. Die Liturgie, von einem älteren Priester gefeiert, ging wieder in aller kirchlichen Ordnung vor sich. Die freien Beiträge entstanden mit Spontaneität und Ordnung zugleich. Die Freude war so groß, daß nach der Feier ganz von selbst ein Reigentanz um den Altar beim Gesang der Loblieder entstand. (, . . . usque ad cornu altaris', ps. 117). Andere als geistliche Lieder haben wir nirgends gehört und auch keine andere Festlichkeit erlebt, als die der Glaubensfreude. Nach der Hochzeitsfeier war noch ein herzlicher Empfang in einem Saal mit einem einfachen kalten Büffet.”
 Dieser Bericht stammt bereits aus dem Jahr 1972 (H. 1 der Ökumenischen Schriftenreihe, Schloß Craheim). Ähnliches gibt es heute hier und dort auch in unserem Bereich. Im Berliner Bezirk Kreuzberg finden in einem katholischen Gemeindezentrum regelmäßig an einem Abend im Monat Eucharistiefeiern statt, die etwa zwei Stunden dauern und Raum geben zu freien Gebeten und zur stillen Meditation. Der Friedensgruß wird nicht nur an den weitergegeben, neben dem man gerade steht. Manch einer macht sich auf und geht auch auf diesen oder jenen zu, der weiter entfernt von ihm sitzt. Vor zwanzig, dreißig Jahren bekam kaum jemals ein Katholik ein freies Gebet über die Lippen, heute ist es auf ökumenischen Versammlungen oft umgekehrt: Katholische Christen, Priester und Laien, beten frei vor anderen, während evangelische Christen sehr oft dazu nicht den Absprung finden. Leider hat sich ja auf evangelischer Seite die „charismatische Bewegung” oft neben der Kirche entwickelt, sicher auch darum, weil manche Kirchenmänner ihr von vornherein mit Skepsis begegnet sind. Die Verbreitung einer „charismatischen Bewegung” über Konfessions- und Staatsgrenzen hinweg ist ein deutliches Zeichen dafür, daß „Freizügigkeit” im Blick auf Formen der Frömmigkeit und des Gottesdienstes heute vielleicht auf Zeit verhindert, aber nicht rückgängig gemacht werden kann. Charismatische Aufbrüche werden von Theologen in evangelischen Landeskirchen, ja auch in Freikirchen, oft rundweg als „pfingstlerisch” abgetan - wobei zu bemerken ist, daß die Pfingstbewegung eine Antwort ist auf Versteinerung und Intellektualismus in „alt” gewordenen Kirchen, zu denen durchaus auch solche gehören können, die einmal mit einen „neuen Pfingsten” begonnen haben. Dieser Bericht stammt bereits aus dem Jahr 1972 (H. 1 der Ökumenischen Schriftenreihe, Schloß Craheim). Ähnliches gibt es heute hier und dort auch in unserem Bereich. Im Berliner Bezirk Kreuzberg finden in einem katholischen Gemeindezentrum regelmäßig an einem Abend im Monat Eucharistiefeiern statt, die etwa zwei Stunden dauern und Raum geben zu freien Gebeten und zur stillen Meditation. Der Friedensgruß wird nicht nur an den weitergegeben, neben dem man gerade steht. Manch einer macht sich auf und geht auch auf diesen oder jenen zu, der weiter entfernt von ihm sitzt. Vor zwanzig, dreißig Jahren bekam kaum jemals ein Katholik ein freies Gebet über die Lippen, heute ist es auf ökumenischen Versammlungen oft umgekehrt: Katholische Christen, Priester und Laien, beten frei vor anderen, während evangelische Christen sehr oft dazu nicht den Absprung finden. Leider hat sich ja auf evangelischer Seite die „charismatische Bewegung” oft neben der Kirche entwickelt, sicher auch darum, weil manche Kirchenmänner ihr von vornherein mit Skepsis begegnet sind. Die Verbreitung einer „charismatischen Bewegung” über Konfessions- und Staatsgrenzen hinweg ist ein deutliches Zeichen dafür, daß „Freizügigkeit” im Blick auf Formen der Frömmigkeit und des Gottesdienstes heute vielleicht auf Zeit verhindert, aber nicht rückgängig gemacht werden kann. Charismatische Aufbrüche werden von Theologen in evangelischen Landeskirchen, ja auch in Freikirchen, oft rundweg als „pfingstlerisch” abgetan - wobei zu bemerken ist, daß die Pfingstbewegung eine Antwort ist auf Versteinerung und Intellektualismus in „alt” gewordenen Kirchen, zu denen durchaus auch solche gehören können, die einmal mit einen „neuen Pfingsten” begonnen haben.
 Die „Freizügigkeit”, die viele - besonders junge - Christen heute für sich in Anspruch nehmen und praktizieren (oft bis hin zur Teilnahme an der Kommunion bei den offiziell von ihnen „getrennten Brüdern”), die Übernahme von Gottesdienst- und Frömmigkeitsformen aus der „anderen” Kirche durch einzelne Christen und besondere Gemeinschaften, durch Gemeinden, ja auch durch konfessionell oder regional bestimmte Kirchen im ganzen wird oft mit der Behauptung kritisiert, daß „schlichte Gemeindeglieder” verwirrt werden. Ich habe den Eindruck, daß viel mehr Kirchenmitglieder, die nur sehr selten zum Gottesdienst gehen und darum bestimmte Entwicklungen nicht mitvollzogen haben, über Veränderungen empört sind. Häufig erlebe ich, daß den Kirchen in einem Atemzug ihre Uneinigkeit u n d ihre größere Aufgeschlossenheit für die Charismen der anderen Konfession vorgeworfen wird. Die „Freizügigkeit”, die viele - besonders junge - Christen heute für sich in Anspruch nehmen und praktizieren (oft bis hin zur Teilnahme an der Kommunion bei den offiziell von ihnen „getrennten Brüdern”), die Übernahme von Gottesdienst- und Frömmigkeitsformen aus der „anderen” Kirche durch einzelne Christen und besondere Gemeinschaften, durch Gemeinden, ja auch durch konfessionell oder regional bestimmte Kirchen im ganzen wird oft mit der Behauptung kritisiert, daß „schlichte Gemeindeglieder” verwirrt werden. Ich habe den Eindruck, daß viel mehr Kirchenmitglieder, die nur sehr selten zum Gottesdienst gehen und darum bestimmte Entwicklungen nicht mitvollzogen haben, über Veränderungen empört sind. Häufig erlebe ich, daß den Kirchen in einem Atemzug ihre Uneinigkeit u n d ihre größere Aufgeschlossenheit für die Charismen der anderen Konfession vorgeworfen wird.

 Aber neben dieser Kritik vom Rande der Kirche her gibt es die Angst leitender und verwaltender Kirchenleute um die Erhaltung der vorhandenen Konfessionsgrenzen: Wenn der öffentliche Gottesdienst und die private Frömmigkeit nicht mehr eindeutig konfessionell unterscheidbar sind, bestellt die Gefahr, daß die Schäflein nicht mehr wissen, in welchen Stall sie gehören. So kann ein römisch-katholischer Kirchenbeamter die Aufnahme evangelischer Schüler in eine katholische Schule mit der Begründung ablehnen, man dürfe diesen Kindern nicht zumuten, sich zu bekreuzigen (während etwa zur gleichen Zeit der Ratsvorsitzende der EKD den evangelischen Christen empfiehlt, sich wieder zu bekreuzigen, wie auch Luther es getan hat); Protestanten wiederum haben Angst vor der „Verwechselungsgefahr” (ein juristischer Terminus!), wenn evangelische Pastoren liturgische Gewänder tragen, ja schon ein schwarzer Lektorenmantel kann Argwohn erregen. Aber neben dieser Kritik vom Rande der Kirche her gibt es die Angst leitender und verwaltender Kirchenleute um die Erhaltung der vorhandenen Konfessionsgrenzen: Wenn der öffentliche Gottesdienst und die private Frömmigkeit nicht mehr eindeutig konfessionell unterscheidbar sind, bestellt die Gefahr, daß die Schäflein nicht mehr wissen, in welchen Stall sie gehören. So kann ein römisch-katholischer Kirchenbeamter die Aufnahme evangelischer Schüler in eine katholische Schule mit der Begründung ablehnen, man dürfe diesen Kindern nicht zumuten, sich zu bekreuzigen (während etwa zur gleichen Zeit der Ratsvorsitzende der EKD den evangelischen Christen empfiehlt, sich wieder zu bekreuzigen, wie auch Luther es getan hat); Protestanten wiederum haben Angst vor der „Verwechselungsgefahr” (ein juristischer Terminus!), wenn evangelische Pastoren liturgische Gewänder tragen, ja schon ein schwarzer Lektorenmantel kann Argwohn erregen.
 Wir sollten uns darüber im klaren sein, daß unterschiedliche Formen des Gottesdienstes und der persönlichen Spiritualität - und erst recht sekundäre Merkmale wie das Sich-Bekreuzigen oder die liturgischen Gewänder - nicht unbedingt mit dem Bekenntnisstand einer Teil-Kirche oder überhaupt mit dem, was sie als ihr P r o p r i u m ansieht, verknüpft sein müssen. Psychische Grundstrukturen, ethnische Voraussetzungen, soziale und nationale Entwicklungen, ja grundsätzlich eine Entfaltung des H u m a n u m haben zur Vielgestaltigkeit christlicher Frömmigkeit und christlichen Gottesdienstes beigetragen. Innerhalb des Grundmusters von Ritus und Spontaneität, Rationalität und Enthusiasmus bewegt sich - oder verharrt - christlicher Gottesdienst in seinen verschiedenen Strukturen und Gestaltungsmöglichkeiten. Dies darzustellen habe ich in dem Schema auf Seite 135 versucht. Daß ein solches Schema niemals ganz „stimmt”, räume ich gern ein. Aber ich denke doch, daß die konfessionstypischen Entwicklungen und Erscheinungsformen annäherungsweise richtig wiedergegeben sind. Wir sollten uns darüber im klaren sein, daß unterschiedliche Formen des Gottesdienstes und der persönlichen Spiritualität - und erst recht sekundäre Merkmale wie das Sich-Bekreuzigen oder die liturgischen Gewänder - nicht unbedingt mit dem Bekenntnisstand einer Teil-Kirche oder überhaupt mit dem, was sie als ihr P r o p r i u m ansieht, verknüpft sein müssen. Psychische Grundstrukturen, ethnische Voraussetzungen, soziale und nationale Entwicklungen, ja grundsätzlich eine Entfaltung des H u m a n u m haben zur Vielgestaltigkeit christlicher Frömmigkeit und christlichen Gottesdienstes beigetragen. Innerhalb des Grundmusters von Ritus und Spontaneität, Rationalität und Enthusiasmus bewegt sich - oder verharrt - christlicher Gottesdienst in seinen verschiedenen Strukturen und Gestaltungsmöglichkeiten. Dies darzustellen habe ich in dem Schema auf Seite 135 versucht. Daß ein solches Schema niemals ganz „stimmt”, räume ich gern ein. Aber ich denke doch, daß die konfessionstypischen Entwicklungen und Erscheinungsformen annäherungsweise richtig wiedergegeben sind.
 Wenn das typische Merkmal einer Teil-Kirche absolut gesetzt wird und gar nicht oder kaum mehr die anderen Merkmale mit einbezieht, ist die Gefahr der Deformation da. Der Ritus, zum Beispiel, versteinert, wenn die „aktuellen Spitzen” des Gottesdienstes, die Predigt und die Fürbitten (grundsätzlich) ausfallen, wie es in morgenländischen Liturgien der Fall ist und in der römischen Messe der Fall war, bis durch die Liturgische Bewegung und schließlich das II. Vatikanische Konzil diese freien Elemente wiedergewonnen wurden. Selbstverständlich kann auch ein lutherischer oder reformierter Ritus erstarren, ja scheinbar „freie” Gebete in freien evangelischen Gemeinden können durch Wiederholung stereotyper Formulierungen zum Ritual werden, das zwar subjektiv ehrlich absolviert wird, aber mit Spontaneität nichts mehr zu tun hat. Wenn das typische Merkmal einer Teil-Kirche absolut gesetzt wird und gar nicht oder kaum mehr die anderen Merkmale mit einbezieht, ist die Gefahr der Deformation da. Der Ritus, zum Beispiel, versteinert, wenn die „aktuellen Spitzen” des Gottesdienstes, die Predigt und die Fürbitten (grundsätzlich) ausfallen, wie es in morgenländischen Liturgien der Fall ist und in der römischen Messe der Fall war, bis durch die Liturgische Bewegung und schließlich das II. Vatikanische Konzil diese freien Elemente wiedergewonnen wurden. Selbstverständlich kann auch ein lutherischer oder reformierter Ritus erstarren, ja scheinbar „freie” Gebete in freien evangelischen Gemeinden können durch Wiederholung stereotyper Formulierungen zum Ritual werden, das zwar subjektiv ehrlich absolviert wird, aber mit Spontaneität nichts mehr zu tun hat.
 Für uns als westliche Christen, ob wir von Rom, Wittenberg oder Genf her bestimmt sind, ist der „geschichtliche Ort” nicht nur im Blick auf unsere ethischen Entscheidungen, sondern auch für die Verkündigung und für die Gestaltung des Gottesdienstes im ganzen von Bedeutung gewesen. Der Ritus war bei uns niemals in dem Ausmaß zeitlos wie in den orthodoxen Kirchen: römische und evangelisch-lutherische Liturgie kennt von jeher nicht nur viele wechselnde Elemente in einem jeden Gottesdienst (siehe hierzu J. Boeckh, Wiederholung in Gebet und Gottesdienst, Quatember, 42. Jg./1978, S.140-152), sondern auch Wandlungen der gottesdienstlichen und damit auch musikalischen Formen im Laufe der Zeit. Unsere Gefahr sind Intellektualismus und Willkür, während Versteinerung die Gefahr orthodoxen Kirchentums und Schwärmerei die Gefahr des Enthusiasmus ist. Aber nicht jeder Enthusiasmus, jede Geistergriffenheit, die sich auch im Leibhaften zeigt, ist schon „schwärmerisch”, ebensowenig wie jeder Ritus geistlos, jede gedanklich anspruchsvolle Predigt intellektualistisch und jeder frei sich entwickelnde Gottesdienst chaotisch ist. Denken wir etwa an schwarze Gemeinden in Afrika oder in den USA, aber auch an „charismatische” Gottesdienste bei uns. Ich scheue mich nicht, für „charismatisch” „enthusiastisch” zu sagen, denn die Charismen sind, laut Paulus (1. Kor. 12-14), keineswegs auf Prophetie und Zungenrede beschränkt, es gibt auch Gnadengaben im Bereich des Rationalen! Für uns als westliche Christen, ob wir von Rom, Wittenberg oder Genf her bestimmt sind, ist der „geschichtliche Ort” nicht nur im Blick auf unsere ethischen Entscheidungen, sondern auch für die Verkündigung und für die Gestaltung des Gottesdienstes im ganzen von Bedeutung gewesen. Der Ritus war bei uns niemals in dem Ausmaß zeitlos wie in den orthodoxen Kirchen: römische und evangelisch-lutherische Liturgie kennt von jeher nicht nur viele wechselnde Elemente in einem jeden Gottesdienst (siehe hierzu J. Boeckh, Wiederholung in Gebet und Gottesdienst, Quatember, 42. Jg./1978, S.140-152), sondern auch Wandlungen der gottesdienstlichen und damit auch musikalischen Formen im Laufe der Zeit. Unsere Gefahr sind Intellektualismus und Willkür, während Versteinerung die Gefahr orthodoxen Kirchentums und Schwärmerei die Gefahr des Enthusiasmus ist. Aber nicht jeder Enthusiasmus, jede Geistergriffenheit, die sich auch im Leibhaften zeigt, ist schon „schwärmerisch”, ebensowenig wie jeder Ritus geistlos, jede gedanklich anspruchsvolle Predigt intellektualistisch und jeder frei sich entwickelnde Gottesdienst chaotisch ist. Denken wir etwa an schwarze Gemeinden in Afrika oder in den USA, aber auch an „charismatische” Gottesdienste bei uns. Ich scheue mich nicht, für „charismatisch” „enthusiastisch” zu sagen, denn die Charismen sind, laut Paulus (1. Kor. 12-14), keineswegs auf Prophetie und Zungenrede beschränkt, es gibt auch Gnadengaben im Bereich des Rationalen!

 Die geschichtlich gewordenen Kirchen haben, was Inhalt und Form ihrer Gottesdienste angeht, verschiedene Schwerpunkte und Merkmale. Für die einzelnen Christen, die sich heute oft nur partiell mit der Kirche, in der sie sich vorgefunden haben, identifizieren können, sollte der kleine Grenzverkehr einschließlich eucharistischer Gastfreundschaft von den kirchenleitenden Organen legalisiert und von den Brüdern und Schwestern in den eigenen Gemeinden toleriert werden. In unserer pluriformen Gesellschaft ist es auch nicht sinnvoll, daß überall eine Angleichung der Gottesdienstformen erfolgt, so daß es für den einzelnen keine echten Alternativen mehr gibt. Das gilt über die Konfessionsgrenzen hinweg und auch innerhalb einer Kirche. Die geschichtlich gewordenen Kirchen haben, was Inhalt und Form ihrer Gottesdienste angeht, verschiedene Schwerpunkte und Merkmale. Für die einzelnen Christen, die sich heute oft nur partiell mit der Kirche, in der sie sich vorgefunden haben, identifizieren können, sollte der kleine Grenzverkehr einschließlich eucharistischer Gastfreundschaft von den kirchenleitenden Organen legalisiert und von den Brüdern und Schwestern in den eigenen Gemeinden toleriert werden. In unserer pluriformen Gesellschaft ist es auch nicht sinnvoll, daß überall eine Angleichung der Gottesdienstformen erfolgt, so daß es für den einzelnen keine echten Alternativen mehr gibt. Das gilt über die Konfessionsgrenzen hinweg und auch innerhalb einer Kirche.
 Neben denen, die in der Kirche Spontaneität, freies Zeugnis oder auch Gespräch suchen, gibt es die anderen, die vor Gott zur Ruhe kommen möchten, die bereit sind zu hören, gerade weil sie sonst viel reden müssen, die im Unterschied zu ihrem abwechslungsreichen Alltag sich einen Gottesdienst wünschen, in dem Gebet und Lieder, die sie kennen, von Sonntag zu Sonntag wiederkehren. Zu dieser Gruppe gehören auch Akademiker, Mütter, Manager und Pädagogen (sogar Pastoren!), Menschen, die durchaus mit anderen Menschen zu tun haben, die im Hause, im Labor oder am Schreibtisch immer wieder Neuem ausgesetzt sind, in der Kirche aber keineswegs nur das Neue suchen. So hat die freie Gebetsversammlung ihren Platz neben dem gemeinschaftlichen Rosenkranz katholischer Christen, der zweckgerichtete, rational vorbereitete Thema-Gottesdienst neben einem Gottesdienst, der von Schweigen und Anbetung bestimmt ist, die Eucharistiefeier mit reicher musikalischer Gestaltung neben einem reinen Gebets-und Wort-Gottesdienst, der Gottesdienst mit einer evangelischen oder intellektuellen Predigt neben dem meditativ gefeierten Abendmahlsgottesdienst, in dem die Predigt nur eine untergeordnete Rolle spielt. Neben denen, die in der Kirche Spontaneität, freies Zeugnis oder auch Gespräch suchen, gibt es die anderen, die vor Gott zur Ruhe kommen möchten, die bereit sind zu hören, gerade weil sie sonst viel reden müssen, die im Unterschied zu ihrem abwechslungsreichen Alltag sich einen Gottesdienst wünschen, in dem Gebet und Lieder, die sie kennen, von Sonntag zu Sonntag wiederkehren. Zu dieser Gruppe gehören auch Akademiker, Mütter, Manager und Pädagogen (sogar Pastoren!), Menschen, die durchaus mit anderen Menschen zu tun haben, die im Hause, im Labor oder am Schreibtisch immer wieder Neuem ausgesetzt sind, in der Kirche aber keineswegs nur das Neue suchen. So hat die freie Gebetsversammlung ihren Platz neben dem gemeinschaftlichen Rosenkranz katholischer Christen, der zweckgerichtete, rational vorbereitete Thema-Gottesdienst neben einem Gottesdienst, der von Schweigen und Anbetung bestimmt ist, die Eucharistiefeier mit reicher musikalischer Gestaltung neben einem reinen Gebets-und Wort-Gottesdienst, der Gottesdienst mit einer evangelischen oder intellektuellen Predigt neben dem meditativ gefeierten Abendmahlsgottesdienst, in dem die Predigt nur eine untergeordnete Rolle spielt.
 Dafür, daß Teil-Kirchen heute meist nicht mehr in ihren überlieferten Form-Elementen verharren, war besonders der Bericht des Franziskanerpaters aus den USA kennzeichnend. Es wäre jedoch völlig falsch, wenn wir meinten - aufgrund eines idealistisch-protestantischen Vorurteils - daß damit nur das minder-wertige Äußere einem Wandel unterworfen sei. Wir haben es heute in weiten Bereichen der Christenheit mit einer fortschreitenden Konvergenz, das heißt Angleichung von Konfessionssystemen zu tun. Am wenigsten davon berührt ist wohl noch die Orthodoxie, obwohl sie selbst schon nachhaltige Wirkungen innerhalb der westlichen Christenheit gezeitigt hat. In Neu-DeIhi 1961, wo vier orthodoxe (darunter die russische) und zwei Pfingstkirchen in den Ökumenischen Rat der Kirchen aufgenommen wurden, hat sich bereits gezeigt, daß sogar Orthodoxie und Pfingstbewegung durch das Wissen um das Wirken des Heiligen Geistes, ja durch Geisterfülltheit ihrer so verschiedenartigen Gottesdienste näher als vermutet beieinander sind. Dafür, daß Teil-Kirchen heute meist nicht mehr in ihren überlieferten Form-Elementen verharren, war besonders der Bericht des Franziskanerpaters aus den USA kennzeichnend. Es wäre jedoch völlig falsch, wenn wir meinten - aufgrund eines idealistisch-protestantischen Vorurteils - daß damit nur das minder-wertige Äußere einem Wandel unterworfen sei. Wir haben es heute in weiten Bereichen der Christenheit mit einer fortschreitenden Konvergenz, das heißt Angleichung von Konfessionssystemen zu tun. Am wenigsten davon berührt ist wohl noch die Orthodoxie, obwohl sie selbst schon nachhaltige Wirkungen innerhalb der westlichen Christenheit gezeitigt hat. In Neu-DeIhi 1961, wo vier orthodoxe (darunter die russische) und zwei Pfingstkirchen in den Ökumenischen Rat der Kirchen aufgenommen wurden, hat sich bereits gezeigt, daß sogar Orthodoxie und Pfingstbewegung durch das Wissen um das Wirken des Heiligen Geistes, ja durch Geisterfülltheit ihrer so verschiedenartigen Gottesdienste näher als vermutet beieinander sind.

 Bei der Aufstellung des hier abgebildeten Schemas kam ich an einem Punkt in Verlegenheit. Ich wußte nicht, wo ich den Alt-Katholizismus und den Anglikanismus einzeichnen sollte. Gehört die anglikanische Kirchengemeinschaft zu der (römisch- und alt-)katholischen Kirche? Ist sie den reformierten Kirchen zuzugesellen oder mit dem Methodismus, der ja im Schoß der Kirche von England entstanden ist, zusammenzubringen? Daß ich mit Recht zögerte, den Anglikanismus einzuordnen, fand ich bestätigt, als ich einen Vortrag von Friedrich Heiler hervorholte, den er im Jahre 1926 in Berlin gehalten hat (in: Im Ringen um die Kirche II, München 1931, S. 391-441). Ich las darin unter der Überschrift: „Der Doppelcharakter der anglikanischen Kirche”: „Von allen Kirchen der Reformation zeigt keine eine so merkwürdige Struktur, hat keine eine so wechselvolle Geschichte, offenbart keine eine so große Vielgestaltigkeit wie die anglikanische Kirche. Sie ist in einem noch höheren Grade eine complexio oppositorum als die römische Kirche. Viele anglikanische Christen sind ganz besonders stolz auf diesen umfassenden Charakter ihrer Kirche, diese comprehensivness, wie sie zu sagen pflegen, diese Freiheit von aller Einseitigkeit, diese Fähigkeit, völlig verschiedene Richtungen, ja man muß sagen verschiedene Konfessionen unter einem und demselben Kirchendache zu vereinigen. Ein vor nicht langer Zeit herausgegebener Band von Aufsätzen anglikanischer Theologen sucht zu zeigen, wie die Eigenart der anglikanischen Kirche eben darin besteht, daß sie beides ist: Catholic and Reformed, katholisch und reformatorisch.” Bei der Aufstellung des hier abgebildeten Schemas kam ich an einem Punkt in Verlegenheit. Ich wußte nicht, wo ich den Alt-Katholizismus und den Anglikanismus einzeichnen sollte. Gehört die anglikanische Kirchengemeinschaft zu der (römisch- und alt-)katholischen Kirche? Ist sie den reformierten Kirchen zuzugesellen oder mit dem Methodismus, der ja im Schoß der Kirche von England entstanden ist, zusammenzubringen? Daß ich mit Recht zögerte, den Anglikanismus einzuordnen, fand ich bestätigt, als ich einen Vortrag von Friedrich Heiler hervorholte, den er im Jahre 1926 in Berlin gehalten hat (in: Im Ringen um die Kirche II, München 1931, S. 391-441). Ich las darin unter der Überschrift: „Der Doppelcharakter der anglikanischen Kirche”: „Von allen Kirchen der Reformation zeigt keine eine so merkwürdige Struktur, hat keine eine so wechselvolle Geschichte, offenbart keine eine so große Vielgestaltigkeit wie die anglikanische Kirche. Sie ist in einem noch höheren Grade eine complexio oppositorum als die römische Kirche. Viele anglikanische Christen sind ganz besonders stolz auf diesen umfassenden Charakter ihrer Kirche, diese comprehensivness, wie sie zu sagen pflegen, diese Freiheit von aller Einseitigkeit, diese Fähigkeit, völlig verschiedene Richtungen, ja man muß sagen verschiedene Konfessionen unter einem und demselben Kirchendache zu vereinigen. Ein vor nicht langer Zeit herausgegebener Band von Aufsätzen anglikanischer Theologen sucht zu zeigen, wie die Eigenart der anglikanischen Kirche eben darin besteht, daß sie beides ist: Catholic and Reformed, katholisch und reformatorisch.”
 Manche prophezeien heute, daß bei uns über kurz oder lang, wenn die Bindung der „großen” Kirchen an den Staat endgültig gelöst ist, amerikanische Kirchen Verhältnisse - viele Kirchen mit je eigenen Strukturen nebeneinander - kommen werden. Das anglikanische Modell erscheint mir besser, sinnvoller, auch dem Bild der Kirche, wie es sich von ihrem Ursprung her darstellt, durchaus entsprechend: Daß die christlichen Konfessionen in nuce bereits im Neuen Testament enthalten sind, hat Ernst Käsemann deutlich gemacht. Ebenso sind unterschiedliche Strukturen von Gemeindeversammlungen bereits in der frühen Kirche erkennbar. Aber es waren eben dennoch keine sich ausschließenden Konfessions-Kirchen, sondern sich ergänzende Kirchenstrukturen. Wenn die lex orandi, das „Gesetz” des Betens, die lex credendi, das „Gesetz” des Glaubens bestimmt, dann müßte die Einheit derer, die dem e i n e n Gott auf verschiedene Weise dienen, sich von der Basis her durchsetzen. Manche prophezeien heute, daß bei uns über kurz oder lang, wenn die Bindung der „großen” Kirchen an den Staat endgültig gelöst ist, amerikanische Kirchen Verhältnisse - viele Kirchen mit je eigenen Strukturen nebeneinander - kommen werden. Das anglikanische Modell erscheint mir besser, sinnvoller, auch dem Bild der Kirche, wie es sich von ihrem Ursprung her darstellt, durchaus entsprechend: Daß die christlichen Konfessionen in nuce bereits im Neuen Testament enthalten sind, hat Ernst Käsemann deutlich gemacht. Ebenso sind unterschiedliche Strukturen von Gemeindeversammlungen bereits in der frühen Kirche erkennbar. Aber es waren eben dennoch keine sich ausschließenden Konfessions-Kirchen, sondern sich ergänzende Kirchenstrukturen. Wenn die lex orandi, das „Gesetz” des Betens, die lex credendi, das „Gesetz” des Glaubens bestimmt, dann müßte die Einheit derer, die dem e i n e n Gott auf verschiedene Weise dienen, sich von der Basis her durchsetzen.
 Zur Evangelischen Michaelsbruderschaft gehörten von Anfang an lutherische und reformierte Christen, heute hat die Bruderschaft auch Alt-Katholiken und Christen aus den Freikirchen in ihren Reihen, neuerdings sogar zwei römische Katholiken. Damit wird deutlich, daß die Einheit von catholic and reformed auch bei uns möglich ist. Die Frage bleibt, wie weit dies allen unseren Brüdern und dem weiteren Kreis derer, die sich als Mitglieder oder Freunde zu den Berneuchnern zählen, bewußt ist. Zur Evangelischen Michaelsbruderschaft gehörten von Anfang an lutherische und reformierte Christen, heute hat die Bruderschaft auch Alt-Katholiken und Christen aus den Freikirchen in ihren Reihen, neuerdings sogar zwei römische Katholiken. Damit wird deutlich, daß die Einheit von catholic and reformed auch bei uns möglich ist. Die Frage bleibt, wie weit dies allen unseren Brüdern und dem weiteren Kreis derer, die sich als Mitglieder oder Freunde zu den Berneuchnern zählen, bewußt ist.
 Ein Professor der Theologie hat vor einigen Jahren seinen Studenten mit warnender Stimme erklärt: „Wenn die Berneuchner und die Pietisten sich vereinen, das ist das Ende der Kirche.” - Sagen wir für „Pietisten”, dem heutigen Sprachgebrauch entsprechend, einmal „Charismatiker”: was der Professor als Ende (seiner Theologie?) befürchtete, könnte ein neuer Anfang sein, in der Kirche, für die ganze Kirche. Ein Professor der Theologie hat vor einigen Jahren seinen Studenten mit warnender Stimme erklärt: „Wenn die Berneuchner und die Pietisten sich vereinen, das ist das Ende der Kirche.” - Sagen wir für „Pietisten”, dem heutigen Sprachgebrauch entsprechend, einmal „Charismatiker”: was der Professor als Ende (seiner Theologie?) befürchtete, könnte ein neuer Anfang sein, in der Kirche, für die ganze Kirche.
Quatember 1985, S. 130-139
Leserbriefe:
Hans-Joachim Dummer
Gerhard Gloning
|